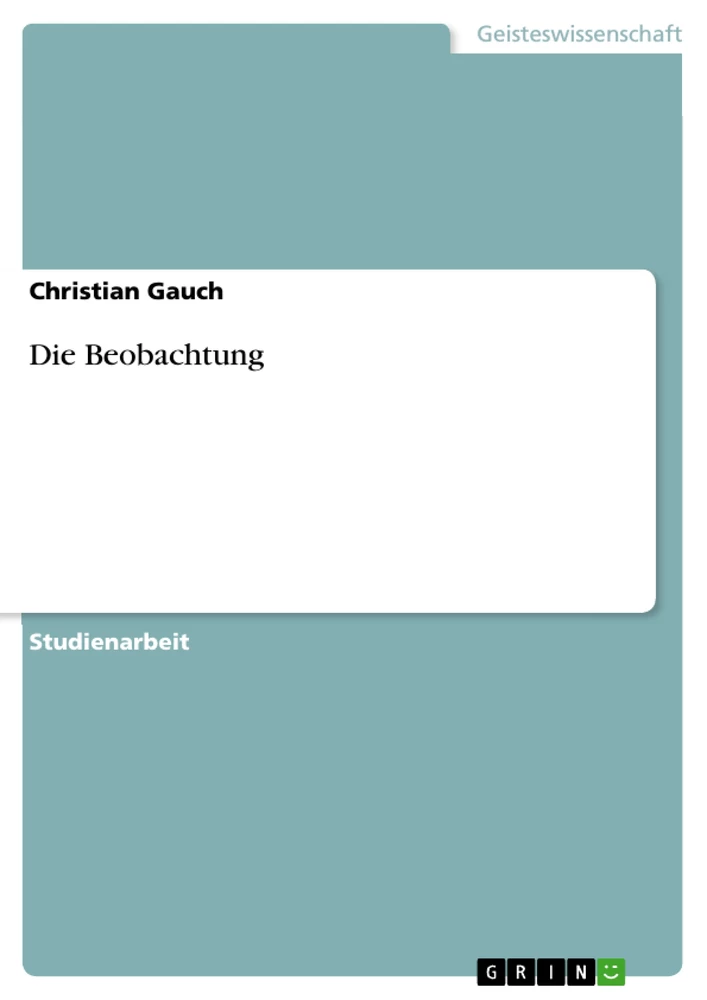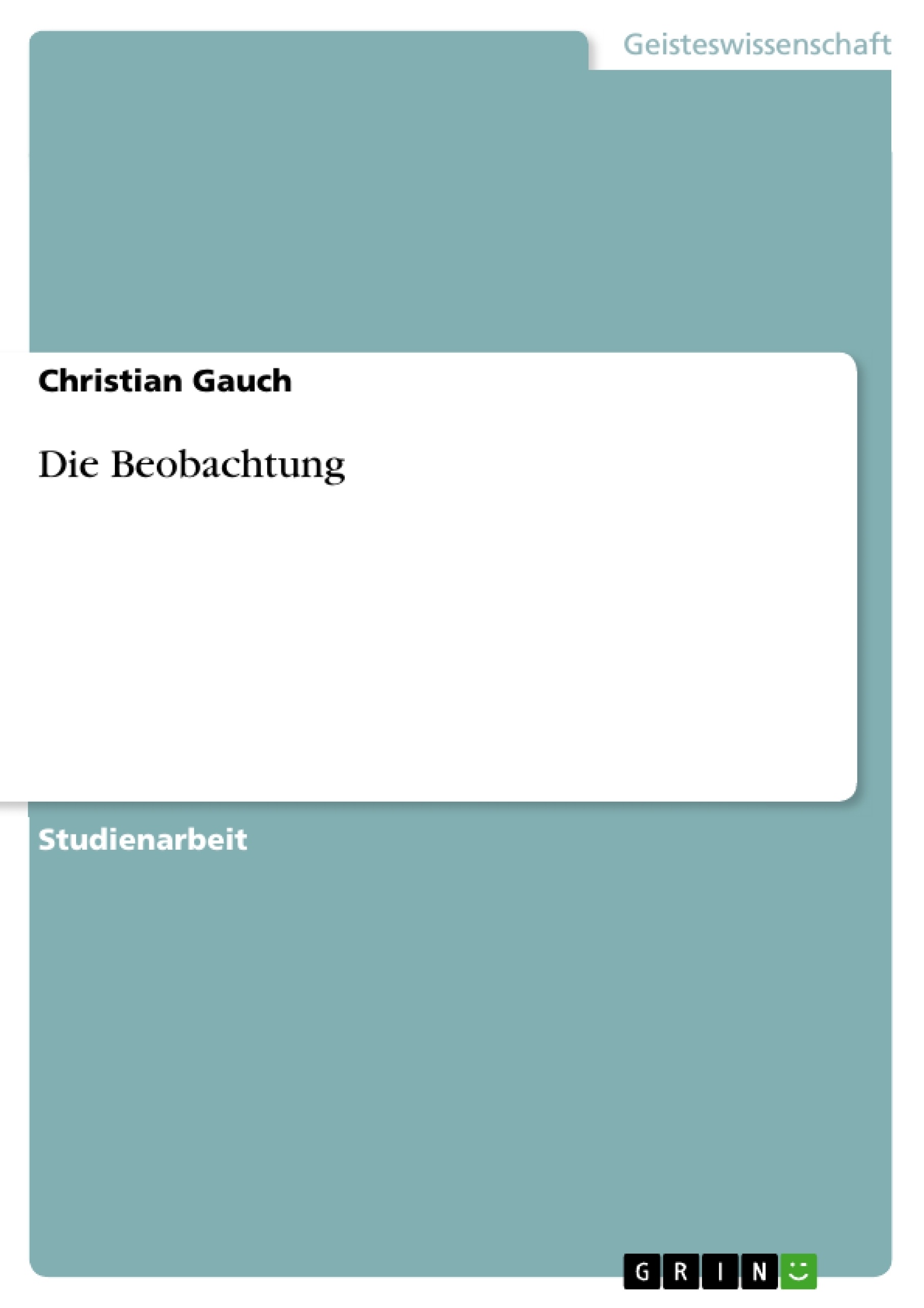Was, wenn der Schlüssel zum Verständnis der menschlichen Seele nicht in Fragebögen und Statistiken liegt, sondern im stillen Beobachten, im Eintauchen in den Alltag anderer? Dieses Buch öffnet die Tür zu einer faszinierenden Welt der teilnehmenden Beobachtung, einer qualitativen Forschungsmethode, die es ermöglicht, soziale Wirklichkeit in ihrer reinsten Form zu erfassen. Entdecken Sie, wie Ethnologen und Kulturanthropologen seit Jahrzehnten diese Technik nutzen, um Subkulturen zu erforschen, soziale Dynamiken zu entschlüsseln und verborgene Handlungsmotive aufzudecken. Von der naiven Alltagsbeobachtung bis zur systematischen, wissenschaftlichen Analyse werden die verschiedenen Formen der Beobachtung beleuchtet: strukturiert versus unstrukturiert, offen versus verdeckt, teilnehmend versus nicht-teilnehmend, Feld- versus Laborbeobachtung. Tauchen Sie ein in die ethischen und methodologischen Herausforderungen, die mit dieser Methode einhergehen, und erfahren Sie, wie Forscher sich im Spannungsfeld zwischen Nähe und Distanz bewegen, um valide und zuverlässige Daten zu gewinnen. Erfahren Sie, wie Beobachtungsdaten aufgezeichnet und ausgewertet werden, um tiefgreifende Einblicke in soziale Prozesse und individuelle Verhaltensweisen zu gewinnen. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Leitfaden für Studierende, Forschende und alle, die die Welt um sich herum besser verstehen wollen, ein Werkzeugkasten für die Erforschung des sozialen Lebens, jenseits oberflächlicher Befragungen und standardisierter Erhebungen. Es zeigt, wie man durch aufmerksames Beobachten und empathisches Eintauchen in fremde Welten, ein tieferes Verständnis für die Komplexität menschlichen Handelns entwickeln kann. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie die Macht der teilnehmenden Beobachtung als Schlüssel zur Erkenntnis. Dieses Buch bietet einen umfassenden Einblick in die Methodik der qualitativen Sozialforschung, insbesondere die teilnehmende Beobachtung, und ist somit relevant für Studierende der Soziologie, Ethnologie, Kulturanthropologie und verwandter Disziplinen. Es werden die verschiedenen Formen der Beobachtung, von der naiven bis zur wissenschaftlichen, sowie deren Vor- und Nachteile diskutiert. Ein besonderer Fokus liegt auf der Rolle des Beobachters im Feld, den verschiedenen Beobachtungsphasen und den Herausforderungen bei der Aufzeichnung und Auswertung der Daten. Das Buch behandelt auch die ethischen Aspekte der Forschung und gibt praktische Tipps für die Durchführung von Beobachtungsstudien. Es ist ein wertvoller Leitfaden für alle, die sich für qualitative Forschungsmethoden interessieren und lernen möchten, wie man durch Beobachtung soziale Phänomene verstehen und interpretieren kann.
Gliederung
1. Einleitung
1.1 Gegenstand und Begrenzungen
2. Formen der Beobachtung
2.1 Naive vs. Wissenschaftliche Beobachtung
2.2 Strukturierte und unstrukturierte Beobachtung
2.3 Offene und verdeckte Beobachtung
2.4 Teilnehmende und nicht-teilnehmende Beobachtung
2.5 Aktiv und passiv teilnehmender Beobachter
2.6 Feld- und Laborbeobachtung
2.7 Zusammenfassung der Beobachtungsformen
3. Die teilnehmende Beobachtung aus qualitativer Sicht
3.1 Die Rolle des Beobachters
3.2 Das Beobachtungsfeld
3.3 Beobachtungsphasen und deren Bewältigung
4. Die Aufzeichnung der Beobachtungsdaten
5. Die Auswertung der Ergebnisse
6. Quellenangabe
1. Einleitung
Bei der teilnehmenden Beobachtung handelt es sich um eine Methode die aus der empirischen Sozialwissenschaft nicht mehr wegzudenken ist. Es handelt sich dabei ganz klar um eine qualitative Methode die oft im Vorfeld zu anderen Methoden, hauptsächlich aber in der Ethnologie und Kulturanthropologie Anwendung findet.
Obgleich sie von Vertretern der quantitativen Sozialforschung oft als unwissenschaftlich abgetan wird, hat die „participant observation“ gerade im Bereich der Erforschung von Subkulturen schon größere Erfolge als andere Methoden zu verbuchen.
Anwendung findet sie also vor allem dort, „wo es unter spezifischen theoretischen Perspektiven um die Erfassung der sozialen Konstituierung von Wirklichkeit und um Prozesse des Aushandelns von Situationsdefinitionen um das Eindringen in ansonsten nur schwer zugängliche Forschungsfelder geht oder wo für die Sozialforschung Neuland betreten wird.“( Lamnek,1995, S.240 )
Schließlich lassen sich die „soziale Wirklichkeit“ und die Beweggründe und Absichten des Handelnden nach Mead nur durch symbolisch vermittelte und kommunikativ bedingte Interaktion rekonstruieren.
Neben der Rekonstruktion lautet ein weiteres Ziel der Soziologen bei der Beobachtung eine möglichst umfassende Analyse des Handlungskontextes der Individuen zu erstellen, wobei das soziale Handeln immer im Mittelpunkt steht.
„Beobachtung richtet sich also immer auf ein Verhalten, dem sowohl ein subjektiver Sinn, wie eine objektive soziale Bedeutung zukommt. (Lamnek 1995, S.241) Der Beobachter nimmt dabei direkt am Alltagsleben der zu erforschenden Personen und Gruppen teil, er bewegt sich in deren natürlicher Lebenswelt.
Unterscheiden muss man jedoch die pragmatisch, emotional teilnehmende Beobachtung von der eher kognitiv betrachtenden.
Während bei der erstgenannten Form das Verstehen im Mittelpunkt steht ist die letztere eher distanziert und beobachtend im engeren Sinne. Die Aneignung eines spezifischen Sinnverständnisses bezogen auf die zu erforschende Gruppe bildet jeweils die Grundlage für jemanden der die Durchführung einer Beobachtung plant. „Gültigkeit und Zuverlässigkeit der gewonnen Daten [...] können nämlich gefährdet werden, wenn die geltenden Sinn- und Bedeutungszusammenhänge des analysierten soziokulturellen Systems nicht beachtet werden. (Lamnek 1995, S.242)
1.1 Gegenstand und Begrenzungen
Die Beobachtung gehört sicherlich zur Grundlagenforschung in den Sozialwissenschaften. Im Gegensatz zur Befragung, welche sich auf die Ermittlung von Einstellungen, Meinungen und Gefühlen konzentriert, wird die Beobachtung zur Feststellung von Verhaltensweisen herangezogen. Sie erlaubt es, soziales Verhalten festzuhalten wann es geschieht, unabhängig von der Bereitschaft der Probanden.
Dennoch unterliegt die Beobachtung einigen, im folgenden erläuterten Begrenzungen:
- Lokale Restriktion
Der Beobachtungsgegenstand sollte, um ein valides Ergebnis zu erhalten, sich auf eine überschaubare kleine Gruppe oder auf ein Individuum reduzieren, die auch in ihrem Handlungsfeld bestimmte abgegrenzte Räume nicht verlasen. Schließlich ist der Beobachter auf den Einsatz seiner Sinnesorgane (Ohren, Augen) angewiesen.
- Zeitliche Restriktion
Die Beobachtung kann, nicht zuletzt aus ökonomischen Gründen, immer nur Ausschnitte aus dem sozialen Geschehen erfassen. So muss die Beobachtung einen klar definierten Anfang und ein Ende haben und kann nicht beliebig andauern.
- Restriktionen durch den Gegenstand
Die Methode der Beobachtung kann sich nur auf Verhaltensweisen konzentrieren während andere interessante Tatbestände außen vor bleiben.
Zusätzlich können nur Verhaltensweisen von Individuen oder Gruppen beobachtet werden zu denen der Forscher auch Zugang findet. Wird er nicht akzeptiert, wird er auch keine validen Ergebnisse erhalten können. Es lassen sich also mit der Beobachtung keine beliebigen sozialen Zusammenhänge untersuchen, sie ist lediglich eine Methode um „soziales Handeln, methodisch abgesichert in den Griff zu bekommen.“ (Lamnek 1995, S.246)
„Ihre Einsatzmöglichkeiten, und damit auch ihre Interpretationsmöglichkeiten der durch sie erhobenen Daten liegen in einem ganz spezifischen Bereich, den wir einerseits durch die theoretischen Abklärungen, andererseits durch die praktische Durchführbarkeit fixiert haben.“ (Atteslander 1971, S.130)
2. Formen der Beobachtung
Zunächst kann man die direkte von der indirekten Beobachtung unterscheiden. Während bei der ersten Form die Verhaltensbeobachtung im Vordergrund steht, bezieht sich die indirekte Beobachtung eher auf die Auswirkungen der jeweiligen Verhaltensweisen (z.B. Inhaltsanalyse, Befragung)
Die einzelnen Verfahren direkter Beobachtung können wie folgt klassifiziert werden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Erfassung zum Zweck der Erfassung vornehmlich
Quantifizierung qualitativer Merkmale
Nach: Atteslander 1971, S.131
2.1 Naive versus wissenschaftliche Beobachtung
Die systematische, wissenschaftliche Beobachtung unterscheidet sich von der Alltagsbeobachtung durch folgende Kriterien der Wissenschaftlichkeit:
- „wiederholte Prüfungen und Kontrolle hinsichtlich der Gültigkeit, Zuverlässigkeit und Genauigkeit.“ (Jahoda et al. 1996, S.77 Hervorhebung S.L.)
- systematische Aufzeichnung der beobachteten Ereignisse
- sorgfältige Planung im Vorfeld
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema der teilnehmenden Beobachtung gemäß diesem Text?
Der Text behandelt die teilnehmende Beobachtung als eine qualitative Methode in der empirischen Sozialwissenschaft, insbesondere in der Ethnologie und Kulturanthropologie. Es geht um die Erfassung der sozialen Konstituierung von Wirklichkeit, das Eindringen in schwer zugängliche Forschungsfelder und die Analyse des Handlungskontextes von Individuen.
Was sind die Hauptformen der Beobachtung, die in diesem Text unterschieden werden?
Der Text unterscheidet zwischen naiven und wissenschaftlichen Beobachtungen, strukturierten und unstrukturierten, offenen und verdeckten, teilnehmenden und nicht-teilnehmenden, aktiv und passiv teilnehmenden, Feld- und Laborbeobachtungen sowie direkten und indirekten Beobachtungen.
Welche Einschränkungen der teilnehmenden Beobachtung werden im Text genannt?
Die Einschränkungen umfassen lokale Restriktionen (beschränkter Beobachtungsraum), zeitliche Restriktionen (begrenzter Beobachtungszeitraum) und Restriktionen durch den Gegenstand (Konzentration auf beobachtbare Verhaltensweisen, Zugangsprobleme zu Gruppen).
Wie unterscheidet sich wissenschaftliche Beobachtung von Alltagsbeobachtung?
Wissenschaftliche Beobachtung zeichnet sich durch wiederholte Prüfungen und Kontrollen der Gültigkeit, Zuverlässigkeit und Genauigkeit aus, systematische Aufzeichnung der beobachteten Ereignisse, sorgfältige Planung im Vorfeld und die Verfolgung eines bestimmten Forschungszwecks.
Was ist der Unterschied zwischen pragmatisch-emotional teilnehmender Beobachtung und kognitiv betrachtender Beobachtung?
Bei der pragmatisch-emotional teilnehmenden Beobachtung steht das Verstehen im Mittelpunkt, während die kognitiv betrachtende Beobachtung eher distanziert und beobachtend im engeren Sinne ist.
Was ist das Ziel der Beobachtung nach Mead?
Nach Mead dient die Beobachtung dazu, die soziale Wirklichkeit und die Beweggründe und Absichten des Handelnden durch symbolisch vermittelte und kommunikativ bedingte Interaktion zu rekonstruieren.
Was sind die Bestandteile einer wissenschaftlichen Beobachtung?
Wiederholte Prüfungen, systematische Aufzeichnung der Ereignisse, sorgfältige Planung im Vorfeld und die Verfolgung eines bestimmten Forschungszweck.
Worauf richtet sich die Beobachtung?
Die Beobachtung richtet sich immer auf ein Verhalten, dem sowohl ein subjektiver Sinn als auch eine objektive soziale Bedeutung zukommt.
- Quote paper
- Christian Gauch (Author), 2001, Die Beobachtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103351