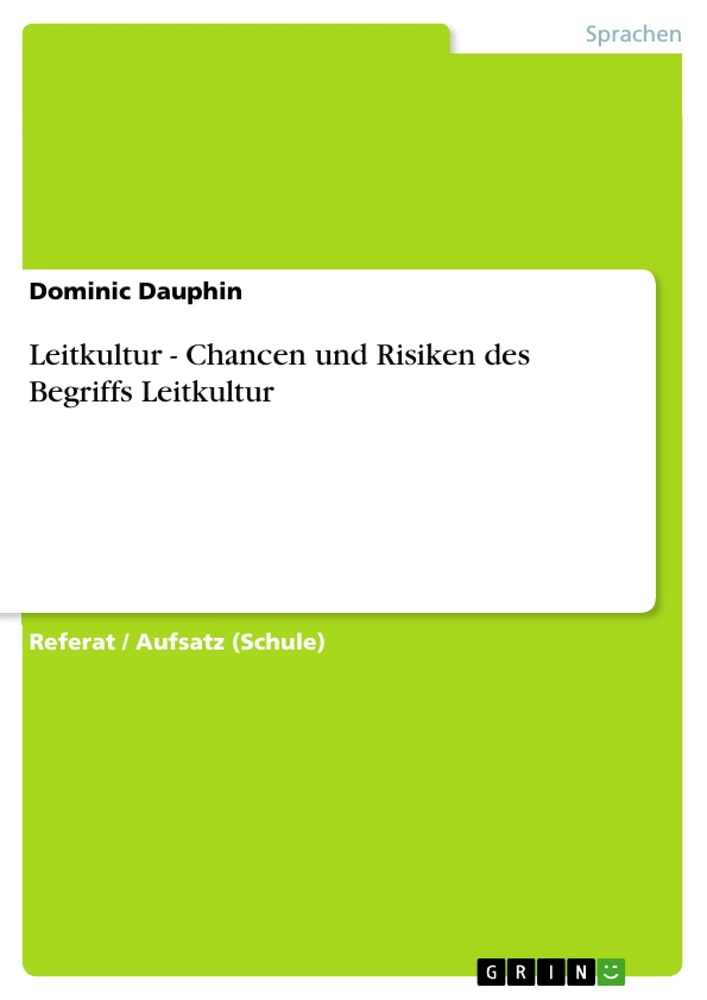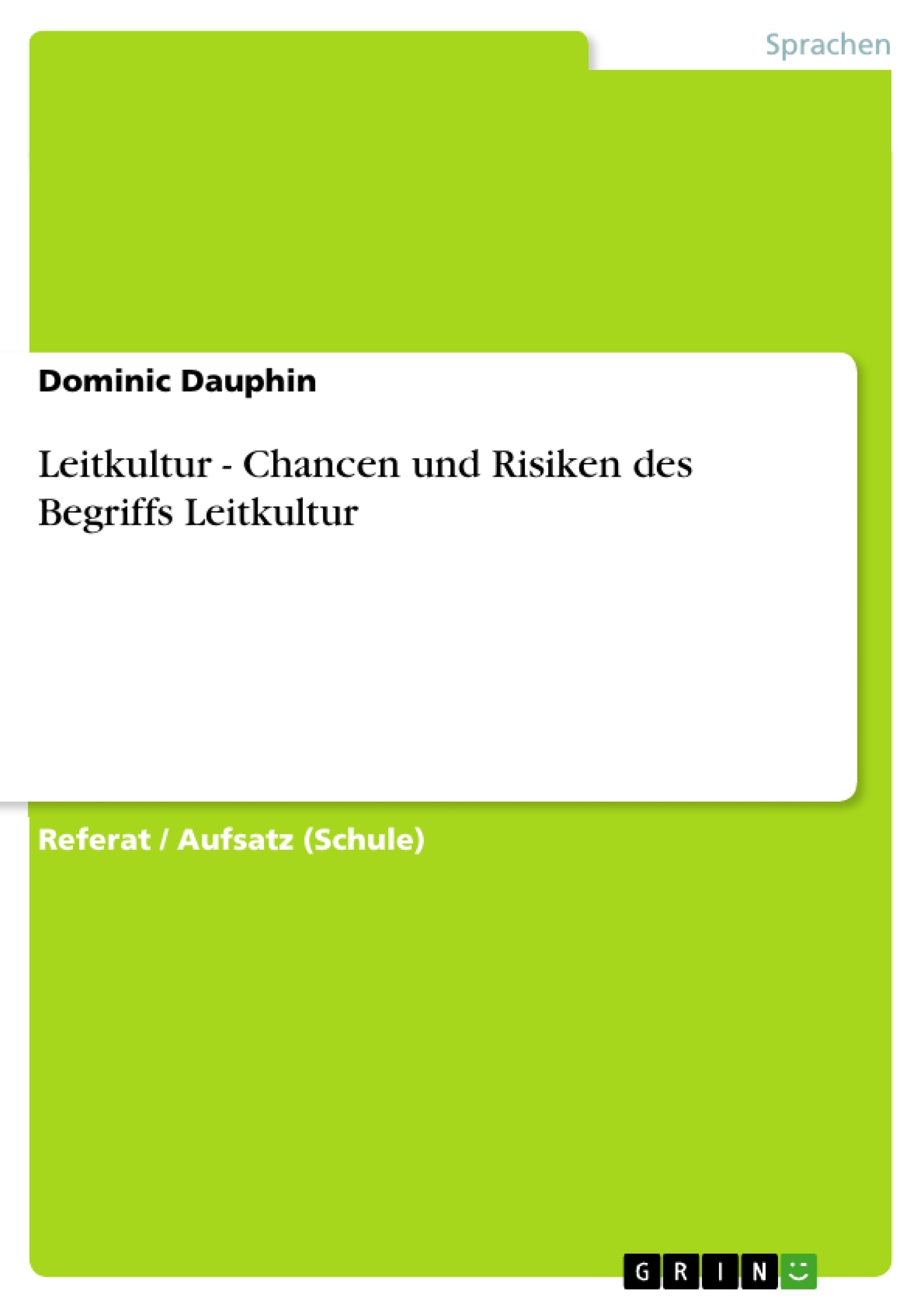Was bedeutet es, deutsch zu sein? In einer Zeit, in der Globalisierung und Migration die kulturelle Landschaft Europas prägen, wirft diese Frage einen Schatten auf die deutsche Identität. Die Debatte um die "deutsche Leitkultur" ist weit mehr als eine akademische Übung; sie ist ein Spiegelbild der Ängste und Hoffnungen einer Nation, die sich zwischen Tradition und Moderne, zwischen dem Wunsch nach Bewahrung und der Notwendigkeit zur Öffnung neu verorten muss. Friedrich Merz' unbedachte Äußerung im Bundestag entfachte eine Kontroverse, die bis heute anhält: Sollen sich Zuwanderer an eine vermeintlich "deutsche Leitkultur" anpassen, oder ist eine solche Forderung Ausdruck einer neuen Form von Nationalismus? Dieses Buch analysiert die vielschichtigen Aspekte dieser Debatte, von den Chancen einer gemeinsamen Identität für den Zusammenhalt der Gesellschaft bis zu den Risiken der Ausgrenzung und Diskriminierung. Es beleuchtet die historischen Wurzeln des Begriffs "Leitkultur", untersucht seine ideologischen Implikationen und zeigt, wie er in der politischen Auseinandersetzung instrumentalisiert wird. Dabei werden sowohl die Argumente der Befürworter einer "deutschen Leitkultur" als auch die Bedenken ihrer Kritiker umfassend dargestellt. Ist die Idee einer "Leitkultur" ein notwendiges Instrument zur Integration und zur Stärkung des nationalen Selbstbewusstseins, oder ist sie ein Hindernis für eine offene und vielfältige Gesellschaft? Kann eine "kulturelle Hausordnung", basierend auf den Werten des Grundgesetzes, einen Konsens schaffen, der alle Bürger einschließt, oder führt sie zwangsläufig zu einer Hierarchisierung von Kulturen und zur Abwertung des Fremden? Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen ist von entscheidender Bedeutung für die Zukunft Deutschlands und für das Zusammenleben verschiedener Kulturen in einer globalisierten Welt. Dieses Buch bietet eine fundierte und differenzierte Analyse der "Leitkulturdebatte" und liefert wertvolle Erkenntnisse für alle, die sich für die Frage nach der deutschen Identität interessieren. Es ist ein Beitrag zur politischen Bildung und zur Förderung eines offenen und konstruktiven Dialogs über die Herausforderungen der multikulturellen Gesellschaft. Die Suche nach einer gemeinsamen Basis, die Vielfalt respektiert und gleichzeitig den Zusammenhalt stärkt – darum geht es in dieser wichtigen und aktuellen Debatte. Tauchen Sie ein in die Kontroverse und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung.
Inhaltsverzeichnis
A) Der Beginn der Leitkulturdebatte
B) Chancen und Risiken des Begriffs „Leitkultur“
I. Chancen der Leitkultur
1. Bedürfnis jedes Einzelnen nach Identifikation
2. Verhid und Lebensart durch ausländische Einflüsse
3. Leitkultur ist „kulturelle Hausordnung“, verankert durch das Grundgesetz
II. Risiken der Leitkultur
1. Politische Konsolidierung der BRD erschwert Etablierung einer einheitlichen Leitkultur
2. „deutsche Leitkultur“ schreckt Zuwanderer ab
3. Begriff ist Forderung nach Assimilation, Unterordnung und Ausgrenzung
III. Gesellschaft mit allgemeinen Normen notwendig
C) Leitkulturdebatte „typisch deutsch“
A) Berlin, 18. Oktober 2000. Sitzung des deutschen Bundestags. Der Vorsitzende der
CDU/CSU - Bundestagsfraktion Friedrich Merz macht die eher unbedachte Äußerung, Zuwanderer müssten sich einer „deutschen Leitkultur anpassen“, und entfachte damit einen politischen Flächenbrand mit einem Ausmaß, mit dem er selbst nicht gerechnet hatte. Was meinte Merz mit „deutscher Leitkultur“? Lexika und Duden geben keine Auskunft darüber. Das Zusammensetzen von zwei Begriffen zu einem neuen, eine Eigenart der deutschen Sprache ergibt nicht automatisch einen Sinn. Um eine Definition des Begriffs zu erhalten, wäre es sinnvoll, beide Teile zu definieren: Der Begriff „leiten“ wird vom Duden wie folgt erklärt:
„Führen, lenken: einer Sache vorstehen: Ordnung halten in etwas.“ Kultur wird so beschrieben: „Die gesamten Lebensäußerungen eines Volkes: alle künstlerischen und geistigen Lebensäußerungen.“1 Dem zufolge würde der Begriff „deutsche Leitkultur“ bedeuten, dass das kulturelle Leben in Deutschland von deutschen Werten bestimmt, dominiert und kontrolliert wird. Insbesondere würde dies eine Dominanz gegenüber Werten und Weltanschauungen von Menschen aus anderen Kulturkreisen zur Folge haben.
Linke Elemente in der deutschen Politik werfen der CDU einen neuen deutschen Nationalismus vor, eine Politik der Forderung nach Assimilation und Unterordnung; schwingt da nicht ein bisschen Kaiser Wilhelms Satz „Am deutschen Wesen soll die Welt genesen“ mit? Breite Zustimmung erhält er von den rechtsextremen Republikanern2. Merz selbst korrigiert später seine unpräzise Aussage, er spricht von einer „freiheitlich deutschen Leitkultur“3. Die bereits losgetretene Politlawine konnte er jedoch nicht mehr stoppen, sie hält bis zum heutigen Tag an. In einer am 23.04.2001 veröffentlichten Grundsatzerklärung zum Thema Zuwanderung schreibt die konservativere Schwesterpartei CSU:
„Maßstab für die Integration ist die in jedem Kulturstaat herrschende Leitkultur. In Deutschland beruht sie auf der Grundlage europäisch-abendländischer Werte mit den Wurzeln Christentum, Aufklärung und Humanismus.“4
Damit wären längst nicht alle Fragen geklärt. Wie genau soll diese Leitkultur aussehen? Und vor allem welche Chancen und Risiken birgt die Verwendung dieses
Begriffs in sich? Diese komplexe Frage, die bis heute weder Regierung noch
Opposition eindeutig beantworten konnten, soll im Folgenden erörtert werden.
B) Eine einheitliche Leitkultur gab es bereits oftmals in der deutschen Geschichte. Unbestreitbar ist wohl, dass diese sich in der Regel wenig positiv auswirkten, man nehme nur die dominierenden Strömungen im Deutschen Reich von 1933-1945 oder in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR) bis 1989. Aufgrund dieser Erfahrungen lässt sich wohl mit Recht behaupten, dass die Verwendung einer „Leitkultur“ sehr wohl Risiken in sich birgt, es können sich jedoch auch ungeahnte Chancen eröffnen.
I. Eine einheitliche Leitkultur kann sehr wohl gewisse Chancen für alle Mitglieder der Gesellschaft bringen.
1. Jeder einzelne Mensch hat das angeborene Bedürfnis, sich mit einer Sache, einer Gruppe von Menschen oder einem System zu identifizieren. Unter anderem führte dieses Bedürfnis auch zur Formierung der 68er-Generation in Westdeutschland sowie zu ähnlichen Gruppierungen in anderen Westblock-Staaten, indem sich Anfang der 60er Jahre überall in der westlichen Welt Menschen, vornehmlich Jugendliche mit dem jungen, dynamischen Präsidenten der Vereinigten Staaten, John F. Kennedy und seiner liberalen Politik, sowie mit dem liberalen Papst Johannes XXIII identifizierten. Obwohl man dringend davon Abstand nehmen sollte, Leitfigur mit Leitkultur gleichzusetzen, wäre eine einheitliche, alle einschließende deutsche Leitkultur Fundament für jeden Einwohner der Bundesrepublik Deutschland. Er könnte sagen, das ist meine Kultur, zu der gehöre ich. Das wäre eine große Stärkung des Selbstbewusstseins jedes Individuums und vor allem der ganzen Nation. Man nehme als Beispiel die USA. Jeder Amerikaner ist sich trotz des viel kritisierten Multikulturalismus seiner Kultur und seines Erbes sehr gut bewusst. Von einer einheitlichen Leitkultur kann hier sehr wohl die Rede sein.
Aus diesem Grund ist eine einheitliche Leitkultur auch in Deutschland, das wirtschaftlich als Weltmacht gilt, unbedingt erforderlich, um auch das internationale soziale und politische Ansehen Deutschlands zu verbessern.
2. Ein viel wesentlicher Punkt ist, dass eine einheitliche deutsche Leitkultur erforderlich ist, um einer Überwucherung der deutschen Sprache und Kultur durch
Anglizismen und ausländische Lebensarten, insbesondere dem amerikanischen „way of life“ zu verhindern, weil sich Jahrhunderte von sprachlicher und kultureller Entwicklung nicht einfach so von fremden Einflüssen überlagern lassen und somit in Vergessenheit geraten dürfen. Es ist nahezu unmöglich, heute eine Fernsehsendung zu sehen oder einen Zeitungsartikel ohne Anglizismen zu lesen. Begriffe wie „News“, „Show“, „cool“, „Party” u.v.m gehören inzwischen zur gängigen Sprache.
Amerikanische Kulturbereiche, wie diverse Musikrichtungen, Filme, Kleidungsstücke oder „Fast Food“ - Restaurants werden heute als ganz selbstverständlich im kulturellen Leben in Deutschland akzeptiert, wobei traditionelle deutsche und abendländische Werte immer mehr in den Hintergrund rücken. Eine Leitkultur, die auf traditionell deutschen Werten beruht, ist deshalb notwendig, um die fortschreitende „Amerikanisierung“ der Gesellschaft aufzuhalten. Als Beispiel soll ein Land angeführt werden, das es geschafft hat, die eigene Kultur und Identität ausreichend zu wahren, und trotzdem nicht als fremdenfeindlich gilt: Frankreich. In der französischen Sprache gibt es im Vergleich mit der deutschen fast keine Anglizismen, wohl ein Resultat von „Pflege“ der Sprache. Auch in anderen Kulturbereichen haben die Franzosen klare Richtlinien. Im Rundfunk muss 60 % der ausgestrahlten Musik französisch sein5. Auch für Fernseh- und Kinoprogramm gelten entspreche Regeln. Frankreich hat angemessene Maßnahmen zur Wahrung seiner nationalen Identität ergriffen.
3. Der wichtigste Punkt bei den Chancen des Begriffs „Leitkultur“ ist jedoch, dass man mit der Auslegung des Begriffes als „kultureller Hausordnung“6 das deutsche Verständnis für die Grundlagen unseres Staates verbessern kann. Eine
„Hausordnung“ wäre nach den Grundsätzen aufgebaut, die das Grundgesetz der
Bundesrepublik Deutschland seit nunmehr 52 Jahren als absolut vorschreibt:
Nämlich die Unantastbarkeit der Menschenwürde ( Art. 1 Abs. 1), die freie
Entfaltung der Persönlichkeit jedes Einzelnen, solange sie nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt (Art. 2 Abs. 1), die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die bekanntlich in anderen Kulturkreisen alles andere als selbstverständlich gilt (Art. 3 Abs. 2) und vor allem die Religionsfreiheit und deren ungestörte Ausübung (Art. 4 Abs. 1 und 2)7. Da viele
Bundesbürger sich über den genauen Inhalt des Grundgesetzes im Unklaren sind, wäre eine einheitlich anerkannte und respektierte Leitkultur oder eben „kulturelle Hausordnung“ eine große Chance jedem Individuum die Grundprinzipien unserer Gesellschaft, die es mehr als alles andere zu wahren gilt, besser verständlich zu machen und jedem die Chance zu eröffnen sich diese in praktische Form anzueignen.
Beispielsweise wären die kleinkarierten Debatten um die Errichtung einer Moschee mit Minarett vor einigen Jahren in der bayerischen Kleinstadt Dillingen, das Kruzifix-Urteil oder der Streit darüber, ob eine islamische Lehrerin ein Kopftuch tragen darf, nicht relevant, wäre eine einheitliche Leitkultur unter den oben angegebenen Grundsätzen fundamentaler Bestandteil unserer Gesellschaft. Eine „kulturelle Hausordnung“ ist deswegen erforderlich.
II. Zweifelsohne kann die Verwendung des Begriffs „deutsche Leitkultur“ Vorteile mit sich bringen. Es dürfte jedoch ebenso unbestreitbar sein, dass der Begriff auch Risiken in sich birgt, besonders wenn man die deutsche Geschichte bedenkt.
1. Ein wesentlicher Punkt, weshalb eine Verwendung des Begriffes „deutsche Leitkultur“ risikoreich erscheint, ist, weil unter anderem aufgrund der politischen Konsolidierung der Bundesrepublik Deutschland keine einheitliche Leitkultur existiert. Im Gegensatz zu zentralistischen Ländern liegt in der BRD die Gestaltung des kulturellen Lebens bei den Ländern, es gibt kein Bundesministerium für Kultur, es gibt stattdessen 16 verschiedene Kultusministerien. Alleine deswegen wäre aufgrund unterschiedlicher politischer Ideologien in den einzelnen Länderregierungen eine Durchsetzung einer einheitlichen „deutschen Leitkultur“ schwierig bis nahezu unmöglich, berücksichtigt man wie selten Union und Sozialdemokraten zu Konsens neigen.
Ein simples Beispiel dafür ist, dass sich ein Lehrer in der Regel nur innerhalb seines Bundeslandes versetzen lassen kann. Auch die Tatsache, dass die Gestaltungen der Lehrpläne sich größtenteils voneinander unterscheiden; so wurde in einigen der neuen Bundesländern der Religionsunterricht als Pflichtfach abgeschafft, da aufgrund der atheistischen Politik des ehemaligen SED-Regimes nur eine Minderheit der Jugendlichen getauft ist, in Bayern wäre dies aufgrund der starken christlichen Orientierung der Landesregierung völlig undenkbar. Auch gibt es in vielen anderenLändern noch Samstagsunterricht, in Bayern und Baden-Württemberg beispielsweise nicht.
Gerade aufgrund dieser parteiideologischen Differenzen dürfte sich die Ausarbeitung und Umsetzung einer einheitlichen Leitkultur, die für ganz Deutschland gilt, als nahezu unmöglich herausstellen; besonders da die SPD mehrheitlich sogar die Verwendung des Begriffes ablehnt.
2. Ein viel wesentlicherer Punkt ist jedoch, weil er auch den Fortbestand unserer Wohlstandsgesellschaft betrifft die Tatsache, dass die demographische Entwicklung in Deutschland eine verstärkte Zuwanderung, insbesondere von Fachkräften, unverzichtbar macht, und Zuwanderer sich hier auch wohl fühlen müssen. Laut Statistik sorgen heute 35 Millionen Berufstätige für die Bedürfnisse von 80 Millionen Einwohnern8. Würde die Zuwanderung ausbleiben, fehlen im Jahre 2030
12 Millionen Erwerbstätige. Eine Finanzierung der Renten sowie anderer sozialer Systeme in unseren Sozialstaat wird somit extrem schwierig. Eine weitere Zuwanderung ist unverzichtbar, was inzwischen auch von der konservativen Seite eingestanden wird. Viele Betriebe suchen bereits heute händeringend nach Fachkräften, vor allem im EDV-Bereich. Die Greencard ist ein wichtiges Beispiel hierfür. Deutschland muss jedoch dafür sorgen, dass Ausländer auch gerne nach Deutschland kommen, da insbesondere qualifizierte Fachkräfte genug Alternativen haben (z.B. USA, Australien, Kanada oder Neuseeland). Da Deutschland im Bereich der Fachkräfte international zum Bittsteller geworden ist, ist es dringend nötig, hier eine einladende Gesellschaft zu schaffen; die bloße Verwendung des Begriffes ohne inhaltliche Auffüllung von Toleranz lässt Deutschland nicht einladend erscheinen.
3. Der wichtigste Punkt jedoch, den auch Linke und Liberale in Deutschland immer wieder als Angriffspunkt nehmen ist die Tatsache, dass der Begriff „deutsche Leitkultur“ an sich etwas Fremdenfeindliches hat, eine „Forderung nach Assimilation, Unterordnung und Ausgrenzung“9. Die offizielle Erklärung der CSU zum Thema „Zuwanderung“ verlangt ja eine deutsche Leitkultur „auf Grundlage europäisch-abendländischer Werte mit den Wurzeln Christentum, Aufklärung und Humanismus.“ Von Toleranz gegenüber Werten, Religionen und Weltanschauungen anderer Kulturen stand jedoch nichts im am vergangenen Montag veröffentlichten sechsseitigen CSU-Papier4. Dies hätte weitreichende Folgen, auch im Bereich der Schulen. Laut CSU könnten Schüler anderer Konfessionen gezwungen werden am (christlichen) Religionsunterricht teilzunehmen, dieser wäre ja fundamentaler Bestandteil der Leitkultur.
Auch in anderen Europäischen Staaten sind Debatten über Leitkulturen nicht fremd. Großbritannien beispielsweise berief eine „Kommission zur Zukunft des multikulturellen Britanniens“ ein.10 Diese kam zu dem Schluss, dass in Anbetracht des ehemaligen Britischen Weltreichs, das Wort „britisch“ einen rassistischen Unterton habe und nicht geeignet sei, die multikulturelle Vielfalt der Bevölkerung zu repräsentieren, da Millionen von Einwohnern des Vereinigten Königreichs ihre Identität nicht als Briten sehen. Die Kommission schlug vor, die Gesellschaft offiziell als „multikulturell“ zu definieren, auch wenn das beinhaltet, dass Großbritanniens „Geschichte korrigiert, neu überdacht und wenn nötig über Bord geworfen werden muss“.
Auch wenn Deutschland keine imperiale Vergangenheit wie Großbritannien hat, dürfte ein Ausländeranteil von 8,9%11 (dem drittgrößten in Europa) eindeutig bedeuten, dass längst nicht alle Einwohner ihre Identität als Deutsche bezeichnen. Eben aus diesem Grund ist die Forderung nach einer so enggefassten „deutschen Leitkultur“ intolerant und ausländerfeindlich.
III. Die zunehmende Anzahl an Neonazis, die CSU-Unterschriftensammlung gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, „Kinder statt Inder“, Nationalstolz und Leitkultur - Deutschland ist auf dem besten Weg, sich einen Ruf als ausländerfeindliches Land zu erarbeiten. Natürlich gibt es in jeder Gesellschaft der Erde gewisse Regeln, Sitten und Normen, nach denen sich alle zu richten haben; ohne diese wäre ein Zusammenleben von 82 Millionen Menschen unmöglich. Jedoch muss in jeder Gesellschaft Platz für die wichtigsten Werte der Menschheit sein; insbesondere Toleranz. Eine alle verbindende „Leitkultur“ ist nötig, jedoch muss in ihr Platz für eben diese Toleranz sein, die soweit gehen soll, wie es die Gesetze und das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland erlauben. Ausländer, die wir dringend brauchen müssen das Gefühl haben, willkommen zu sein, müssen ihr Leben leben können, ohne Angst haben zu müssen, ausgegrenzt oder sogar von Rechtsextremisten zu Tode gehetzt zu werden. Der Begriff „Leitkultur“ wird zwar aufgrund seiner Vieldeutigkeit ein Streitpunkt bleiben, alternative Bezeichnungen für die uns alle verbindenden Lebensäußerungen wären wohl von Vorteil („Leitkultur in Deutschland“, welche unter Mitwirkung von anderen Kulturen der Bevölkerung in Deutschland zustande kommt, anstatt lediglich „deutscher Leitkultur“). Das Grundprinzip einer Gesellschaft, in der niemand ausgegrenzt wird, wo jeder seinen Platz finden kann, welche Weltanschauung er auch immer hat, ist jedoch für das allgemeine Wohl unabdingbar. Die CSU-Definition einer „deutschen Leitkultur“, mit Aufklärung, Humanismus und Christentum als absolute Schwerpunkte, birgt jedoch zu große Risiken von Abgrenzungen gegenüber Angehörigen anderer Kulturkreise in sich.
C) „When in Rome, do as the Romans do.“ Dieses englische Sprichwort drückt eine
Binsenweisheit aus, nämlich dass jemand der in ein anderes Land kommt sich den einheimischen Bräuchen anzupassen hat. Doch wie aktuell ist dieses Sprichwort heute? Gewissen Dingen sollte man sich sicher anpassen, z. B. gegebenenfalls die Sprache lernen. Doch Zuwanderern die Beibehaltung bestimmter kultureller Eigenarten zu verweigern wäre nicht nur unmoralisch sondern auch verfassungswidrig. Da sich in der Debatte um die „deutsche Leitkultur“ auch die Frage stellte, was denn noch „typisch deutsch“ wäre, lässt sich wohl sagen: Diese Diskussion um Dinge, die größtenteils schon vor einem halben Jahrhundert niedergeschrieben und legitimiert wurden, die dem sprichwörtlichen Reden um den heißen Brei sehr nahe kommt, ist wohl wirklich „typisch deutsch“. Wenn unsere „deutsche Leitkultur“ von solchen Dingen geprägt sein soll - dann Gute Nacht! Wenn jedoch die Leitkultur in Deutschland inhaltlich so aufgefüllt wird, dass auch Angehörige anderer Völker hier eine Basis sehen, eine Gesellschaft in der man leben kann, ohne befürchten zu müssen, ausgegrenzt zu werden, könnte dieser Begriff durchaus eine Zukunft haben. Ob die „Leitkultur“ zustande kommen und wie genau diese eines Tages aussehen wird, wird nur die Zeit zeigen.
Sekundärliteratur:
Schepp, Matthias: „Es lebe der Bastard“. In: Stern, Nr. 18; 26.04.2001; S. 40 - 46
Lambertz, Doris: Leserbrief zum Thema „Leitkultur“. In: Spiegel, Nr. 46; 13.11.2001, S. 14
Brawanski, Hubert: Leserbrief zum Thema „Leitkultur“. In: Spiegel, Nr. 46; 13.11.2001, S. 14
Bebber, Hendrik: Leitkultur - so diskutiert das Ausland: Cool Tour.
http://195.170.124.152/archiv/2000/11/01/ak-po-au-10039.html
Interview mit Claudia Roth, MdB: Roth: CSU verabschiedet sich von Lebenslüge. In: Süddeutsche Zeitung, Nr. 95; 25.04.2001, S. ??
Merz, Friedrich, MdB: Deutschland ist ein weltoffenes und ausländerfreundliches Land. Ist:
http://www.netpolicy.de/europa/merka.htm
Merkel, Angela, MdB: Leitkultur ist eine Chance. Ist:
http://www.netpolicy.de/europa/merka.htm
Heise, Sebastian: Für die CSU liegt eine Einigung über Einwanderung noch in weiter Ferne. In: Donaukurier, Nr. 94; 24.04.2001; S. 2.
Schoeps, H. Julius: Was meinte Merz? Ist:
http://www.zeit.de/daten/2000/10/26/1026fo198662.htx
Autor: unbekannt. Ausländer sollen sich „deutscher Leitkultur“ anpassen. Ist: http://www.n- tv.de/cgi-bin/show_doc.cgi?doc_id=701453&tpl_id=n_innen
Harenberg, Bodo (Hg.): Aktuell 2001; Harenberg; Dortmund; 2000;
Korte, Torben: Was ist Leitkultur? Ist: http://www.was-ist-leitkultur.de/wasistleitkultur.htm
Thierse, Wolfgang, MdB: Deutschland muss seine Tradition der kulturellen Integration fortsetzen. Ist: http://www.welt.de/daten/2000/12/30/1230hb212380.htx
Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (Hg.): Verfassung des Freistaates Bayern; Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
Bedürftig, Friedemann (hg.): Die aktuelle deutsche Rechtschreibung von A-Z; Naumann & Göbel; Köln; 1999
LAssin Susanne Jostarndt StRef Martin Haselsteiner
[...]
1 Quelle: Die aktuelle deutsche Rechtschreibung, Naumann und Göbel
2 Quelle: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,99296,00.html
3 http://www.netpolicy.de/europa/merka.htm
4 Donaukurier, Nr. 94; 24.04.2001; S. 2
5 Quelle: LAssin Susanne Jostarndt
6 Quelle: Spiegel Nr. 46, 13.12.2000
7 Quelle: Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit 5
8 Vgl.: Stern Nr. 18
9 Claudia Roth, Parteichefin der Grünen, Süddeutsche Zeitung, 25.04.2001 7
4 a. a. O.
10 Quelle: Hedrik Bebber, Leitkultur - so diskutiert das Ausland: Cool Tour http://195.170.124.152/archiv/2000/11/01/ak-po-au-10039.html
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Ausgangspunkt der Leitkulturdebatte laut diesem Text?
Der Text beginnt mit der Äußerung von Friedrich Merz im Deutschen Bundestag am 18. Oktober 2000, dass Zuwanderer sich einer "deutschen Leitkultur anpassen" müssten. Diese Aussage löste eine politische Debatte aus.
Wie definiert der Text "Leitkultur"?
Der Text analysiert den Begriff "Leitkultur", indem er die Wörter "leiten" (führen, lenken, vorstehen) und "Kultur" (die gesamten Lebensäußerungen eines Volkes) separat definiert. "Deutsche Leitkultur" würde demnach bedeuten, dass das kulturelle Leben in Deutschland von deutschen Werten bestimmt und dominiert wird.
Welche Chancen sieht der Text in einer Leitkultur?
Der Text sieht folgende Chancen:
- Bedürfnis nach Identifikation: Eine Leitkultur kann ein Fundament für jeden Einwohner sein, um sich mit der Kultur zu identifizieren.
- Verhinderung von Überwucherung: Sie kann die deutsche Sprache und Kultur vor Anglizismen und ausländischen Lebensarten schützen.
- "Kulturelle Hausordnung": Sie kann das Verständnis für die Grundlagen des Staates (Grundgesetz) verbessern, insbesondere in Bezug auf Menschenwürde, freie Entfaltung der Persönlichkeit, Gleichberechtigung und Religionsfreiheit.
Welche Risiken sieht der Text in einer Leitkultur?
Der Text sieht folgende Risiken:
- Politische Konsolidierung: Die politische Struktur der BRD erschwert die Etablierung einer einheitlichen Leitkultur, da die kulturelle Gestaltung hauptsächlich bei den einzelnen Bundesländern liegt.
- Abschreckung von Zuwanderern: Der Begriff "deutsche Leitkultur" könnte Zuwanderer abschrecken, die sich hier wohlfühlen sollen.
- Forderung nach Assimilation: Der Begriff könnte als eine Forderung nach Assimilation, Unterordnung und Ausgrenzung wahrgenommen werden.
Welche Rolle spielt Zuwanderung in der Debatte?
Der Text betont, dass Deutschland aufgrund der demographischen Entwicklung auf Zuwanderung angewiesen ist, insbesondere von Fachkräften. Eine "Leitkultur", die intolerant wirkt, könnte potentielle Zuwanderer abschrecken.
Wie bewertet der Text die Definition der CSU zur "deutschen Leitkultur"?
Der Text kritisiert die CSU-Definition, die auf europäisch-abendländischen Werten mit den Wurzeln Christentum, Aufklärung und Humanismus basiert, da sie zu große Risiken von Abgrenzungen gegenüber Angehörigen anderer Kulturkreise birgt.
Was schlägt der Text als Alternative zur "deutschen Leitkultur" vor?
Der Text schlägt alternative Bezeichnungen wie "Leitkultur in Deutschland" vor, die unter Mitwirkung von anderen Kulturen der Bevölkerung zustande kommt, um eine inklusivere Gesellschaft zu fördern.
Wie bewertet der Text die "typisch deutsche" Leitkulturdebatte?
Der Text sieht die Diskussion um die "deutsche Leitkultur" als "typisch deutsch" an, da sie sich um Dinge dreht, die größtenteils schon vor einem halben Jahrhundert niedergeschrieben und legitimiert wurden, und dem Reden um den heißen Brei sehr nahe kommt.
- Quote paper
- Dominic Dauphin (Author), 2001, Leitkultur - Chancen und Risiken des Begriffs Leitkultur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103345