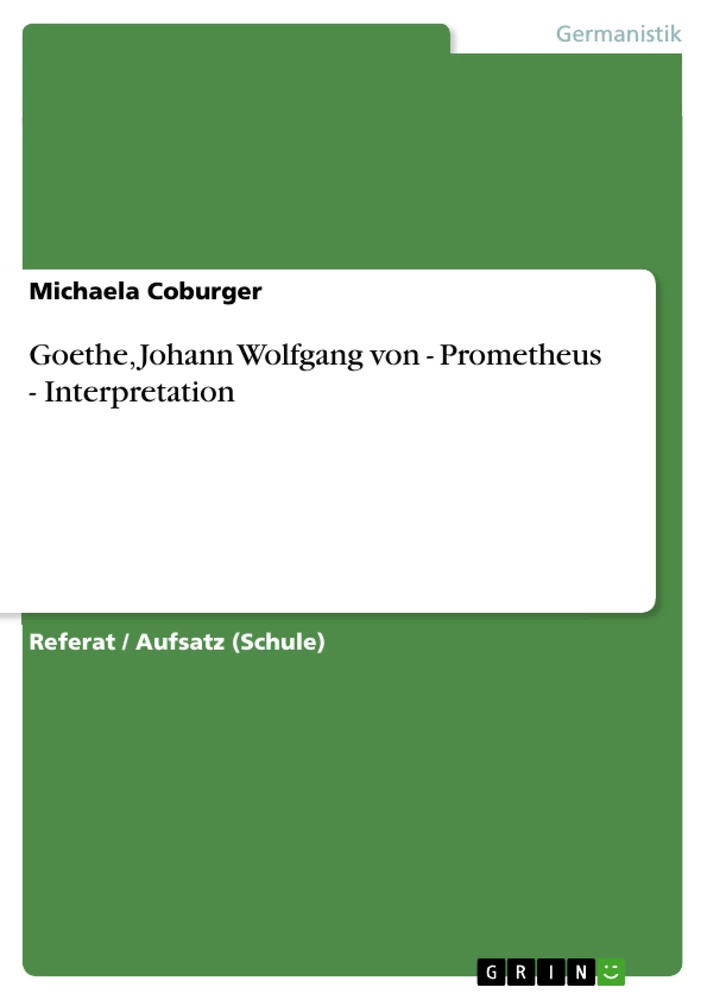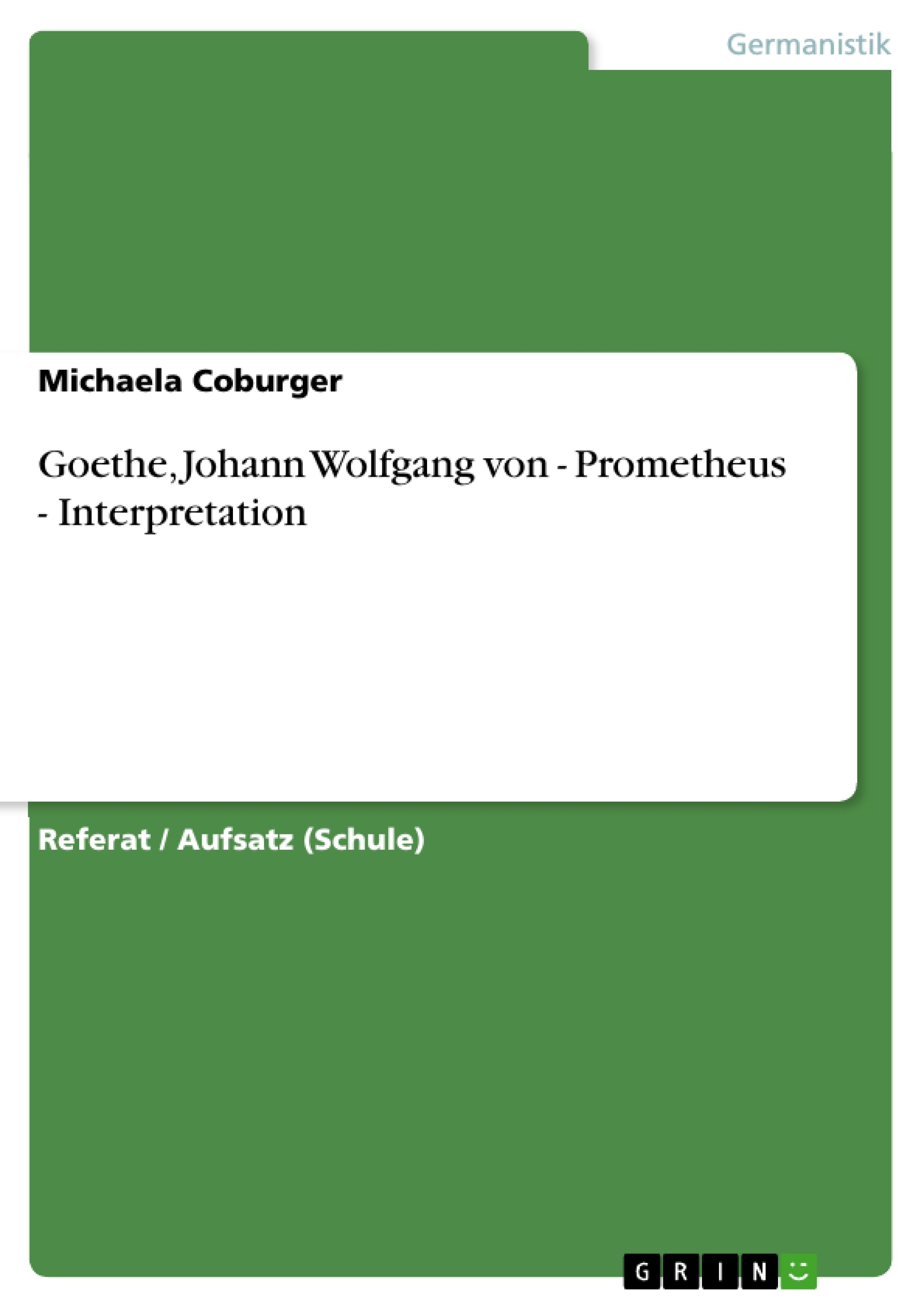Stell dir vor, du stehst am Abgrund der Rebellion, die Faust geballt gegen den Olymp: Genau das ist der Geist, der Goethes "Prometheus" durchdringt. Diese Hymne, ein leidenschaftlicher Aufschrei des Sturm und Drang, ist weit mehr als eine Nacherzählung der griechischen Sage. Sie ist eine explosive Auseinandersetzung mit Autorität, eine Hymne an die Selbstermächtigung des Menschen und eine glühende Verurteilung göttlicher Willkür. Goethe entfesselt hier einen Prometheus, der Zeus und seinen Götterkollegen die Stirn bietet, ihre vermeintliche Macht in Frage stellt und sich selbst zum Schöpfer seiner eigenen Werte erklärt. Der Leser wird Zeuge, wie Prometheus, voller Verachtung für die olympischen Götter, die Menschheit aus dem Dunkel führt und ihr das Feuer des Wissens und der Erkenntnis bringt. Doch dieser Akt des Trotzes hat seinen Preis: Prometheus muss die Konsequenzen seines Handelns tragen. Die Hymne erforscht aufwühlende Themen wie den Konflikt zwischen Individuum und Gesellschaft, die Bedeutung von Freiheit und Autonomie sowie die unaufhaltsame Kraft des menschlichen Geistes. Entdecke, wie Goethe die antike Mythologie nutzt, um eine zeitlose Botschaft der Selbstbestimmung und des Widerstands zu vermitteln. Lass dich von der Wucht der Sprache und der revolutionären Kraft dieser Verse mitreißen und stelle dich der Frage: Wer bestimmt dein Schicksal – die Götter oder du selbst? Ein Schlüsselwerk des Sturm und Drang, das bis heute nichts von seiner Brisanz verloren hat, eine kraftvolle Erkundung von Trotz, Schöpferkraft und der unbezwingbaren Sehnsucht nach Freiheit und Selbstverwirklichung, verpackt in eine sprachgewaltige Auseinandersetzung mit der griechischen Götterwelt und deren vermeintlicher Allmacht. Tauche ein in eine Welt, in der der Mensch sich gegen die Götter erhebt und seine eigene Bestimmung in die Hand nimmt. Erlebe die Geburt eines modernen Helden, der für seine Überzeugungen kämpft und die Grenzen des Möglichen neu definiert. Ein Muss für alle, die sich für klassische Literatur, Mythologie und die großen Fragen der Menschheit interessieren.
Interpretation
Goethe: Prometheus
Goethe beschreibt in seiner 1774 verfaßten Hymne "Prometheus" dessen Auffassung gegenüber den Göttern, vor allem gegenüber Zeus. Da die Hymne ohne konkrete Form und Reime geschrieben ist, wähle ich die chrono- logische Interpretation.
Die erste Strophe ist sehr wichtig für das allgemeine Verständnis, da in dieser Strophe deutlich wird, wen Prome- theus ansprechen will, und zwar hauptsächlich Zeus, den griechischen Göttervater. Prometheus spricht Zeus mit "du" an und fordert ihn in den ersten vier Zeilen durch Verben im Imperativ auf, zu verschwinden und wie ein klei- ner Junge zu spielen und alles kaputt zu machen. Diese Zeilen spiegeln die Haltung Prometheus' zu Zeus wider undman liest deutlich die Mißachtung diesem gegenüber heraus. Die zweite Hälfte beschreibt, wie stolz Prometheus auf sich selbst und auf das ist, was er erschaffen hat. Ironisch sagt er, Zeus dürfe sein Werk nicht zerstören. Er müsse die Meschen und ihre Heimat, ausgedrückt durch das Hüttenmotiv (die Verengung Erde-Hütte-Herd-Glut), in Ruhe und ihnen das Feuer lassen, um welches er sie beneidet. In dieser Strophe häufen sich die Substantive, die ersten beiden deuten auf Zeus' Welt hin, die nächsten vier unterstreichen die Verachtung Zeus gegenüber und die letzten vier beschreiben die Heimat der Menschen, was noch verstärkt wird durch die Verengung, weil Prome- theus stolz darauf ist, daß er die Menschen erschaffen hat. Die beiden "und" anden Anfängen der Zeilen acht und zehn wirken so auf mich, daß Prometheus zeigen will, wieviel er geschaffen hat. In dieser Strophe tauchen mehrere Alliterationen auf, zum Beispiel: "Mußt mir meine ..." (I/6) oder "Die du ..." (I/9), die verstärken, auf welche Per- son man sich in den jeweiligen Zeilen konzentrieren soll oder um einen Besitz anzuzeigen. Der Satzbau des dritten Satzes, der sich über die Zeilen sechs bis zwölf erstreckt, ist elliptisch, da das Subjekt in diesem Satz fehlt. Diese Strophe beinhaltet auch Zeilenenjambements, wie zum Beispiel von Zeile fünf zu sechs. In der Zweiten Strophe wendet sich Prometheus an alle Götter. Er beschreibt auch ihre Heimat, Himmel, Wolken- dunst, Sonne, aber nicht so ausführlich wie die Heimat der Menschen. Das ist so zu verstehen, daß für die Men- schen für Prometheus wichtiger sind als die Götter. Er kritisiert die Götter und ihre Lebensweise, was durch "Ich kenne nichts Ärmer's" (II/1) und "Ihr nähret euch kümmerlich" (II/3) hervorgehoben wird. Prometheus begründet die Kritik damit, daß die Götter sich an Opfergaben der Menschen nähren und daß sie ohne die Bettler und Kinder, die an sie glauben, verelenden würden.Goethe ließ Prometheus diese Kinder und Bettler als Dummköpfe bezeich- nen, da er selbst in der Zeit, als er "Prometheus" schrieb, nicht an Gott und daran geglaubt hat, daß er das Schick- sal der Menschen beeinflussen könne. Die zweite Strophe ist um drei Zeilen kürzer als die erste und auch die Verse sind nicht annähernd so lang wie die der ersten Strophe.Zeilensprünge sind in dieser Strophe oft zu finden, da Goe- the einen Satz auf sieben Zeilen verteilte (II/3-9).
Die dritte Strophe ist eine Art Rückbesinnung Prometheus'. Sie paßt inhaltlich nicht ganz zu den ersten beiden Strophen, mit denen sie zusammen den anklagenden, aggressiven Teil bildeten. In seiner Kindheit glaubte Prome- theus an die Götter,er hoffte auf sie und suchte jemanden, der ihm hilft und ihn tröstet. Diesen Irrtum begangen zu haben, begründet er damit, ein Kind gewesen zu sein. Da diese Strophe eine Erinnerung an seine Kindheit ist, ste- hen die Verben im Präteritum. Die Anapher "Ein - Ein" (III/5+6) verstärkt die Erwartung, die er als Kind an die Götter hatte.
Die vierte Strophe besteht aus rhetorischen, vorwurfsvollen Fragen, deren Antwort schon bei der ersten Frage klar ist. Nicht die Götter halfen Prometheus, sondern er half sich selbst. Er bezeichnet die Götter als die "Schlafenden dadroben" (IV/ 9), da es ihnen seiner Meinung nach egal ist, was mit den Menschen passiert. Die ersten beiden Fragen stehen im Präteritum, da Prometheus fragt, w er früher geholfen hat, als er noch an die Götter glaubte. Weil sie ihm nicht geholfen haben, gimg ihm ein Licht auf und er merkte, daß er den Göttern egal ist. Die vierte Strophe ist im Verhältnis zu den anderen Strophen eine der längsten, aber die Satzform hat sich von Ausrufesätzen zu Fra- gesätzen geändert.
Die fünfte und sechste Strophe möchte ich zusammenfassen, da sie inhaltlich zusammengehören. Die erste Zeile der fünften Strophe besteht aus zwei Ellipsen, die zweite ist zusätzlich eine rhetorische Frage. Der elliptische Satz- bau unterstreicht Prometheus' Zorn. Der Inhalt der Fragestellung wird durch die indirekte Antwort in der Frage selbst gesteigert. Prometheus sieht das Schicksal als Oberstes an, denn er glaubt nicht mehr an die Götter. Diese
Strophe ist an Zeus gerichtet, das wird deutlich in den aufbegehrenden Fragen (V/1), auf die er keine Antwort er- wartet, da er sie selbst im zweiten Teil der Strophe gibt. "Die allmächtige Zeit" (V/7) beziehungsweise das Leben hat ihn zu dem gemacht, was er ist. Das ist gleichzeitig ein Grundgedanke des Sturm und Drang.
In der sechsten Strophe fragt sich Prometheus, warum er sich unterdrücken lassen sollte, Menschen haben auch Träume, Wünsche, Sehnsüchte und er akzeptiert es, daß nicht alle in Erfüllung gehen, ohne aufzugeben. Vom Auf- bau her ist die sechste Strophe die kürzeste, für mich ist sie eine Art Zusammenfassung des zweiten Abschnittes, der aus vorwurfsvollen, aufbegehrenden Fragen besteht.
Die siebente Strophe ist eine trotzige Schlußfolgerung, die Prometheus für sich selbst zieht. Prometheus formt Men- schen nach seinem Bilde, die "leiden, weinen, genießen, sich freuen" (VII/4+5), was auch dem Grundgedanken des Sturm und Drang entspricht. Die von ihm geformten Menschen sollen Zeus genausowenig achten, wie er selbst. Mit "formen" meint Prometheus, daß er den Menschen zeigt, wie sie leben und wie sie ihr Leben verbessern könnten. Die gesamte Strophe steht im Präsens, da sie ein Ergebnis der ganzen Hymne darstellt und beschreibt, was jetzt bezieungsweise damals geschehen ist.
Goethe schrieb die Hymne mit fünfundzwanzig Jahren in einer Phase, in der er sich sehr mit der griechischen My - thologie beschäftigte. Das belegen auch andere Werke, zum Beispiel "Ganymed". Er arbeitete in Wetzlar als Refe- rendar am Reichskammergericht, als er Prometheus schrieb. Zu der Zeit arbeitete er auch an dem Briefroman "Die Leiden des jungen Werthers". Goethe vertritt in der Hymne "Prometheus" Großen und Ganzen die Gedanken des Sturm und Drang. Mir persönlich gefällt diese Hymne sehr gut, da sie durch die fehlenden Reime sehr verständlich ist.
Häufig gestellte Fragen zu Goethes "Prometheus"
Was ist das Hauptthema von Goethes Hymne "Prometheus"?
Die Hymne "Prometheus" von Goethe aus dem Jahr 1774 thematisiert die Auffassung des Prometheus gegenüber den Göttern, insbesondere gegenüber Zeus. Es geht um Prometheus' Stolz auf seine eigenen Schöpfungen, seine Verachtung gegenüber Zeus und seine Kritik an der Lebensweise der Götter. Zentral ist auch die Selbstermächtigung des Menschen und die Ablehnung göttlicher Hilfe.
Wie interpretiert der Text die erste Strophe der Hymne?
Die erste Strophe wird als eine direkte Anrede an Zeus interpretiert, in der Prometheus seine Missachtung und seinen Stolz auf seine eigenen Werke zum Ausdruck bringt. Er fordert Zeus auf, zu verschwinden und sein Werk nicht zu zerstören, insbesondere die Heimat der Menschen mit dem Feuer.
Welche Kritik übt Prometheus an den Göttern in der zweiten Strophe?
Prometheus kritisiert die Götter für ihre Abhängigkeit von den Opfergaben der Menschen und ihre vermeintliche Armut ohne die Gläubigen. Er stellt ihre Lebensweise als kümmerlich und unbedeutend dar.
Wie wird die dritte Strophe im Kontext der gesamten Hymne gesehen?
Die dritte Strophe wird als eine Rückbesinnung auf Prometheus' Kindheit interpretiert, in der er noch an die Götter glaubte. Sie bildet einen Kontrast zu den aggressiven und anklagenden Strophen davor.
Was wird in der vierten Strophe thematisiert?
Die vierte Strophe besteht aus rhetorischen Fragen, die den Vorwurf erheben, dass die Götter Prometheus nicht geholfen haben. Er betont, dass er sich selbst geholfen hat und bezeichnet die Götter als "Schlafende dadroben".
Wie werden die fünfte und sechste Strophe zusammenfassend betrachtet?
Die fünfte und sechste Strophe werden als inhaltlich zusammengehörig interpretiert. Prometheus sieht das Schicksal als Oberstes an und lehnt sich gegen die Götter auf. Er fragt sich, warum er sich unterdrücken lassen sollte, da Menschen Träume und Sehnsüchte haben.
Was ist die Aussage der siebten Strophe?
Die siebte Strophe ist eine trotzige Schlussfolgerung, in der Prometheus erklärt, dass er Menschen nach seinem Bilde formt, die leiden, weinen, genießen und sich freuen können. Diese Menschen sollen Zeus genauso wenig achten wie er selbst.
In welcher Phase von Goethes Leben entstand die Hymne "Prometheus"?
Goethe schrieb die Hymne im Alter von fünfundzwanzig Jahren, in einer Phase, in der er sich intensiv mit der griechischen Mythologie beschäftigte. Zu dieser Zeit arbeitete er auch am Briefroman "Die Leiden des jungen Werthers".
Welche literarische Strömung wird in der Hymne "Prometheus" repräsentiert?
Goethe vertritt in der Hymne "Prometheus" im Großen und Ganzen die Gedanken des Sturm und Drang.
- Quote paper
- Michaela Coburger (Author), 1999, Goethe, Johann Wolfgang von - Prometheus - Interpretation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103342