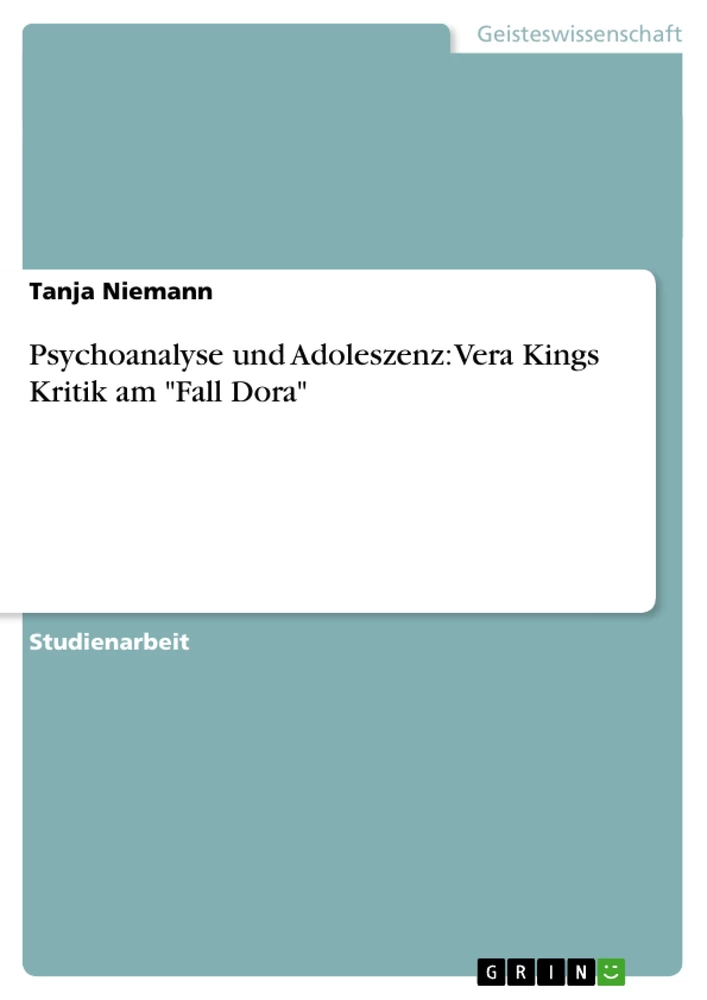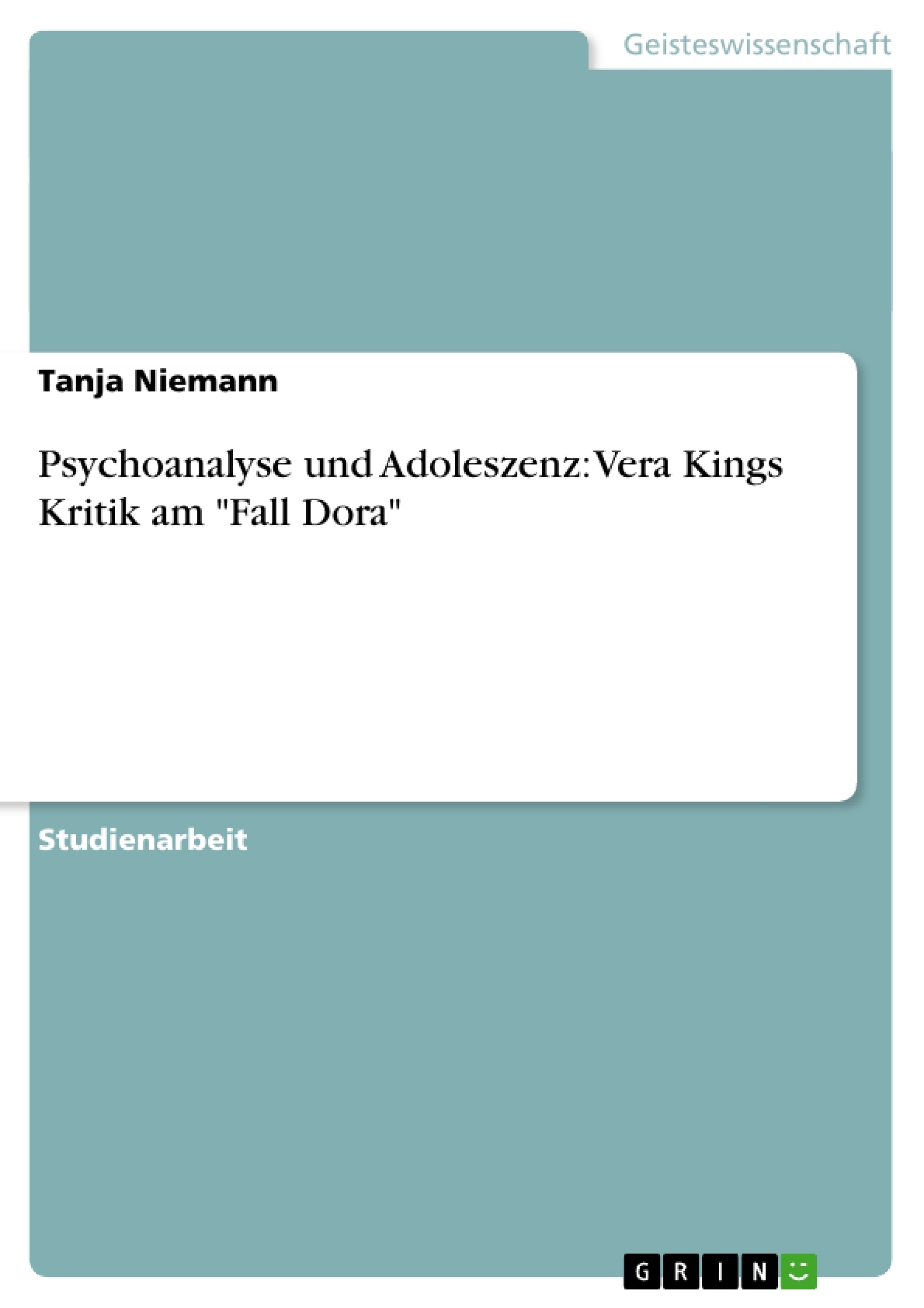Was geschah wirklich in Freuds berühmtester, aber auch umstrittenster Fallanalyse? Tauchen Sie ein in die Welt der jungen Dora, deren Hysterie mehr verbarg, als Freud zu erkennen vermochte. Diese tiefgreifende Analyse seziert nicht nur Doras komplexe Familiengeschichte und ihre quälenden Symptome – von Atemnot bis hin zu rätselhaften Ohnmachtsanfällen –, sondern enthüllt auch die Grenzen der frühen psychoanalytischen Theorie. Im Wien des frühen 20. Jahrhunderts, inmitten von Geheimnissen, Verlangen und gesellschaftlichen Zwängen, kämpft Dora um ihre Identität und Autonomie. War sie wirklich in Herrn K. verliebt, wie Freud beharrlich annahm, oder suchte sie nach etwas ganz anderem? Entdecken Sie, wie Vera Kings kritische Neubetrachtung die Fallgeschichte in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt. Es geht um weit mehr als nur um verdrängte sexuelle Wünsche; es geht um die Suche nach weiblicher Identifikation, die Auseinandersetzung mit der Mutterrolle und die verzweifelte Suche nach einem Ausweg aus einem Netz dysfunktionaler Beziehungen. Doras Konflikte werden im Kontext ihrer Adoleszenz betrachtet, einer Lebensphase, deren spezifische Herausforderungen Freud weitgehend übersah. Die Analyse beleuchtet, wie Doras Vorstellung einer destruktiven "Urszene" – die Fantasie des elterlichen Geschlechtsakts – ihre Beziehungen und ihr Selbstbild prägte. War Dora wirklich eine unwillige Patientin, die Freuds Deutungen ablehnte, oder versuchte sie, ihm etwas Wesentliches mitzuteilen? Erfahren Sie, wie die Übertragungs- und Gegenübertragungsdynamik zwischen Dora und Freud die Therapie sabotierte und welche ungenutzten Chancen in diesem brisanten psychoanalytischen Setting verborgen lagen. Diese Neubetrachtung ist nicht nur eine faszinierende Reise in die Frühzeit der Psychoanalyse, sondern auch eine bewegende Erkundung der weiblichen Psyche und des Kampfes um Selbstfindung. Sie fordert uns heraus, unsere eigenen Vorurteile und blinden Flecken zu hinterfragen und Dora mit neuen Augen zu sehen – als eine komplexe, intelligente und widerstandsfähige junge Frau, die ihrer Zeit weit voraus war. Schlüsselwörter: Dora, Freud, Hysterie, Psychoanalyse, Adoleszenz, Übertragung, Gegenübertragung, Vera King, Fallanalyse, Sexualität, Weiblichkeit, Identität, Urszene, Traumdeutung, Wien, Jahrhundertwende, Geschlechterverhältnis, Familiengeheimnisse, Selbstfindung, Kritik, Therapie, Widerstand, Subjektivität, Autonomie. Die Geschichte einer jungen Frau, die sich den Erwartungen ihrer Zeit widersetzte und einen bleibenden Eindruck in der Geschichte der Psychoanalyse hinterließ.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1.Nachzeichnung der Fallgeschichte
1.1 Doras soziales Umfeld
1.2 Doras Krankheitsbild
1.3 Freuds Interpretation
2. Dora- eine Adoleszente
2.1 Kritik an der Fallgeschichte
2.1.1 Doras Vorstellung einer destruktiven Urszene
2.1.2 Doras Suche nach weiblicher Identifikation Dora und die Mutter; Dora und Frau K
2.1.3 Übertragung und Gegenübertragung in der
Analyse
Einleitung
In der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, Vera Kings Kritik und Interpretation der von Freud publizierten Fallgeschichte ‘Dora’ aus ihrem Buch ‘Die Urszene der Psychoanalyse’1 nachzuzeichnen. Es soll damit nachgewiesen werden, daß es sich bei dem ‘Bruchstück einer Hysterie-Analyse’2 um einen gescheiterten Versuch der Analyse einer jungen Frau handelt. Die Gründe für diese Annahme werden im Zuge dieser Arbeit vorgestellt.
Dazu erscheint es mir notwendig, vorweg einen Überblick der Fallgeschichte zu geben und kurz Freuds Interpretationslinien aufzuzeigen. Anschließend stelle ich Kings adoleszenztheoretisches Konzept vor. Es eröffnet einen Blickwinkel auf die Fallgeschichte, mit dem bereitliegende, aber nicht genutzte Chancen einer Mann-Frau-Beziehung in der Psychoanalyse, unter Berücksichtigung des Geschlechterverhältnisses, entdeckt werden.
Die von Freud nicht verstandenen adoleszenzspezifischen Konflikte Doras, sowie die unverstandene Übertragungsdynamik innerhalb der Fallgeschichte werden von King herausgearbeitet und im folgenden vorgestellt.
1. Nachzeichnung der Fallgeschichte
Das ‘Bruchstück einer Hysterie-Analyse’ entstand im Jahre 1900, wurde allerdings erst 1905 veröffentlicht. Es handelt sich dabei um die Analyse einer jungen Frau, Dora (mit wirklichem Namen Ida Bauer), die von ihrem Vater zu Freud in die Behandlung geschickt wurde, da sie seit ihrer Kindheit an hysterischen Symptomen litt.
Dora war zum Zeitpunkt der Kur, die von September bis Ende Dezember 1900 andauerte, 18 Jahre alt.
1.1 Doras soziales Umfeld
Doras familäre Beziehungen zeichnen sich in der Beschreibung Freuds dadurch aus, daß sie ein unfreundliches Verhältnis zu ihrer Mutter hat und sich ihrem Einfluß völlig entzieht.3 Obwohl die Mutter eine Hauptakteurin in beiden von Freud analysierten Träumen ist, bleibt er eine tiefgreifendere Beschäftigung mit dem Verhältnis zwischen Dora und ihrer Mutter schuldig. (Vera King untersucht dieses Verhältnis anhand der Urszenenphantasie Doras, worauf später noch genauer eingegangen wird.)
Stattdessen konzentriert sich Doras Liebe und Zuneigung auf ihren Vater. Dora hatte schon früh die pflegende Rolle ihres häufig kranken Vaters übernommen, da die Ehe ihrer Eltern durch Entfremdung und Kühle gekennzeichnet war. Vor der Ehe war er an Syphillis erkrankt, was bei seiner Frau zu einem chronischen Vaginalausfluß geführt hat, an dem auch Dora litt.
Das Verhältnis zu ihrem Vater ist dennoch zwiespältig. Dora weiß von seinem geheimen Liebesverhältnis mit Frau K., welche selbst verheiratet ist. Die K.s sind Freunde der Familie und wurden von Dora und ihrem Vater häufig besucht. Dora hatte lange Zeit ein sehr intensives freundschaftliches Verhältnis zu Frau K.: „Wenn Dora bei den K. wohnte, teilte sie das Schlafzimmer mit der Frau; der Mann wurde ausquartiert. Sie war die
Vertraute und Beraterin der Frau in allen Schwierigkeiten ihres ehelichen Lebens gewesen; es gab nichts, worüber sie nicht gesprochen hatten.“4 Dora tolerierte die Liebesbeziehung ihres Vaters bis zu dem Tag, als es zu der entscheidenden Szene am See kam, eine der in Freuds Analyse zentralsten Momente: Herr K. macht Dora bei einem gemeinsamen Spaziergang einen Liebesantrag, den er mit den Worten einleitet: „Sie wissen, ich habe nichts an meiner Frau“. Daraufhin schlägt Dora ihm ins Gesicht und läuft davon. Dora wußte, daß Herr K. mit den gleichen Worten die Gouvernante verführt hatte, sie aber anschließend nicht mehr beachtete. Nachdem Dora die Szene ihrem Vater geschildert hatte, stellte dieser Herrn K. zu Rede, der die Vorkommnisse aber bestritt. Der Vater schenkte ihm Glauben, nicht zuletzt weil Frau K. von Doras Interesse an sexuellen Themen berichtete, was für den Vater belegte, daß Dora sich die Szene nur eingebildet haben konnte.
Dora fühlte sich anschließend von allen Seiten verraten und von ihrem Vater als Tauschobjekt für seine eigenen Interessen, dem unbeschwerten Weiterführen seiner Beziehung zu Frau K., mißbraucht.
Herr K. hat schon länger um die zu diesem Zeitpunkt 17jährige Dora geworben. So hatte sich knapp 3 Jahre zuvor eine ähnliche Szene abgespielt. Herr K. richtete es so ein, daß er und Dora allein in seinem Laden waren, woraufhin er sie an sich zog und gegen ihren Willen küßte. Dora verspürte heftigen Ekel und riß sich los.5
In Doras familären Umfeld ist noch ihr 11/2 Jahre älterer Bruder zu erwähnen, „der ihr in früheren Jahren das Vorbild gewesen, dem ihr Ehrgeiz nachgestrebt hatte“.6 So trieb Dora mit ihrer „intellektuellen Frühreife“ „ernstere Studien“ und besuchte Vorträge für Damen.7
1.2 Doras Krankheitsbild
Doras Krankengeschichte läßt sich bis auf das Alter von 7 oder 8 Jahren zurückverfolgen, als sie, wie Freud durch den ersten Traum interpretiert hat, Bettnässerin war.8 Der Vater weckte Dora zu dieser Zeit jede Nacht, um sie vor dem Bettnässen zu schützen.
Ebenfalls im Alter von etwa 8 Jahren trat nach einer Bergwanderung das erste Mal akute Atemnot auf, welche anfangs auf die mögliche Überanstrengung zurückgeführt wurde. Innerhalb eines halben Jahres verschwand die Dyspnoe unter „der ihr aufgenötigten Ruhe“.9 Durch ihre Kindheit hindurch zogen sich außerdem etliche Kinderinfektionskrankheiten, die sie nach ihrem Bruder jeweils schwerer durchlitt.
Mit 12 Jahren hatte Dora die ersten Anfälle von halbseitiger Migräne und nervösem Husten.
Die Migräne ließ nach einiger Zeit wieder nach, der nervöse Husten allerdings blieb bis zur Behandlung Doras durch Freud in ihrem achtzehnten Lebensjahr vorhanden.10
Das Asthma wurde später noch durch komplette Stimmlosigkeit begleitet. Im Alter von etwa 17 Jahren besteht bei Dora der Verdacht auf Blinddarmentzündung. 9 Monate vorher fand die besagte Szene am See statt, was noch näher erläutert wird, da es für die Analyse Doras Krankheitsbildes von zentraler Bedeutung ist. Ebenfalls 9 Monate nach der Szene am See zog Dora einen Fuß nach, wie nach einer Verstauchung.11 Als weiteres litt Dora wie ihre Mutter an einem Scheidenausfluß, den sie „Katarrh“ nannte, regelmäßigen Menstruationsbeschwerden und Stuhlverstopfung.
Außerdem machte Dora eine Charakterveränderung durch, war verstimmt, klagte über Zerstreutheit und Müdigkeit.
Nach dem Fund eines Briefes, in dem sie Selbstmordgedanken äußert, und dem anschließenden Wortwechsel mit ihrem Vater, wurde sie zum ersten Mal ohnmächtig mit anschließender Amnesie. Der Fund des Briefes war der Auslöser für den Vater, Dora in die Behandlung Freuds zu geben.
1.3 Freuds Interpretation
Die Traumdeutung, welche kurz zuvor von Freud entwickelt wurde, ist das entscheidende Analysemittel im Fall Dora.
Das Verständnis von Übertragung in der Analysesituation und die daraus resultierenden Möglichkeiten für die Psychoanalytische Therapie waren zur Zeit der Behandlung Doras noch nicht ausgereift; Freud bekam erst in der Behandlung Doras eine Ahnung vom Ausmaß der Übertragung.12 Wie sich dieses Unverständnis auf das Verhältnis Freud-Dora auswirkt, findet an anderer Stelle noch nähere Betrachtung.
Aufgrund der Krankheitssymptome diagnostiziert Freud bei Dora eine Zwangsneurose, die Konversionshysterie. Ursache für Neurosen ist laut Freud die „Energie des Sexualtriebes“, der bei NeurotikerInnen eine starke Verdrängung erfährt, so daß „das Sexualleben der betreffenden Personen sich entweder ausschließlich oder vorwiegend oder nur teilweise in diesen [Krankheits-]Symptomen äußert.“13
Im Falle der Hysterie suchen sich die unbewußten sexuellen Wünsche einen Weg nach außen; durch das „somatische Entgegenkommen“ werden die verdrängten sexuellen Vorstellungen ins Körperliche kanalisiert. „Die [hysterischen] Symptome sind [...] die Sexualbetätigung der Kranken.“14 Unter diesem Gesichtspunkt analysiert Freud Dora. Er versucht während der gesamten Behandlung Doras unbewußte Liebe zu Herrn K. nachzuweisen.
Er stellt schon bei der Schilderung der ersten Verführungsszene im Laden fest, daß die Ekelgefühle, die Dora bei dem Kuß empfand, eine Affektverkehrung darstellen. Dora hätte unter normalen Umständen sexuelle Erregung verspüren müssen. „Jede Person, bei welcher ein Anlaß zur sexuellen Erregung überwiegend oder ausschließlich Unlustgefühle hervorruft, würde ich unbedenklich für eine Hysterika halten [...].“15 16
Die Atemnot, unter der Dora in ihrer Jugend litt, wird von Freud als indirekte Folgeerscheinung der frühen Masturbation beschrieben. Sie habe als Kind die Eltern beim Geschlechtsverkehr belauscht und die Geräusche des kurzatmigen Vaters aus Schuldgefühlen vor ihrem ‘unmoralischem Tun’, der Masturbation, immitiert. Die Angst um ihren Vater, sich nicht überanstrengen zu dürfen, und ihre beim Belauschen des sexuellen Verkehrs möglicherweise in Angst umgeschlagene Masturbationsneigung äußern sich folglich in dem Symptom der Atemnot.17
Doras Vaginalausfluß hält Freud ebenfalls für eine Folge der Masturbation.18
Bei der Analyse des ersten Traums kommt Freud zu dem Schluß, daß Dora in ihrer Kindheit Bettnässerin gewesen sein muß. Der Traum schildert eine Szene, in der Dora von ihrem Vater, der vor ihrem Bett steht, geweckt wird, da das Haus brennt. Die Mutter will noch ihr Schmuckkästchen retten, woraufhin der Vater sagt, er wolle nicht, daß er und seine Kinder aufgrund des Schmuckkästchens verbrennen.
Da dieser Traum das erste Mal auftrat, nachdem die Szene am See stattgefunden hatte, interpretiert ihn Freud als Reaktion auf eben diese Szene. Der Vater habe sie als Kind regelmäßig nachts geweckt, um sie vor dem Bettnässen zu schützen. Dora reaktiviert mit dem Traum ihre infantile Schutzbedürftigkeit und Liebe zum Vater, damit er sie vor Herrn K. und ihrem eigenen Verlangen, sich ihm hinzugeben, beschütze.
Das brennende Haus, ‘Feuer’, stehe in diesem Zusammenhang einerseits für sein Gegenteil, also ‘Wasser’, ‘Nässe’, wodurch Freud die Verbindung zum Bettnässen zieht. In die aktuelle Entstehungszeit des Traumes verstetzt, steht ‘Nässe’ für „das Naßwerden beim sexuellen Verkehre[...]. Sie [Dora] weiß, daß gerade darin die Gefahr besteht, daß ihr die Aufgabe gestellt wird, das Genitale vor dem Benetztwerden zu hüten.“19 Der Traum ist laut Freud ein Hilferuf an den Vater, Dora vor Herrn K. und den drohenden Verlust ihrer Jungfräulichkeit zu schützen.
Andererseits steht das Feuer in Verbindung mit dem Schmuckkästchen, welches symbolhaft das weibliche Genital darstellt, für Doras eigene sexuelle Erregbarkeit, ihren starken Wunsch nach Defloration, den sie, wie Freud es mehrfach betont, aber in gleichem Maße verdrängt. Sexualität ist für Dora immer auch behaftet mit Krankheit und Zerstörung. Die voreheliche Syphillis- Erkrankung ihres Vaters mit anschließender
Impotenz, die ihrer Meinung nach daraus resultierende Geschlechtskrankheit ihrer Mutter und ihren eigenen, von ihr Katarrh genannten, Vaginalausfluß stehen für Dora in Verbindung mit Sexualität und begründen, wie Freud vermutet, teilweise ihre Sexualablehnung. Er schreibt, daß die „Gouvernante [...] ihr aus eigener Lebenserfahrung vorgetragen hatte, alle Männer seien leichtsinnig und unverläßlich. Für Dora muß das heißen, alle Männer seien wie der Papa. Ihren Vater hielt sie aber für geschlechtskrank, hatte er doch die Krankheit auf sie und auf die Mutter übertragen. Sie konnte sich also vorstellen, alle Männer seien geschlechtskrank[...].“20 Was es für Dora heißen muß, sich szuhalten ist, daß der erste Traum Doras für Freud ein Beleg ihrelbst als Teil einer sich gegenseitig ‘beschmutzenden’, krankmachenden Familienkonstellation wahrzunehmen, wird an anderer Stelle noch genauer zu betrachten sein. Fester starken unbewußten Liebe zu Herrn K. darstellt.21 Sie habe sich trotz des
Ausgangs der Szene am See ein Fortführen der Umwerbungen Herrn K.s gewünscht. Die vermeintliche Blinddarmentzündung Doras, neun Monate nach der Szene am See, gibt weiterhin darüber Aufschluß. Sie stellt eine mit Dora zur Verfügung stehenden Mitteln realisierte Entbindungsphantasie dar, mit welcher Dora das Ende der Szene unbewußt korrigiert habe.22 Da ‘der erste Traum’ während der Analyse wieder auftaucht, und aufgrund Doras Nachtrag, sie hätte nach dem Aufwachen stets Rauch gerochen, spricht Freud in diesem Zusammenhang das erste Mal von Übertragung: „Nehme ich endlich die Anzeichen zusammen, die eine Übertragung auf mich weil ich Raucher bin wahrscheinlich machen, so komme ich zur Ansicht, daß ihr eines Tages wahrscheinlich während der Sitzung eingefallen, sich einen Kuß von mir zu wünschen. Dies war für sie der Anlaß, sich den Warnungstraum zu wiederholen[...].“23
Für Freud stellt die Übertragung allerdings einen die Analyse zusätzlich verkomplizierenden Faktor dar. An einigen Stellen wird deutlich, daß er sich der Übertragung Doras von Herrn K. auf ihn zwar bewußt ist, sie aber für die Analyse nicht konstruktiv nutzt, sondern im Gegenteil, Doras Übertragungsliebe abwehrt, um der
(Analyse-) Situation wieder ‘Herr’ zu werden. Welche Auswirkungen das auf das Ende der Analyse, vor allem auf Doras Chance, als gestärktes Subjekt aus der Kur hervorzugehen, mit sich bringt, wird später noch genauer beleuchtet.
Nach der Analyse des zweiten Traums Doras, welche drei Sitzungen in Anspruch nahm, bricht Dora die Behandlung bei Freud ab. In der letzten Sitzung sagt sie: „Wissen Sie, Herr Doktor, daß ich heute das letzte Mal hier bin?“24 Freud nimmt ihren Entschluß an, will in der Sitzung aber noch mit Dora arbeiten.
Er interpretiert ihre Entscheidung, von der Behandlung fern zu bleiben, allerdings nicht explizit als Scheitern der Kur, sondern ist der Meinung,
„[e]s war ein unzweifelhafter Racheakt, daß sie in so unvermuteter Weise, als meine Erwartungen auf glückliche Beendigung der Kur den höchsten Stand einnahmen, abbrach und diese Hoffnungen vernichtete.“25 Rachsucht gegen die Männer in ihrer Umgebung ist für Freud ein Motiv Doras Handelns, welches durch den zweiten Traum von ihm entschlüsselt wird.
Den zweiten Traum an dieser Stelle komplett wiederzugeben, würde allerdings zu weit führen. Es werden deshalb nur ein paar zentrale Aspekte vorgestellt, an denen die spätere Kritik ansetzen wird.
Dora träumte, ihr Vater sei nach einer Krankheit gestorben. Sie erfährt es durch einen Brief ihrer Mutter, den sie auf ihrem Zimmer findet. Dora sei ohne das Wissen ihrer Eltern von zu Hause fortgegangen und hätte deshalb von ihrer Mutter nicht erfahren, daß der Vater krank gewesen sei. Freud deutet diese Passage als eine Rachephantasie Doras an ihrem Vater. Er stellt eine Analogie zum Abschiedsbrief Doras auf, in welchem sie ihren Selbstmord ankündigte. Auch er sei dazu bestimmt gewesen, ihren Vater in Angst und Schrecken zu versetzen, sowie im Traum ihr eigenmächtiges Verschwinden aus dem Hause, welches dem Vater aus Kummer das Herz brechen sollte.26
Diese durch den Traum konstatierte Rachsucht Doras wendet Freud als Motiv auf weitere Situationen an.
So kommt Freud zu dem Schluß, daß es sich bei dem Schlag in Herrn K.s Gesicht nach der Szene am See nicht um eine Kränkung über die an Dora gestellte Zumutung handelte, sondern um eifersüchtige Rache.27 Sie wußte von der Gouvernante, daß Herr K. diese mit exakt dem selben Wortlaut verführt hatte, wie er es auch bei Dora versuchte. Wie eine dienende Person behandelt zu werden, stellte für Dora eine Hochmutskränkung dar. Außerdem berichtete Dora erst 14 Tage nach dem Vorfall ihren Eltern von den Geschehnissen, was für Freud auf eine unbewußte Identifizierung mit der genannten Gouvernante hindeutet. Diese hatte mit ihrer Kündigung, welche 14tägige Frist zuließ, gewartet, ob sich Herr K. ihr noch einmal zuwenden würde. Dora hatte sich ebenfalls eine 14tägige Frist gegeben, in der sie sich ein Fortsetzen der Umwerbungen Herrn K.s gewünscht hätte. In dem Sinne deutet Freud das Inkenntnissetzen ihrer Eltern von den Vorkommnissen am See einerseits als Racheakt gegen Herrn K., andererseits gegen ihren Vater, der daraufhin nicht mehr ungestört seine Beziehung zu Frau K. ausleben kann. Das Inkenntnissetzen gehört für Freud somit zu Doras neurotischem Krankheitsbild, denn „ein normales Mädchen wird [...] allein mit solchen Angelegenheiten fertig.“28
Doras Ausscheiden aus der Behandlung Freuds folgt ebenfalls einer 14tägigen „Kündigungsfrist“. Auf die Frage, wann sie den Entschluß, aus der Kur fortzubleiben, gefaßt habe, antwortet sie: „Vor vierzehn Tagen, glaube ich.“29 Diese Analogie zu den mit Herrn K. im Zusammenhang stehenden Ereignissen ist wieder ein starker Hinweis auf Doras Übertragungliebe, welchen Freud allerdings auch in diesem Kontext nicht aufnimmt.
Der ‘zweite Traum’ behandelt außerdem Doras Suche nach dem ‘Bahnhof’. Um ihn zu errreichen, geht sie durch einen ‘dichten Wald’, um schlußendlich wieder zu Hause anzukommen, wo Dora erfährt, daß ihre Mutter schon auf dem ‘Friedhof ‘sei.
Diese Szene stellt für Freud eine Deflorationsphantasie dar.30 Den gesamten Traum stellt Freud wieder in den Zusammenhang mit Herrn K. und der Szene am See. Er vermutet, daß Dora die Angelegenheit mit Herrn K. viel ernster aufgefaßt hat, als sie bisher verraten wollte.31 Freud ist der Meinung, Dora habe selbst nach der von ihr abgebrochenen Liebeswerbung Herrn K.s auf weitere Signale von ihm gewartet, die seine Ernsthaftigkeit bestätigt hätten.
Bei den K.s war häufig von Scheidung die Rede. Freud nimmt an, Dora hätte auf eine Heirat mit Herrn K. gehofft, was Freud selbst als potentiellen Ausgang des Beziehungsdramas für möglich gehalten hätte: „Ja, wenn die die Versuchung in L. einen anderen Ausgang genommen hätte, wäre dies für alle Teile die einzig mögliche Lösung gewesen.“32
2. Dora- eine Adoleszente
Als Dora zu Freud in die Behandlung kam, war sie achtzehn Jahre alt. Die Vorkommnisse, welche sie in der Analyse schildert und welche für die Behandlung von zentraler Bedeutung sind, spielten sich alle zwischen ihrem dreizehnten und achtzehnten Lebensjahr ab, sprich in Doras Adoleszenzphase. Adoleszenz meint hier die psychischen Prozesse und Reaktionen auf die körperlichen Veränderungen während der Pubertät.
Freud war zur Zeit der Behandlung Doras nicht ausreichend mit den Entwicklungsprozessen während der Adoleszenz vertraut. Er sah in der Adoleszenz eine Wiederholung ödipaler Konflikte, die unter günstigen
Bedingungen in einer Objektfindung im außerfamiliären Bereich münden sollen.33
Während es bei Jungen laut Freud zu einem großen Vorstoß der Libido kommt, bringt die Pübertät für Mädchen „eine neuerliche Verdrängungswelle, [...eine] Verstärkung der Sexualhemmnisse“.34
2.1 Kritik an der Fallgeschichte
Aufgrund der fehlenden Berücksichtigung Freuds, Dora als Adoleszente zu betrachten und die damit einhergehenden adoleszenzspezifischen Spannungen in der Entwicklung Doras in die Analyse mit ein zu beziehen, kommt es zu vielfältigen Konflikten zwischen Freud und Dora, die am Ende zum vorzeitigen Abbruch der Kur führen.
Vera King meint, daß es sich bei der Fallgeschichte nicht primär um eine Darstellung der Geschichte und Behandlung einer jungen Frau handle, sondern für Freud die Möglichkeit, sich zum aktuellen Entwicklungsstand der psychoanalytischen Theorie zu äußern, im Vordergrund stand.35 Es ging also um den Versuch, seiner vorangegangenen Publikation, ‘Die Traumdeutung’36, mehr Geltung zu verschaffen, ihre Relevanz zu beweisen, und in Hinblick auf seine geplante Publikation, die ‘Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie’37, Erkenntnismaterial zu sammeln. Freud eignet sich Doras Geschichte an, ohne dabei ihr Interesse für den Ausgang der Kur zu berücksichtigen.
Es ist zum Beispiel auffällig, daß Freud stets betont, welch hartnäckigen Widerstand Dora in der Analyse leistet, wie sie sich gegen seine Deutungsmuster sträubt. (S.70, 73, ..) King betont, daß Dora sehr wohl ein Interesse an einem produktiven Ausgang der Kur hatte. Dora, stets als Spielball in einem Beziehungsgeflecht der Erwachsenen mißbraucht, sucht die Möglichkeit einer Korrektur ihrer Vorstellung von destruktiven heterosexuellen Beziehungen. Diese Chance verwehrt Freud Dora im Laufe der Analyse.
2.1.1 Doras Vorstellung einer destruktiven Urszene
Die Urszenenphantasie ist im Verständnis Freuds mit dem tatsächlichen Belauschen des elterlichen Verkehrs und den daraus resultierenden Ängsten und Erregungen des Kindes zu beschreiben.
King macht deutlich, daß der Begriff ‘Urszenenphantasie’ auch erweitert, also „vom konkreten Ereignis im Sinne der wirklichen Beobachtung abgelöst [...] und diese Phantasie als innere Konstruktion“ zu verstehen ist.“38
Sie verwendet ihn in seiner erweiterten Form und fokussiert die Urszenenphantasie außerdem aus einer adoleszenztheoretischen Perspektive.
Soll es zu einer Ablösung der primären ödipalen Bindungen in der Adoleszenz kommen, ist die Vorstellung von Produktivität und Lust in der Verbindung mit der Urszene vonnöten.
Deshalb lautet „die zentrale Entwicklungsanforderung in der Adoleszenz: [..] das Bild des vereinigten Paares in die eigene Geschlechtsidentität zu integrieren und produktiv auszugestalten.“39 Werden die Eltern in der Urszenenphantasie als ein schöpferisches, gebendes und empfangendes Paar ausdifferenziert, bei deren Vereinigung etwas „Wichtiges und Gutes“- das Kind- entsteht, welches wiederum die gegenseitige Anerkennung in der Beziehung widerspiegelt, sind die Voraussetzungen für eine eigene schöpferische Potenz und die Entwicklung einer erwachsenen Identität.erfüllt.
Bei der weiblichen Entwicklung spielt parallel dazu die Aneignung der genitalen Weiblichkeit eine maßgebliche Rolle, da der weibliche Körper für die Verortung der Urszene imaginiert wird. Das heißt für junge Frauen ist es der eigene Körper, die Potentialität des Empfangens und Gebärens, der in die Urzenenphantasie unbewußt einfließt.
Die Urszenenphantasie Doras wird in der Fallgeschichte von Freud angeführt, um eines ihrer hysterischen Symptome, die Atemnot, zu erklären. Dabei betont Freud Doras Identifikation mit dem Vater und ihre Vorstellung von vererbten (Geschlechts-) Krankheiten.
Die Bezeichnung ‘Katharr’ für Doras Vaginalausfluß läßt allerdings die Vermutung zu, daß sie sich in einer destruktiven Identifikation mit beiden Elternteilen befindet, mit dem keuchenden Vater, der sich nicht überanstrengen darf, und mit der ebenfalls an Vaginalausfluß leidenden Mutter.
Beide Symptome der Eltern stehen für Dora im Zusammenhang mit dem sexuellen Verkehr, als Folge der „unglückliche[n] Vereinigung, aus der sie selbst, Dora, hervorgeht.“40
Dementsprechend sieht Dora sich unbewußt als Produkt dieser zerstörerischen Vereinigung oder anders herum, ihren eigenen Ursprung als Ursache der destruktiven Beziehung ihrer Eltern.
Doras Urszenenphantasie birgt für King den Grund ihrer zahlreichen hysterischen Symptome. Besteht bei Freud in den hysterischen Symptomen die Sexualbetätigung der Kranken, indem sie einen Kompromiß abbilden zwischen sexuellem Wunsch und Verbot, so erweitert King diesen Zusammenhang noch um die sich in den Symptomen verbildlichenden Destruktivitätsphantasmen in Bezug auf die Urszene. „Das hysterische Symptom präzisiert insofern von zwei Seiten, an welchem Punkt Dora steht oder stecken geblieben ist in der adoleszenten Integrationsarbeit, oder, besser gesagt, in der adoleszenten Vorbereitung der Integration.“41
Gleichzeitig repräsentiert Doras hysterisches Krankheitsbild ihre aufgenommene Wiedergutmachungspflicht, die Vorstellung, das
Beziehungsgeflecht zu korrigieren. Analog dazu ist Doras Position innerhalb des familiären Umkreises zu verstehen: sie läßt sich als Tauschobjekt einsetzen, um die destruktive Urszene zu ‘sühnen’.
Sie bietet sich Herrm K. an, als Ersatz für dessen Frau, welche ein Verhältnis mit Doras Vater pflegt. In diese Aufgabe bzw. Doras Wunsch, die Synthese zwischen den antagonistisch wirkenden Elternteilen in sich zu bilden, fließen zwar ihre adoleszenten Aneignungsbemühungen und ihre Kreativität mit ein, werden darin allerdings auch erschöpft, so daß keine Energie mehr für ihre sublimatorischen Fähigkeiten bleibt.42
Interpretiert Freud den ‘ersten Traum’ nur unter dem Aspekt der Reaktualisieruing Doras ödipaler Liebe zum Vater, als Schutz vor Herrn K.s, vor allem aber ihrem eigenen Begehren, so deutet King den Traum unter adoleszenzspezifischen Gesichtspunkten „als eine verdichtete Darstellung von Doras Ursprungsphantasien.“43
Das Schmuckkästchen, symbolisch für das weibliche Genital, wird durch die Verbindung mit ‘Feuer’ im Traum als gefährdet, bzw. gefährlich phantasiert. Doras Zeugung könnte den Vater impotent gemacht habeneine mögliche unbewußte Gedankenführung.
Und im Hinblick auf Doras Identifikation mit der Mutter könnte das bedeuten, daß sie durch ihre eigene sexuelle Erregung nicht nur den Mann, sondern auch ihre Phantasiekinder gefährden und krank machen könnte. Die Funktion des Traums wird folglich erweitert um die Warnung an andere, im Fall der Analyse an Freud, sich vor Doras ‘brennenden Schmuckkästchen’ zu schützen.
Gleichzeitig behält King aber die ödipale Phantasie Doras im Blickpunkt und analysiert diese in Hinsicht auf Doras Familiensituation, welche von Freud stets vernachlässigt worden ist.
Denn hält man sich Doras ödipalen Konflikt und gleichzeitig ihre destruktive Urszenenphantasie vor Augen und vergleicht diese mit den
Vorkommnissen und psychischen Prozessen, die in Verbindung mit den K.s stehen, stellen sich einige Analogien dar. Dora, welche schon früh die Rolle der Mutter bei der Pflege ihres stets kranken Vaters übernommen hatte, erlebte in dieser Konstellation einen ödipalen Triumph, welcher sich, wie Vera King betont, allerdings als „leere Hülse“ entpuppte.44 Um den Platz an der Seite des Vaters zu erobern, mußte Dora nicht wirklich mit der Mutter rivalisieren. Diese überließ den Platz kampflos an Dora, da die elterliche Beziehung schon früh durch Entfremdung und Desinteresse gekennzeichnet war.
Für Dora mußte das bedeuten, sich als Subjekt nicht entfalten zu können, ihre ödipalen Phantasien haben keine Begrenzung erfahren. So wiederholte sich der leere ödipale Triumph in der Beziehung zu Herrn K. Genauso kampflos wie der Vater wurde ihr Herr K. von Frau K. überlassen.45
„Es fehlt der aneignende Zwischenschritt, der ihre Phantasien begrenzt und ihr eine Subjekthaftigkeit verleiht, die sich mit einer widerständigen (Beziehungs-) Realität (der Eltern) auseinandersetzen muß.“46 Der Versuch Doras, zu einer Subjekthaftigkeit und einer positiv besetzten Weiblichkeit zu gelangen, scheitert. In der Familie fehlt es an positiv besetzten Identifikationsmöglichkeiten- die Mutter verschiebt ihr Begehren in einen Putzzwang, der Vater leidet, wie Dora glaubt, unter den Folgen seines „leichtsinnigen Lebenswandel“47 Die Beziehung von Vater und Mutter wird als sich gegenseitig beschmutzend und zerstörend wahrgenommen.
Doch auch Doras Engagement „andere Lösungen herzustellen, ein verzweifeltes Unterfangen, im Verhältnis zu Frau K., zu Herrn K. und zu dem einzigen Liebespaar, Vater und Frau K., zu sich und zu einer positiven Vorstellung ihrer Weiblichkeit zu gelangen“48 scheitert.
Mit der Szene am See, dem Überschreiten Doras Grenze zwischen
Phantasie und Wirklichkeit seitens Herrn K., bricht das „interpersonal aufgebaute Abwehrkonstrukt“49 zusammen. Die Worte, die er gebraucht, um seine Liebeswerbung einzuleiten, er habe ‘nichts’ an seiner Frau, treffen außerdem Doras Empfindungen für Frau K., die im Wesentlichen „die Gestalt der idealisierenden Bewunderung“50 hatten. Herr K. vernichtet damit also auch die labile Basis für eine weibliche Identifizierung.
Dora wird sich im folgenden ihrer Position als ‘Tauschmasse’ bewußt und wird wieder einmal auf sich zurückgeworfen, ohne daß ihr Bild einer destruktiven heterosexuellen Beziehung eine Korrektur erfahren hätte. Die nächste Chance, die Dora sah, schöpferische Potenz zu erlangen und sich ihre Weiblichkeit anzueignen, indem sie versuchte eine produktive Mann-Frau-Beziehung, eine nicht-destruktive Urszene herzustellen, lag in der Beziehung zu Freud.
2.1.2 Doras Suche nach weiblicher Identifikation: Dora und die Mutter; Dora und Frau K.
In der weiblichen Adoleszenz kommt es neben neu erfahrenen Erregungen, Phantasien und Ängsten, die durch den sich verändernden Körper und die Möglichkeit, Kinder zu gebären, eintreten, auch zu Konflikten im Verhältnis zur Mutter. So ist es für die jungen Frauen einerseits nötig, sich mit ihrer Mutter identifizieren zu können, um ein positives Bild von Weiblichkeit zu entwickeln, andererseits braucht es den Kampf mit der Mutter für die Ablösung und Individuation der Tochter.51
In der Fallgeschichte Freuds wird das Verhältnis zwischen Dora und ihrer Mutter nur kurz abgehandelt. Die Mutter leide unter einer
‘Hausfrauenpsychose’ und hätte nur wenig Interesse an ihren Kindern, da sie den ganzen Tag ihrem Reinlichkeitszwang nachginge. Das Verhältnis zwischen Dora und ihrer Mutter sei sehr unfreundlich.
Es scheint Freud, als identifiziere sich Dora eher mit den männlichen Familienmitgliedern- dem Vater, den sie in ihrer hysterischen Symptomatik immitiert, und dem Bruder, „der ihr in früheren Jahren das Vorbild gewesen,dem ihr Ehrgeiz nachgestrebt hatte“52
Dagegen betont King, daß Doras vaginaler Ausfluß, von dem Dora annimmt, ihn vom Vater geerbt zu haben, auf eine Identifikation mit der Mutter schließen läßt. Es kann angenommen werden, daß der Putzzwang der Mutter einerseits die Kanalisierung ihres sexuellen Begehrens symbolisiert, andererseits die Reaktion auf ihre ‘vaginale Verunreinigung’ darstellt, was zumindest von Dora so verstanden wird.
In der Identifizierung mit der Mutter kann das für Dora heißen, daß „alles ‘Fließen’ in ihrem Geschlecht als bedrohlich und krankhaft erlebt“53 wird. Alles von Dora mit Sexualität in Verbindung gebrachte wird somit als schmutzig erlebt. So könnte auch ihre Menstruation mit der angstvollen Vorstellung eines vaginalen Ausflusses verbunden und ihre Menstruationsbeschwerden darauf zurückzuführen sein.
Freud nimmt den Konflikt, der für Dora in der Identifizierung mit der Mutter und damit einhergehend in der Verbindung zwischen Sexualität und Krankheit liegt, nicht wahr. Im Gegenteil, er verstärkt Doras Befürchtungen, in dem er ihren Ausfluß als Folge der Onanie begreift.
Es kommt also in Folge der Identifizierung Doras mit ihrer Mutter nicht zu einer positiven Bestzung ihrer Weiblichkeit und ihrer ‘Innergenitalität’54 Dies wäre als Voraussetzung für eine positive Abgrenzung zu ihrer Mutter aber wichtig, um eine eigene weibliche Identität entwickeln zu können, mit der eine befriedigende Beziehung zum Mann ermöglicht wird55.
Stattdessen äußert sich Doras Wunsch, zu einer positiven Besetzung ihres eigenen Geschlechts zu kommen, in ihren homosexuellen Strebungen gegenüber Frau K. Der Wunsch besteht vor allem darin, „die eigene Weiblichkeit in einer bewunderten Frau spiegeln und sich mit ihr identifizieren zu können.“56
Frau K. bietet sich gerade deshalb an, da sie die einzige in Doras sozialem Umfeld ist, die eine produktive Paarvorstellung gewähren kann, da sie die Geliebte Doras Vaters ist.
Deshalb schützt Dora diese Beziehung bis zum Tag der Szene am See, läßt aber auch danach kein böses Wort über Frau K. verlauten, obwohl Dora sie „als Urheberin ihres Unglücks hätte sehen müssen“57.
Freuds Verwunderung darüber, daß Dora den „entzückend weißen Körper“ ihrer Rivalin lobte, „in einem Ton, der eher der Verliebten [...] entsprach“58, zeigt, daß er die homosexuelle Idealisierung Doras zwar bemerkt, sie aber nur in den Kontext seiner Beschreibung von Neurosen stellt.
King weist darauf hin, daß die Beschreibung von Frau K. im Gegensatz steht zu Doras Vorstellungen und Assoziationen des weiblichen Genitals. Sind Doras sexuelle Phantasien, im Hinblick auf die Identifizierung mit der Mutter, stets behaftet mit Ängsten, Vorstellungen von Krankheit und Zerstörung, so repräsentiert Frau K. für Dora das Reine und Schöne. Sie umgeht bei Frau K. die Beschäftigung mit deren inneren Geschlecht, um sie als psychische Konstruktion rein und schön zu behalten.59 Das innere Geschlecht, das Schmutzige und Befleckte, gehört für Dora zur Mutter.
Doras Wunsch ist es allerdings, die Vorstellungen von Weiblichkeit, die sie mit Frau K. verbindet, die sich nur in der Beschreibung von Äußerlichkeiten manifestieren, auch innerhalb ihres Körpers zu finden.
Die ‘homosexuelle Idealisierung’ Frau K.s weist folglich darauf hin, daß Dora auf der Suche ist nach einem Weg, ihre destruktiven
Weiblichkeitsvorstellungen zu korrigieren und das Bild eines sich produktiv ergänzenden Paares auszudifferenzieren. Dafür benötigt sie einen Schutzraum, in dem sie ihre Integrationsbemühungen ausleben, sich selbst ausprobieren kann.
2.1.3 Übertragung und Gegenübertragung in der Analyse
Es wurde bisher erläutert, welche negativen Voraussetzungen für Doras adoleszenten Integrationsprozeß zur Verfügung standen. Dennoch sieht King in der Fallgeschichte das Material bereit- und offenliegen, welches, unter dem Gesichtspunkt adoleszenztypischer Konflikte analysiert, zu einem produktiven Ende der Behandlung hätte führen können: „Der Text inszeniert als literarische Form die Potentialität der Potenz.“60
Jedoch verfängt sich Freud in einer Abwehr von Übertragungsangeboten Doras und Gegenübertragungsreaktionen, die Doras adoleszente Konfliktspannung reproduzieren.
Freuds konstantes Anliegen, Doras unbewußte Liebe zu Herrn K. nachzuweisen, ja sogar zu behaupten, es wäre für alle Beteiligten die beste Lösung gewesen, wenn Dora nach einer möglichen Scheidung der K.s Herrn K. geheiratet hätte, weist auf eine Abwehr von Doras
Übertragungsliebe hin. Freud mißversteht die Bedeutung von Herrn K. für Doras innere Realität. Genauso mißversteht er seine eigene Bedeutung in der Analyse für Doras innere Realität: das Herstellen einer produktiven Urszenenphantasie.
Freud, der stets Doras Widerstand in der Behandlung betont, verharrt in der Identifizierung des von Dora abgewiesenen Herrn K. „und hat sich dessen Rehabilitierung in seinen Gegenübertragungsreaktionen zur höchsten Aufgabe gemacht.“61 Er übersieht Doras Bereitschaft, ihre Angebote, die analytische Haltung in sich aufzunehmen.
Dora stellte Freud für die Analyse ihre Träume zur Verfügung, fing an, selbst Fragen zu stellen und signalisierte ihm so ihre „analytische Befruchtung“62.
Ist der erste Traum noch eine Warnung an Dora selbst und ihr Gegenüber, Freud, sich vor ihrem „brennenden Schmuckkästchen“ zu schützen, deutet der zweite Traum bereits auf die Realisierung der befürchteten Bedrohung. Viele Elemente im Traum zeigen sowohl die Verbindung zur ‘Szene am See’, als auch Doras adoleszente, psychische Verfassung: die Deflorationsphantasie, den Wunsch nach Befruchtung und nach Gebären eines Kindes, was sich ja auch schon in der hysterischen Inszenierung der Entbindungsphantasie 9 Monate nach der Szene am See abzeichnete.
An dieser Stelle sei eine längere Passage Kings zitiert, um den Wunsch nach einem Kind in der Adoleszenz als psychischen Prozeß zu begreifen: „Das imaginierte Kind steht sowohl für die Adoleszente selbst in ihrem Wunsch nach Neubeginn, Ablösung und Entbindung von den kindlichen Beziehungskonfigurationen, nach Hervorbringenen einer erwachsenen Identität. Zugleich steht das Phantasiekind für die Aneignung der weiblichen Potenz, für die Fähigkeit, mit der Mutter zu konkurriren, phantasmatisch ihren Platz in der Urszene einnehmen zu können und- in der Rückbesinnung auf das Eigene- das an oder in der Mutter Beneidete im eigenen Körper zu finden. Das Kind symbolisiert die Fähigkeit, sich des eigenen Geschlechts zu bemächtigen und den genitalen Innenraum als Ort der Produktivität und der Lust mit einem Mann zu imaginieren. Der Wunsch nach einem Kind bezeichnet den Versuch, das Bild des schöpferischen Paares auszugestalten und zu integrieren.“63
Mit den Träumen stellt Dora Freud das Material zur Verfügung, welches auf ihre inneren Spannungen, Wünsche und Erregungen hinweist. Gleichzeitig bereiteten die Träume auf einen Abbruch der Kur seitens Dora vor.
Die Übertragungsbotschaft des ersten Traumes, sich Freud sowohl an der väterlichen Stelle als Garant für Schutz zu wünschen, als auch das Erleben Freuds als begehrten, verführerischern Mann, zeigt einerseits Doras Wunsch nach Ausgestaltung ihrer Urszenenphantasie, andererseits die aus Erfahrung geschöpfte Furcht vor einer Wiederholung der gegenseitigen Kastration, wie sie durch den Ausgang der Szene am See symbolisiert ist. Die Übertragungsbotschaft des zweiten Traums ist, wie King feststellt, „die Realisierung der Szene am See als Urszene in der Analyse“64, d.h. die sich ständig wiederholende Szenerie aus Bindung und Trennung, Befruchtung und Abweisung hat sich in der Beziehung zu Freud nicht produktiv aufgelöst, sondern reproduziert sich durch Freuds unbewußte Identifizierung mit dem abgewiesenen Herrn K. und seinen Versuchen, Dora immer wieder auf diesen zurückzuverweisen.
Dora, die auf der Suche nach einem Schutzraum ist, in dem sie ihre Sublimations- und Integrationsbemühungen ausleben kann, wird von Freud beständig auf die äußere Realität zurückgeworfen, in die Welt der Erwachsenen, die ihr bisher keine Chance auf das Erreichen ihrer eigenen Subjekthaftigkeit gegeben haben. Diesen Schutzraum hätte die Analysesituation bieten können. Doch Freud mißversteht Doras Angebote, „flieht“ aus der Übertragungssituation,die ihn selbst zum Akteur hätte machen müssen, in die unbewußte Identifizierung mit Herrn K. und reproduziert damit den Kreislauf von Verführung und Kastration.
Die begonnene „Analyse-Schwangerschaft“65 endet somit in einem Abbruch der Beziehung. Dora fühlt sich von Freud abgewiesen, indem er ihre Übertragungsliebe immer wieder auf Herrn K. zurückführt und sich für
Dora durch das widerspruchslose Akzeptieren der
Behandlungsaufkündigung das Ende der Szene am See wiederholt; ihre Befürchtungen, die sich durch die Träume schon angekündigt haben, werden also bestätigt.
Freud fühlt sich von Dora abgewiesen, unterstellt, daß ein „unzweifelhafter Racheakt“ ihre Motivation für Beendigung der Kur gewesen sein muß, als seine „Erwartungen [...] den höchsten Stand einnahmen“.66 Nachdem er nicht müde wurde, Doras Widerstand gegen seine Interpretationslinien zu betonen, stellt er plötzlich „eine mögliche Vollkommenheit der Aufklärung“67 in Aussicht. So vermutet King, daß Freuds gleichzeitige Betonung der Bruchstückhaftigkeit der Fallgeschichte „als Ausdruck von Allmachtswünschen oder phallischen Omnipotenzvorstellungen zu lesen [ist], mit deren Hilfe Kastrationsangst oder die narzißtisch kränkende Blöße des Scheiterns verschleiert oder verdeckt werden sollen.“68
King behauptet, daß nicht der Mangel an Material, wie Freud es vermuten läßt, für die unvollständige Aufhellung des Falls verantwortlich ist, sondern das „Mißlingen eines Integrationsprozesses“69
Das gegenseitige Verfehlen in der Übertragungsdynamik führte zu einer „Unmöglichkeit des produktiven Zusammenkommens der Geschlechter“70
[...]
1 V. King; Die Urszene der Psychoanalyse; 1995
2 Ich beziehe mich in der vorliegenden Arbeit auf die 1. Auflage des Fischer Taschenbuchverlags: Siegmund Freud, „Bruchstück einer Hysterie-Analyse“, 1993
3 S. Freud; Bruchstück einer Hysterie-Analyse; 1993; S.22
4 ebd. S.61
5 vgl. ebd. S.30
6 ebd. S.23
7 S. Freud; Bruchstück einer Hysterie-Analyse, 1993; S. 25
8 S. Freud; Bruchstück einer Hysterieanalyse, 1993; S.72
9 ebd. S.23
10 ebd. S.24
11 ebd. S.101
12 vgl. S. Freud; Bruchstück einer Hysterie-Analyse; 1993; S.113- 119
13 S. Freud; Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie;1998; S. 66
14 ebd.
15 Freud; Bruchstück einer Hysterieanalyse; 1993; S.30
16 Daß die Verführungsszene allerdings auch als sexueller Übergriff verstanden werden kann, als unerwünschtes Eindringen Herrn K.s in Doras sexuelle Phantasiewelt wird bei Freud keiner näheren Betrachtung unterzogen.
17 vgl. ebd. S.79
18 vgl. ebd. S.78
19 S. Freud; Bruchstück einer Hysterie-Analyse; 1993; S.89
20 ebd. S.83
21 ebd. S.70
22 ebd. S.100- 102
23 S. Freud; Bruchstück einer Hysterieanalyse; 1993; S.73
24 S. Freud; Bruchstück einer Hysterie-Analyse; 1993; 104
25 ebd. S.107
26 ebd. S.97
27 ebd. S. 105
28 ebd. S. 94
29 S. Freud; Bruchstück einer Hysterie-Analyse; 1993; S.104
30 ebd. S. 98
31 vgl. ebd. S. 106
32 ebd. S. 107
33 vgl. S. Freud; Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie; S.117- 129
34 S. Freud; Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie; 1998; S.121
35 V. King; Urszene der Psychoanalyse; 1995; S.185
36 S. Freud; Die Traumdeutung; 1900
37 ders.; Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie; 1905
38 V. King; Die Urszene der Psychoanalyse; 1995; S. 121
39 ebd. S. 122
40 ebd. S.108
41 ebd. S.110
42 ebd. S.113
43 ebd. S.113
44 ebd. S.117
45 In dieser Darstellung Kings ist die Annahme impliziert, daß es sich bei Herrn und Frau K.um elterliche Ersatzfiguren handelte.
46 ebd. S.118
47 S. Freud; Bruchstück einer Hysterieanalyse; 1993; S.74
48 V. King; Die Urszene in der Psychoanalyse; 1995; S. 119
49 ebd.
50 ebd. S. 128
51 vgl. ebd. S.339
52 S. Freud; Bruchstück einer Hysterie-Analyse; 1993; S.23
53 V. King; Die Urszene der Psychoanalyse; 1995; S.139
54 der Begriff stammt von Judith Kerstenberg in den 60er Jahren; zitiert nach Vera King; Die Urszene der Psychoanalyse; 1995
55 vgl. V. King; Die Urszene der Psychoanalyse; 1995; S.144
56 ebd.
57 S. Freud; Bruchstück einer Hysterie-Analyse; 1993; S.62
58 ebd.
59 V. King; Die Urszene der Psychoanalyse; 1995; S.146
60 V. King; Die Urszene der Psychoanalyse; 1995; S. 76
61 ebd. S. 126
62 ebd.
63 V. King; Die Urszene der Psychoanalyse; 1995; S. 164
64 ebd. S.167
65 V. King; Die Urszene der Psychoanalyse; 1995; S. 171
66 S. Freud; Bruchstück einer Hysterie-Analyse; 1993; S. 107
67 V. King; Die Urszene der Psychoanalyse; 1995; S. 74
68 ebd.
69 V. King; Die Urszene der Psychoanalyse; 1995; S.75
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine Analyse der Fallgeschichte von Dora, einer jungen Frau, die von Sigmund Freud behandelt wurde. Es untersucht insbesondere Vera Kings Kritik und Interpretation von Freuds Fallgeschichte "Dora" und argumentiert, dass Freuds Analyse ein gescheiterter Versuch war, eine junge Frau zu verstehen, insbesondere im Kontext ihrer Adoleszenz.
Wer ist Dora?
Dora, eigentlich Ida Bauer, war eine 18-jährige Patientin von Sigmund Freud. Ihr Vater schickte sie in Behandlung, da sie seit ihrer Kindheit an hysterischen Symptomen litt.
Was sind Doras hysterische Symptome?
Doras Symptome umfassten Bettnässen in der Kindheit, Atemnot, Migräne, nervösen Husten, zeitweilige Stimmlosigkeit, Verdacht auf Blinddarmentzündung, ein Nachziehen des Fußes, Scheidenausfluss (Katarrh), Menstruationsbeschwerden, Stuhlverstopfung, Verstimmtheit, Zerstreutheit, Müdigkeit und Ohnmachtsanfälle.
Wie interpretierte Freud Doras Symptome?
Freud diagnostizierte bei Dora eine Konversionshysterie. Er interpretierte ihre Symptome als Ausdruck verdrängter sexueller Wünsche, insbesondere ihre unbewusste Liebe zu Herrn K. Er sah die Atemnot als Folge früher Masturbation und den Vaginalausfluss ebenfalls als Folge der Masturbation.
Was ist die Urszene und wie beeinflusst sie Doras Zustand?
Die Urszene ist die Vorstellung des elterlichen Geschlechtsverkehrs, die bei Dora destruktiv ist. Sie sieht sich unbewusst als Produkt einer zerstörerischen Vereinigung ihrer Eltern und entwickelt hysterische Symptome, um dieses Beziehungsgeflecht zu sühnen. Vera King argumentiert, dass Doras hysterische Symptome Destruktivitätsphantasmen in Bezug auf die Urszene verbildlichen.
Wer ist Herr K. und welche Rolle spielt er in Doras Leben?
Herr K. ist ein Freund der Familie und Liebhaber von Doras Vater. Dora wurde zweimal von Herrn K. sexuell belästigt. Dora fühlte sich von allen Seiten verraten, als ihr Vater Herrn K. glaubte, dass Dora die Szene am See nur eingebildet haben konnte.
Was ist Vera Kings Kritik an Freuds Analyse?
Vera King kritisiert Freud dafür, dass er Doras Adoleszenz und die damit einhergehenden spezifischen Konflikte nicht berücksichtigt hat. Sie argumentiert, dass Freud die Fallgeschichte nutzte, um seine psychoanalytische Theorie zu validieren, ohne Doras Interessen zu berücksichtigen. King betont auch die Bedeutung von Doras destruktiver Urszenenphantasie und ihrer Suche nach weiblicher Identifikation, die Freud vernachlässigt hat.
Was ist die Bedeutung von Doras Verhältnis zur Mutter und zu Frau K.?
Doras Verhältnis zur Mutter ist unfreundlich. King argumentiert, dass Doras Vaginalausfluss auf eine Identifikation mit der Mutter schließen lässt. Doras Wunsch nach einer positiven Besetzung ihres eigenen Geschlechts äußert sich in ihren homosexuellen Strebungen gegenüber Frau K. Dora idealisiert Frau K. als Gegenbild zu ihrer destruktiven Weiblichkeitsvorstellung.
Wie beeinflussten Übertragung und Gegenübertragung die Analyse?
Freud wehrte die Übertragungsangebote Doras ab und reagierte mit Gegenübertragungsreaktionen, die Doras adoleszente Konfliktspannung reproduzierten. Freud fixierte sich darauf, Doras unbewusste Liebe zu Herrn K. nachzuweisen, und verfehlte es, ihre Bereitschaft, die analytische Haltung in sich aufzunehmen, zu erkennen.
Warum brach Dora die Behandlung bei Freud ab?
Dora brach die Behandlung ab, weil sie sich von Freud missverstanden und abgewiesen fühlte. Freud führte ihre Übertragungsliebe immer wieder auf Herrn K. zurück, anstatt sie als Chance für eine produktive Urszenenphantasie zu nutzen. Dies führte zu einer Reproduktion der Szene am See und bestätigte Doras Befürchtungen vor gegenseitiger Kastration.
Was waren die Folgen des Abbruchs der Analyse?
Der Abbruch der Analyse führte zu einem "Mißlingen eines Integrationsprozesses" und zu einer "Unmöglichkeit des produktiven Zusammenkommens der Geschlechter". Dora konnte keine positive weibliche Identität entwickeln und ihre destruktiven Weiblichkeitsvorstellungen korrigieren.
- Quote paper
- Tanja Niemann (Author), 2001, Psychoanalyse und Adoleszenz: Vera Kings Kritik am "Fall Dora", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103331