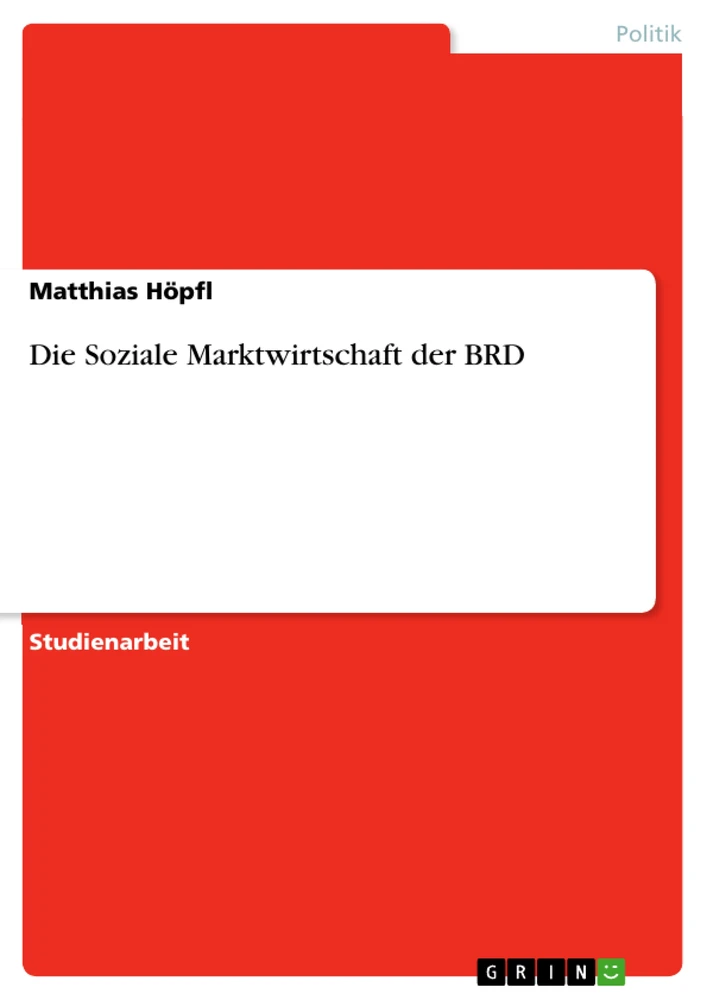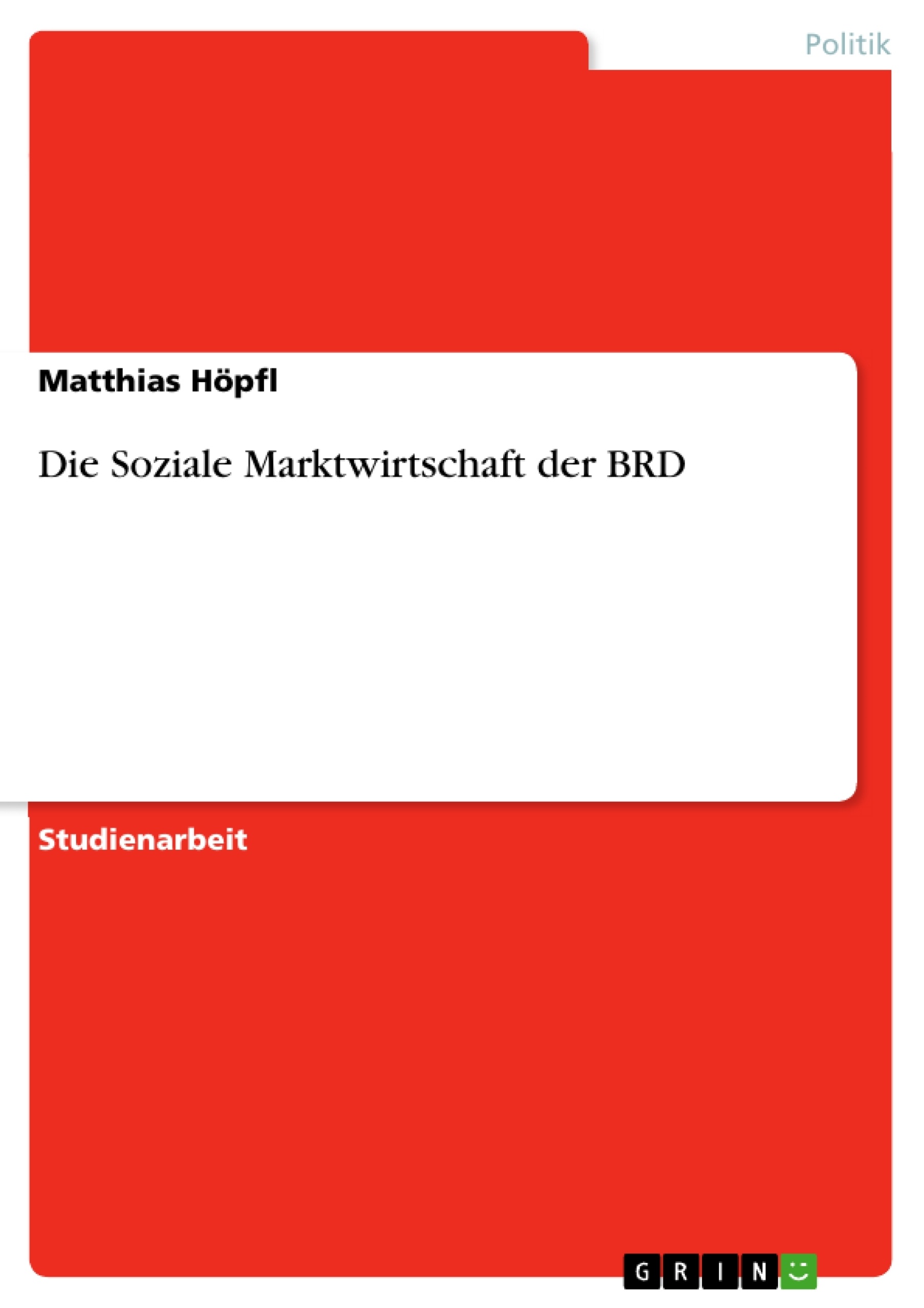Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die theoretische Konzeption des Ordoliberalismus und seine Umsetzung in der Sozialen Marktwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland. Der Fokus liegt darauf, die grundlegenden Theoriegedanken des Ordoliberalismus zu verstehen und zu analysieren, wie diese in der praktischen Wirtschaftspolitik umgesetzt wurden. Das Ziel besteht darin, den Einfluss der Freiburger Schule auf die politische und ökonomische Gestaltung der jungen Bundesrepublik zu beleuchten und die Entwicklung der Sozialen Marktwirtschaft zu erklären.
Die Arbeit beginnt mit einer Analyse der Effizienz freier Märkte und der Entstehung der Sozialen Marktwirtschaft in der Nachkriegszeit Deutschlands. Sie betrachtet die theoretischen Grundlagen des Ordoliberalismus, die von Theoretikern wie Walter Eucken, Leonhard Miksch und Franz Böhm der Freiburger Schule entwickelt wurden. Der Ordoliberalismus zielt darauf ab, die Privatautonomie und das Privateigentum zu regulieren, um eine staatlich garantierte Marktordnung zu schaffen.
Der theoretische Teil der Arbeit beleuchtet die Grundgedanken des Ordoliberalismus, der sich als eine modifizierte Form der reinen Marktwirtschaft versteht, die soziale Belange berücksichtigt. Walter Eucken entwickelte einen wirtschaftstheoretischen Ansatz, der sich von kollektivistischem Sozialismus und schrankenlosem Kapitalismus distanzierte. Der Staat sollte eine ordnungspolitische Rahmenbedingung schaffen, während der wirtschaftliche Prozess auf der Grundlage des Wettbewerbs bei privaten Haushalten und Unternehmen verbleiben sollte.
Die Arbeit analysiert, wie der Ordoliberalismus in der Praxis umgesetzt wurde und welchen Einfluss er auf die Gestaltung der Sozialen Marktwirtschaft in der BRD hatte. Dabei werden die konstituierenden und regulierenden Voraussetzungen für eine funktionierende Wettbewerbsordnung erörtert und deren Bedeutung für die deutsche Wirtschaftspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg dargelegt.
Die Effizienz freier Märkte wirkt beim ersten Hinsehen überraschend. Grundsätzlich liegt es ja nicht im Interesse der Individuen, eine allgemeine wirtschaftliche Wohlfahrt zu fördern, denn zu freien Märkten gehören viele Käufer und Verkäufer die in erster Linie auf ihr eigenes Wohlergehen bedacht sind. Und dennoch ist das Ergebnis Marktwirtschaft aus dezentralen Entscheidungen und eigeninteressierten Akteuren nicht Chaos, sondern Effizienz.1 Die Erkenntnis, daß eine Marktwirtschaft nur durch freie Marktteilnehmer die ihr Eigeninteresse verfolgen, bestehen kann, trifft ebenso auf das Prinzip der Sozialen Marktwirtschaft der BRD zu.
„Every individual ...neither intends to promote the public interest, nor knows how much he is promoting it...He intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention. Nor is it always the worse for the society that it was nopart of it. By pursuing his own interest he frequently promotes that of the society more effectually than when he really intends to promote it.“2
(Adam Smith)
Nach dem Krieg galt es, eine Wirtschaftsform für das bis in seine Grundfesten zerstörte Deutschland zu konzipieren, deren inhaltliche Bestimmung aber keineswegs a priori gegeben war. Zunächst schien der sozialistische Weg einer zentralistischen Planung und Lenkung der bessere zu sein, die Versorgung der vom Krieg gemarterten Bevölkerung für die Zukunft zu gewährleisten. Selbst die CDU wollte in ihrem Ahlener Programm von 1947 eine kollektivistische Steuerung der Grundstoffindustrien nicht ausschließen. Jene, die sich als liberalere Vertreter der künftigen wirtschaftspolitischen Ordnung verstanden, sammelten sich um den bayerischen Wirtschaftsminister und späteren Bundesminister für WirtschaftLudwig Erhard.3 Die Grundgedanken, welche Erhard als Minister verfolgte, waren bereits in den 30er Jahren konzipiert worden, denn schon zu Zeiten des Dritten Reichs dachten Theoretiker der Freiburger Schule wie Walter Eucken, Leonhard MikschundFranz Böhmüber einen für Deutschland tragbaren wirtschaftspolitischen Fahrplan nach, welcher„[...]die staatliche Planwirtschaft ebenso wie private Marktmacht zu Lasten des Verbrauchers [...]“4zu umgehen vermag. So vertrat man hier einen politiktheoretischen Ansatz, dessen Maxime imfreiheitlichen unternehmerischen Handeln innerhalb einer staatlich garantierten Marktordnung liegen sollten - den sogenannten Ordoliberalismus.5
2
I. Die theoretische Konzeption des Ordoliberalismus und seine relativierte Umsetzung Der von der Freiburger Schule entwickelte ordoliberalistische Ansatz versteht sich als ein diePrivatautonomie und das Privateigentum regulierenderAnsatz, der die politikökonomische Gestaltung der jungen Republik erheblich beeinflußte. Welche inhaltlichen Theoriegedanken sich hinter diesem Freiburger Ansatz verbergen und inwieweit der Transfer von der Theorie in die Praxis letztendlich möglich war, soll erörtert werden.
1. Die Theorie
Das klassische System Markwirtschaft wurde mit einer zusätzlichen, soziale Belange betreffenden Komponente bedacht und sollte sich in dieser Variante nunmehr als Soziale Marktwirtschaft in der BRD etablieren.
Basierend auf dem im 18./19. Jahrhundert emporgekommenen Modell der reinen Marktwirtschaft, welches vor allem Selbständigkeit und bürgerliche Freiheit gegenüber staatlicher Willkür postulierte, betrachteten die neoliberalen Theoretiker es als eine Chance für das neue Modell6, „[...]sich in der Konfrontation mit den Realitäten des politischen und ökonomischen Systems Deutschlands zu bewähren.“7
Walter Eucken entwickelte einen wirtschaftstheoretischen Ansatz der „[...]sich von einem(kollektivistischen) Sozialismus, einem (konzeptionslosen) Interventionismus und einem(schrankenlosen) Kapitalismus distanzieren [sollte].“8
So ist das ordoliberale Leitbild nach Eucken wie folgt formuliert: ‚Staatliche Planung der Formen ja; staatliche Planung und Lenkung des Wirtschaftsprozesses - nein.‘9Demnach habe der Staat die Wirtschaft in einenordnungspolitischen Rahmeneinzufügen und der wirtschaftliche Prozeß auf derGrundlage des Wettbewerbsbei den privaten Haushalten und Unternehmen zu bleiben. Um eine Wettbewerbsordnung überhaupt zu ermöglichen sowie deren Funktionsfähigkeit zu gewährleisten, sind sowohlkonstituierendeals auchregulierendeVoraussetzungen unumgänglich.
1.1 Konstituierende Prinzipien:
1. Schaffung und Sicherung eines funktionsfähigen Marktpreissystems
Dieses Prinzip enthält nicht nur die Forderung, staatliche Subventionen und Zwangsmonopole sowie Kartellbildung und dergleichen zu vermeiden, sondern zielt - im Gegensatz zur reinen, laissez fairen Marktform - auf einepositive Wirtschaftsverfassungspolitik ab, die eineMarktform der Konkurrenzzu gewährleisten vermag.10
2. Die Gewährleistung des Privateigentums an Produktionsmitteln
3. Freier Zugang zu den Märkten
Gemeint ist damit die Freiheit von Gewerbe, Handel und Produktion als auch der freie Zugang zu und von Auslandsmärkten (Freihandel).
4. Die Identität der Dispostitionsfreiheit des Unternehmers mit dessen voller Haftung Ökonomische Fehlleistungen werden dem Verursacher zugeschrieben und nicht etwa durch staatliche Subventionen verdeckt, alsoRentabilitätschance versus Risikoder Akteure. 5. Eine konstante Wirtschaftspolitik,
„[...]zur Absicherung der Entscheidungen der Wirtschaftssubjekte gegenüber politischen Risiken.“11
Die Notwendigkeit einer solchen Konstanz rührt vor allem daher, daß aufgrund sich ständig ändernder Kurse in der Wirtschaftspolitik Langzeitinvestitionen ausbleiben, was wiederum deflatorische Entwicklungen nach sich zieht.12
1.2 Regulierende Prinzipien:
1. Monopolkontrolle und Verhinderung der Gründung solcher sowie Steuerung unvermeidbarer Monopolbildungen
2. Korrektur der marktbedingten Einkommensverteilung durch progressive Besteuerung mit Rücksicht auf investitionsgeneigte Unternehmen
3. Garantie sozialer Mindeststandards wie Arbeitszeitregelung, Mindestlohn, Regelung von Frauen- und Kinderarbeit.
4. Schutz natürlicher Quellen vor Raubbau
2. Die Relativierung
Schließlich soll erläutert werden, inwieweit und durch welche politischen Akteure das Konstrukt der ordoliberalen Theorie „weitergedacht“ wurde.
Der Theoretiker Alfred Müller-Armack und der Wirtschaftspolitiker Ludwig Erhard gingen an eine teilweise Relativierung des Euckschen Ansatzes heran. Vor allem Armack sah in den postulierten Grundprinzipien derWettbewerbsordnungund dersozialen Komponenteeine Schwierigkeit.„Im Müller-Armackschen Konzept sollen beide Prinzipien, das (freiheitliche) Markt- und das Sozialprinzip grundsätzlich gleichen Rang haben.“13Die sich gegenseitig ausgrenzenden Prinzipien „Markt“ und „sozial“ eint der Theoretiker dahingehend, daß wirtschaftliches Wachstum erforderlich sei, um so einen höheren Lebensstandard zu gewährleisten, welcher wiederum die Erfüllung sozialer Aufgaben erleichtert.
Erhard wiederum führte den Gedanken weiter, indem er das ordoliberale Konzept Walter Euckens stärker auf Leistung und Effektivität ausrichtet. Das Prinzip der ausschließlichen Konkurrenz findet nur noch als theoretisches Gedankenmodell statt, für wirtschaftliche Effizienz des Wettbewerbsgrades ist viel weniger das Kriterium der Vollständigkeit als das des Wachstums entscheidend. Hinsichtlich der regulierenden Prinzipien des Euckschen Modells verzichtet Erhard auf ausschließliche Monopolkontrolle, wenn die Verhinderung derer den Wachstumszielen widerspricht. Durch wirtschaftliche Konzentration erreichter Wohlstand ist nach Erhard sozialer als eine reine Wettbewerbspolitik.14
Walter Euckens Theorie wird also insofern modifiziert, als es nun heißt:‚Wettbewerb soweit wie möglich, Planung soweit wie nötig‘15
II. Staat und Grundgesetz in der Sozialen Marktwirtschaft
Neben jenen Faktoren, die eine Wirtschaftsordnung konstituieren und sie in ihrer Form aufrechterhalten - wie oben dargestellt - müssen ebenso solche Faktoren in die Betrachtung einbezogen sein, welche von außen her determinierend sind. Es wird also nachendogenenundexogenenFaktoren einer Wirtschaftsordnung differenziert.
1. Staatlicher Ordnungsrahmen
„Eine Demokratie im Rahmen einesfreiheitlichen Rechtsstaateserfordert die Gewährung relativ großer Spielräume für die Selbst- und Mitbestimmung der Staatsbürger und für die Entscheidungsfreiheit der Wirtschaftssubjekte“.16Im Gegensatz dazu ist es für einentotalitären Staatkennzeichnend, seine Bürger dem diktatorischen System weitestgehend unterzuordnen und dessen Entscheidungsfreiheit in die Hand einer zentralen Macht zu geben. In der Frage nach der Interdependenz von Staat und Wirtschaft geht Eucken von gegenseitiger Bedürftigkeit beider aus. Demnach bedarf die Wirtschaftspolitik einesstarken aktionsfähigen Staatesund umgekehrt. Voraussetzung für diesen aktionsfähigen Staat ist die Auflösung wirtschaftlich übermächtiger Cliquen beziehungsweise die strikte Beschneidung ihrer Funktionen durch die Politik. Im Zusammenspiel von Staat und Wirtschaftsordnung sollte die Tätigkeit des Staates auf „[...]die Gestaltung der Ordnungsformen der Wirtschaft gerichtet sein [und] nicht auf die Lenkung des Wirtschaftsprozesses.“17So ist der Staat zwar in der Lage, die die Wirtschaft beeinflussenden Gesetze zu erlassen, aber wohl kaum zur Führung des eigentlichen Wirtschaftsprozesses. „Handelsverträge zu schließen oder eine zureichende Geldordnung herzustellen - dazu ist der Staat mit seinen Organen imstande, aber nicht, den Außenhandel selbst zu dirigieren oder die Kreditgewährung im einzelnen zu lenken.“18Sobald also die staatliche Politik sich anmaßt, einen den wirtschaftlichen Alltag bestimmenden Interventionismus zu betreiben, gerät dieser selbst in den Sog des wirtschaftlichen Kampfes und wird somit in seiner Willensbildung und Eigenständigkeit geschwächt. Die Weiterführung des Gedankens liegt nahe. Will der Staat in einer wirtschaftlichen Ordnung einerseits die Fäden ziehen und parallel dazu nicht an Autorität und Entscheidungsspielraum einbüßen, „[...] so bleibt nur die Entwicklung zur Tyrannis.“19
Entscheidend ist es also, im Zusammenspiel von Staat und Wirtschaft nicht einer der beiden Komponenten der anderen vorzuzie hen, sondern ihren Aufbau gleichzeitig anzugehen.20Daß im Wechselspiel von Politik und Ökonomie enge Beziehungsverflechtungen vorherrschen, zeigt auch ein Blick auf die Parteiensysteme. Während in einemEinparteiensystemder Bürger keine Wahlalternativen und folglich keine Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen wirtschaftspolitischen Programmen vorfindet, können in einem Mehrparteiensystem unterschiedliche Präferenzen der Wähler - sei es durch Unterstützung der Opposition oder durch Interessensverbände - artikuliert werden.21
Ebenso ist die wirtschaftliche Ordnung an die Säule der Rechtsordnung gekoppelt, die folglich in die Betrachtung mit einbezogen werden muß.
2. Die verfassungsrechtlichen Vorgaben des Grundgesetzes
Ob das Recht nun als Naturrecht verstanden oder über die Gerechtigkeitsidee und positive Gesetzesformen identifiziert wird, determiniert es in jedem Fall das wirtschaftliche Handeln des Menschen. Vorrangige ökonomische Aufgabe des Rechts ist es, wirtschaftliches Handeln zu Lasten Dritter zu verhindern. Die Idee fußt auf dem Rechtsstaatsgedanken des ausgehenden 18. Jahrhunderts, wo die einsetzende Verfassungsbewegung erstmals eine Bindung des Staates an das Recht, die Garantie von Grund- und Freiheitsrechten und damit einhergehend auchökonomischeFreiheitsbestimmungen für den Staatsbürger postuliert. So lassen sich heute aus den politischen Verfassungen meist wirtschaftsrechtliche Bestimmungen ableiten, die in der Regel eine vollständigeWirtschaftsverfassungergeben.
Die Terminologie „Wirtschaftsverfassung“ ist insoweit zutreffend, als sich - beispielsweise in der Bundesrepublik - Gesetze vorfinden, die für die ökonomische Ordnung Grundrechtscharakter haben. „So wird beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland dasGesetz gegenWettbewerbsbeschränkungen oft alsMagna Charta der Marktwirtschaft bzw. des mikroökonomischen Bereichs und dasGesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstumsder Wirtschaft als Grundgesetz des makroökonomischen Bereichs bezeichnet.“22 Die rechtliche Ordnung steht mit der wirtschaftlichen Ordnung meist in engem Wechselspiel, da sowohl rechtliche Grundprinzipien die ökonomische Ausgestaltung determinieren, als auch die Wirtschaftsordnung die rechtlichen Inhalte für die Wirtschaft selbst vorprogrammiert.23 Ein markantes Beispiel für verfassungsrechtliche Vorgaben ökonomischer Relevanz ist die Freiheit der Gewerbe, welche sich aus den Artikeln 12 GG und 14 GG ableitet.
Berufsfreiheit und Gewährleistung von Eigentumsind demnach grundrechtliche Voraussetzungen und wirken zugleich einschränkend für das Selbstverständnis ökonomischen Handelns. So kann unter bestimmten Voraussetzungen die gewerbliche Freiheit in ihre Schranken gewiesen werden.24Noch grundlegender für wirtschaftliches Handeln ist Art.2 Abs.1GG, der dem Individuum freie Entfaltung seiner Persönlichkeit garantiert, soweit dies nicht die Rechte Dritter tangiert. Art.15GG wirkt zumindest auf den ersten Blick so, als ob die freiheitliche Wirtschaftsordnung nun doch stärker eingeschränkt sei: „[...]Naturschätze können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum [...] übergeführt werden.“ Doch gilt der Grundrechtskatalog als interdependente Gesamtheit und so erfährt auch Art.15GG eine Einschränkung in Art. 14 Abs.3GG.25
Wie etwa das sogenannte Apothekerurteil des Bundesverfassungsgerichtes, welches nicht nur in der Fachwelt einen heftigen Diskurs entfachte, liefert die Geschichte mehrere signifikante Beispiele höchstrichterlicher Entscheidungen, die in volkswirtschaftlicher Hinsicht interessant und bedeutend sind.
Als historisches Ereignis dieser Art ist beispielsweise die Kartell - Entscheidung des Reichsgerichts von 1897 zu nennen, wo „das damals höchste deutsche Gericht Kartelle unter bestimmten Bedingungen für zulässig erklärte.“26 Das wirtschaftspolitische Ergebnis war vorgezeichnet. Durch die erleichterte Kartellierung verlor die Wirtschaftsverfassung ihre Form, da mit dem richterlichen Beschluß eine Heranbildung ökonomischer Machtcliquen einherging und so die Zerstörung der marktwirtschaftlichen Ordnung möglich war. Parallel führte dies zu einer regelrechten Entwertung der Grundrechte, denn wennGewerbefreiheitunddas Recht aufindividuelle Entfaltungnur noch pro forma existieren, hat der einzelne Unternehmer wenig Chancen, im Kampf gegen das Diktat der Kartelle zu bestehen.27
III. Interdependenz der Ordnungen
Aus der Einzelbetrachtung von Staat und Grundgesetz in der Sozialen Marktwirtschaft wird bereits deutlich, daß eine Trennung der Ordnungen nicht funktionieren kann und die wirtschaftliche Ordnung als Teilordnung zu verstehen ist.
Folglich soll nun untersucht werden, inwieweit die Räder der politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Ordnung ineinandergreifen. Bis hin zum Euckschen Ansatz nimmt die Theorie der Interdependenz in der Geschichte verschiedenste Formulierungen an. So ist nachMarxeine Dependenz staatlicher- und rechtlicher Ordnungen von der herrschenden Klasse unumgänglich, während beiHegel„die wirtschaftliche Macht und die Eigengesetzlichkeit des ‚universalen Egoismus’(Hegel) in marktwirtschaftlichen Systemen“28 derartige Gefahren bergen, daß der demokratische Staat uneingeschränkt handlungsfähig sein soll. Daß wirtschaftliche Effektivität überhaupt gegeben ist, ist eineTeilung der Gewalten zwischen Wirtschaft und Staaterforderlich - etwa gleich der Trennung zwischen Legislative, Exekutive und Judikative. Staatlich unabhängige Bürger sind daher ebenso Grundvoraussetzung wie eine politische Eigenständigkeit des Staates gegenüber der Wirtschaft.
Die staatliche Ordnungspolitik muß also der Entstehung und falschen Handhabung wirtschaftlicher Macht entgegenkommen und aktiven Wettbewerb weitestgehend ermöglichen, sowie das Wirtschaftsrecht die rechtsstaatlichen Grundprinzipien zur Geltung zu bringen hat.29Ein Beispiel: Als man bei der Besetzung Deutschlands im Jahre 1945 im Westen und Osten unterschiedliche politische Systeme installierte, wurden ebenfalls die Wirtschaftsordnungen beider deutscher Staaten durch die staatlich - politischen Ordnungen geprägt. Daß aber ebenso die Wirtschaft rückwirkend den politischen Prozeß determiniert, erklärt die Erkenntnis, daß die Entstehung monopolistischer Machtgruppen den Staat weitgehend beeinflussen kann.30„Die Monopolbildung kann durch den Staat selbst provoziert werden, etwa durch seine Patentpolitik, seine Steuerpolitik usw. [...] Erst begünstigt der Staat die Entstehung privater wirtschaftlicher Macht und wird dann von ihr teilweise abhängig.“31
Nach der deutschen Wiedervereinigung meldeten einige EU - Mitgliedstaaten ihre Bedenken gegen ein zu übermächtiges Deutschland an. Ein gewichtiges Gegenargument zu Einwänden dieser Art liefert das Ziel der Europäischen Gemeinschaft, „die politische Macht der Staaten und die wirtschaftliche Macht der Unternehmen anRechtsregeln zu binden“32. Damit bringt die Konstituierung eines wirtschaftlichen Grundrechtskatalogs auf EU- Ebene - insbesondere durch den EWG - Vertrag - die Möglichkeit für Bürger und Unternehmen, ihr Recht in der Gemeinschaft geltend zu machen. Die wohl wichtigsten Rechte fußen auf denkonstituierenden Prinzipien der Freiheit:Waren- und Dienstleistungsverkehr, Niederlassungsfreiheit, Freizügigkeit des Systems und unverfälschter Wettbewerb.33
IV. Das Subsidiaritätsprinzip des EGV
Der Begriff der Subsidiarität im Vertrag über die Europäische Union steht für starke, föderale Strukturen gegenüber einer oftmals beklagten Bürgerferne in der Gemeinschaft. Mit Art. 3bEGV soll nunmehr die oft undurchsichtige Zuständigkeitsgrenze zwischen Mitgliedstaaten und Gemeinschaft präziser formuliert und angewendet werden. In dem ursprünglich aus der katholischen Soziallehre stammenden Prinzip ist nicht eine statische Kompetenzregelung unter verschiedenen Gemeinschaften beabsichtigt, sondern ein dynamischer Prozeß von Zuständigkeiten, in welchem die untere Einheit das Erstzugriffsrecht besitzt - also bevorzugt wird. Laut Art.3EGV wird „[die] Gemeinschaft innerhalb der Grenzen der ihr in diesem Vertrag zugewiesenen Befugnisse und gesetzten Ziele tätig.“ Betrachtet man die inhaltliche Formulierung weiter, ergibt sich - aus wirtschaftlicher Sicht und somit relevant für die Thematik der vorliegenden Arbeit - eine Schwachstelle des Subsidiaritätsprinzips: „In den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, wird die Gemeinschaft nach dem Subsidiaritätsprinzip nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und daher wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können.“ Somit schließt Art.3bEGV „[...]die Politikfelder, in denen die EU die ausschließliche Zuständigkeit hat - dies sind Agrar-, Verkehrs-, Wettbewerbs und Handelspolitik - von der strikten Anwendung des Subsidiaritätsprinzips aus.“34Ein weiterer Punkt ist mit Sicherheit die Frage, wie man seitens der EU bezüglich der Verschiedenartigkeit der Mitgliedstaaten verfahren will. Gesetzt, ein Gemeinschaftshandeln wird nach Art.3bEGV erforderlich - wie ist bei Mitgliedstaaten von unterschiedlicher Größe und Wirtschaftskraft vorzugehen?35
Im Subsidiaritätsprotokoll des Vertrages von Amsterdam versuchte der Europäische Rat, das Prinzip samt seiner Unklarheiten weiter zu konkretisieren. Kritik wurde vor allem aus deutschen Ländern laut, die sich auf die nur allgemeine Formulierung des Art.3bEGV bezog.
Die vier wichtigsten Klarstellungen:
- Jedes EU - Organ ist verpflichtet, dasPrinzip der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit (Maßnahmen der Union dürfen nicht über das für die Erreichung der Vertragsziele erforderliche Maß hinausgehen) zu beachten
- Die beiden Bedingungen des Prinzips - dieNotwendigkeits- und dieBesser - Klausel- müssen erfüllt sein
- Maßnahmen der Union sollen in möglichst einfacher Form ausfallen
- Bevor es zu einem Vorschlag der Kommission kommt, muß sie Anhörungen durchführen und die betreffenden Unterlagen veröffentlichen.36
Literatur
Mankiw, Nicholas Gregory: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Schäffer-Poeschel, Stuttgart 1999
Müller, Helmut M.: Deutsche Geschichte in Schlaglichtern. 3., überarbeitete Auflage - Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Meyers Lexikonverlag 1996
Görtemaker, Manfred: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Von der Gründung bis zur Gegenwart, Beck´sche Verlagsbuchhandlung, München 1999
Pilz, F./ Ortwein, H.: Das politische System Deutschlands. Systemintegrierende Einführung in das Regierungs-, Wirtschafts-, und Sozialsystem, 2. Auflage, R. Oldenbourg Verlag München; Wien, 1997
Peters, Hans-Rudolf: Einführung in die Theorie der Wirtschaftssysteme, R. Oldenbourg Verlag GmbH, München; Wien; Oldenbourg, 1987
Eucken, Walter: Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 6., durchges. Aufl., J.C.B. Mohr (Paul Siebek) Tübingen 1990
Haufe - Wirtschafts Lexikon kompakt: alle wichtigen Begriffe aus Wirtschaft, Steuern, Recht. -
2. Aufl., Freiburg i. Br.: Haufe, 1998
Gutmann/Hochstrate/Schlüter: Die Wirtschaftsverfassung der Bundesrepublik Deutschland. Entwicklung und ordnungspolitische Grundlagen, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1964
Piazolo, M.: Die Europäische Union: ein Überblick, München: Akad. Verl., 1997
Thiel, Elke: Die Europäische Union. Aktualisierung: Die EU nach dem Europäischen Rat von Amsterdam, Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, München, 1997
Proseminar: Die Wirtschaftsordnung der BRD, Prof. Dr. ZippelThema: Die Soziale Marktwirtschaft
Matthias Höpfl
Zum Subsidiaritätsprinzip
Allgemeiner Grundsatz:
Politisches Prinzip, nach dem die übergeordnete Einheit Nur solche Aufgaben an sich ziehen darf, zu denen unter- Geordnete Einheiten nicht in der Lage sind.
Voraussetzungen für Anwendbarkeit in der EG (Art.3b)
Keine ausschließliche Kompetenz der EG+
Bessere Erledigung einer Aufgabe durch EG
Probleme bei der Umsetzung
Justiziabilität Prüfungs Auslegungs Heterogenität der
EuGH oder maßstab monopol Mitgliedstaaten
nationale Effizienz Kommission Kleine oder große
Gerichte? oder oder Mit- Mitgliedstaaten
günstige gliedstaaten? entscheidend?
Finanzen?
Quelle: Piazolo, M.: Die Europäische Union. Ein Überblick, S. 28
[...]
1Mankiw, Nicholas Gregory: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Schäffer-Poeschel, Stuttgart 1999,
S. 167
2Smith, Adam: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, in: Mankiw, Nicholas Gregory: a.a.O., S. 167
3Müller, Helmut M.: Deutsche Geschichte in Schlaglichtern. 3., überarbeitete Auflage - Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Meyers Lexikonverlag 1996, S. 352
4Görtemaker, Manfred: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Von der Gründung bis zu Gegenwart, Beck´sche Verlagsbuchhandlung, München 1999, S. 152
5 Görtemaker, Manfred: a.a.O., S. 152
6Vgl. Pilz, F./ Ortwein, H.: a.a.O., S. 250
7Pilz, F./ Ortwein, H.: 250Das politische System Deutschlands. Systemintegrierende Einführung in das Regierungs-, Wirtschafts- und Sozialsystem, 2. Auflage, R. Oldenbourg Verlag München; Wien, 1997,
S. 250
8Pilz, F./ Ortwein, H.: a.a.O., S. 250
9 Peters, Hans-Rudolf: Einführung in die Theorie der Wirtschaftssysteme, München; Wien: Oldenbourg, 1987, S. 81
10Vgl. Peters, Hans-Rudolf: a.a.O., S. 82
11Pilz, F./ Ortwein, H.: Das politische System Deutschlands. Systemintegrierende Einführung in das
Regierungs-, Wirtschafts- und Sozialsystem, 2. Auflage, R. Oldenbourg Verlag München; Wien, 1997,
S. 252
12 Vgl. Peters, Hans-Rudolf: a.a.O., S. 85
13Pilz, F./ Ortwein, H.: Das politische System Deutschlands. Systemintegrierende Einführung in das
Regierungs-, Wirtschafts- und Sozialsystem, 2. Auflage, R. Oldenbourg Verlag München; Wien, 1997,
S. 254
14Vgl. Pilz, F./ Ortwein, H.: a.a.O., S. 245/255
15Pilz, F./ Ortwein, H.: Das politische System Deutschlands. Systemintegrierende Einführung in das
Regierungs-, Wirtschafts- und Sozialsystem, 2. Auflage, R. Oldenbourg Verlag München; Wien, 1997,
S. 255
16 Peters, Hans-Rudolf: Einführung in die Theorie der Wirtschaftssysteme, R. Oldenbourg Verlag GmbH, München; Wien: Oldenbourg 1987, S. 36/37
17Eucken, Walter: Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 6., durchges. Aufl., J.C.B. Mohr (Paul Siebek) Tübingen 1990, S. 336
18Eucken, Walter: Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 6., durchges. Aufl., J.C.B. Mohr (Paul Siebek) Tübingen 1990, S. 336/337
19Eucken, Walter: Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 6., durchges. Aufl., J.C.B. Mohr (Paul Siebek) Tübingen 1990, S. 337
20Vgl. Eucken, Walter: a.a.O., S. 334 - 338
21 Vgl. Peters, Hans-Rudolf: a.a.O., S. 38
22Peters, Hans-Rudolf: Einführung in die Theorie der Wirtschaftssysteme, R. Oldenbourg Verlag GmbH, München; Wien: Oldenbourg 1987, S. 39
23Vgl. Peters, Hans-Rudolf: a.a.O., S. 40
24Haufe-Wirtschafts Lexikon kompakt: alle wichtigen Begriffe aus Wirtschaft, Steuern, Recht. - 2. Aufl., Freiburg i.Br.: Haufe, 1998, S. 139
25 Gutmann/Hochstrate/Schlüter: Die Wirtschaftsverfassung der Bundesrepublik Deutschland. Entwicklung und ordnungspolitische Grundlagen, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1964, S. 15
26Peters, Hans-Rudolf: Einführung in die Theorie der Wirtschaftssysteme, R. Oldenbourg Verlag GmbH, München; Wien: Oldenbourg 1987, S. 39
27Vgl. Peters, Hans-Rudolf: a.a.O., S. 39/40
28Mestmäcker E.J.: Vorwort zur Neuausgabe 1990, in : Eucken, Walter: Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 6., durchges. Aufl., J.C.B. Mohr (Paul Siebek) Tübingen 1990
29 Vgl. Mestmäcker E.J.: a.a.O.
30Vgl. Eucken, Walter: a.a.O., S. 182/183
31Eucken, Walter: Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 6., durchges. Aufl., J.C.B. Mohr (Paul Siebek) Tübingen 1990, S. 183
32Mestmäcker E.J.: Vorwort zur Neuausgabe 1990, in : Eucken, Walter: Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 6., durchges. Aufl., J.C.B. Mohr (Paul Siebek) Tübingen 1990
33 Vgl. Mestmäcker E.J., a.a.O.
34Piazolo, M.: Die Europäische Union: ein Überblick, Müchen: Akad. Verl., 1997, S. 26/27
35Vgl. Piazolo, M.: a.a.O., S. 27
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernaussage des Textes über die Soziale Marktwirtschaft?
Der Text analysiert die Effizienz freier Märkte, die theoretische Konzeption des Ordoliberalismus und seine Umsetzung in der Sozialen Marktwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland. Er untersucht die Rolle des Staates und des Grundgesetzes in dieser Wirtschaftsordnung und betont die Interdependenz von politischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Ordnung.
Was sind die konstituierenden Prinzipien des Ordoliberalismus laut Eucken?
Laut Walter Eucken umfassen die konstituierenden Prinzipien des Ordoliberalismus die Schaffung und Sicherung eines funktionsfähigen Marktpreissystems, die Gewährleistung des Privateigentums an Produktionsmitteln, freien Zugang zu den Märkten, die Identität der Dispositionsfreiheit des Unternehmers mit dessen voller Haftung sowie eine konstante Wirtschaftspolitik.
Welche regulierenden Prinzipien werden im Ordoliberalismus genannt?
Die regulierenden Prinzipien umfassen Monopolkontrolle und Verhinderung der Gründung solcher, Korrektur der marktbedingten Einkommensverteilung durch progressive Besteuerung, Garantie sozialer Mindeststandards und Schutz natürlicher Ressourcen vor Raubbau.
Wie unterscheidet sich die Umsetzung des Ordoliberalismus durch Erhard und Müller-Armack von Euckens ursprünglicher Theorie?
Alfred Müller-Armack betonte die Gleichrangigkeit von Wettbewerbsordnung und sozialer Komponente. Ludwig Erhard richtete das Konzept stärker auf Leistung und Effektivität aus und relativierte die ausschließliche Monopolkontrolle zugunsten von Wirtschaftswachstum.
Welche Rolle spielt der Staat in der Sozialen Marktwirtschaft nach Eucken?
Eucken sieht den Staat als gestaltenden Akteur der Ordnungsformen der Wirtschaft, der jedoch nicht in den Wirtschaftsprozess selbst lenkend eingreifen soll. Er soll einen ordnungspolitischen Rahmen schaffen und die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs gewährleisten.
Welche verfassungsrechtlichen Vorgaben des Grundgesetzes sind für die Soziale Marktwirtschaft relevant?
Die Freiheit der Gewerbe (Art. 12 GG und 14 GG), die freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) und das Eigentumsrecht sind grundrechtliche Voraussetzungen, die das wirtschaftliche Handeln einschränken und gestalten.
Was bedeutet Interdependenz der Ordnungen im Kontext der Sozialen Marktwirtschaft?
Interdependenz der Ordnungen bedeutet, dass die politische, wirtschaftliche und rechtliche Ordnung eng miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen. Die wirtschaftliche Ordnung wird als Teilordnung betrachtet, die von staatlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen geprägt ist.
Was ist das Subsidiaritätsprinzip des EGV und welche Rolle spielt es in der Europäischen Union?
Das Subsidiaritätsprinzip (Art. 3b EGV) besagt, dass die Europäische Union nur dann tätig werden soll, wenn die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können. Es soll eine bürgernahe und föderale Struktur der EU gewährleisten.
Welche Kritik gibt es am Subsidiaritätsprinzip?
Kritisiert wird, dass die Zuständigkeitsgrenzen zwischen Mitgliedstaaten und Gemeinschaft oft unklar sind und dass das Subsidiaritätsprinzip in Politikfeldern mit ausschließlicher Zuständigkeit der EU (z.B. Agrar-, Verkehrs-, Wettbewerbs- und Handelspolitik) nicht uneingeschränkt angewendet wird.
- Citar trabajo
- Matthias Höpfl (Autor), 2001, Die Soziale Marktwirtschaft der BRD, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103254