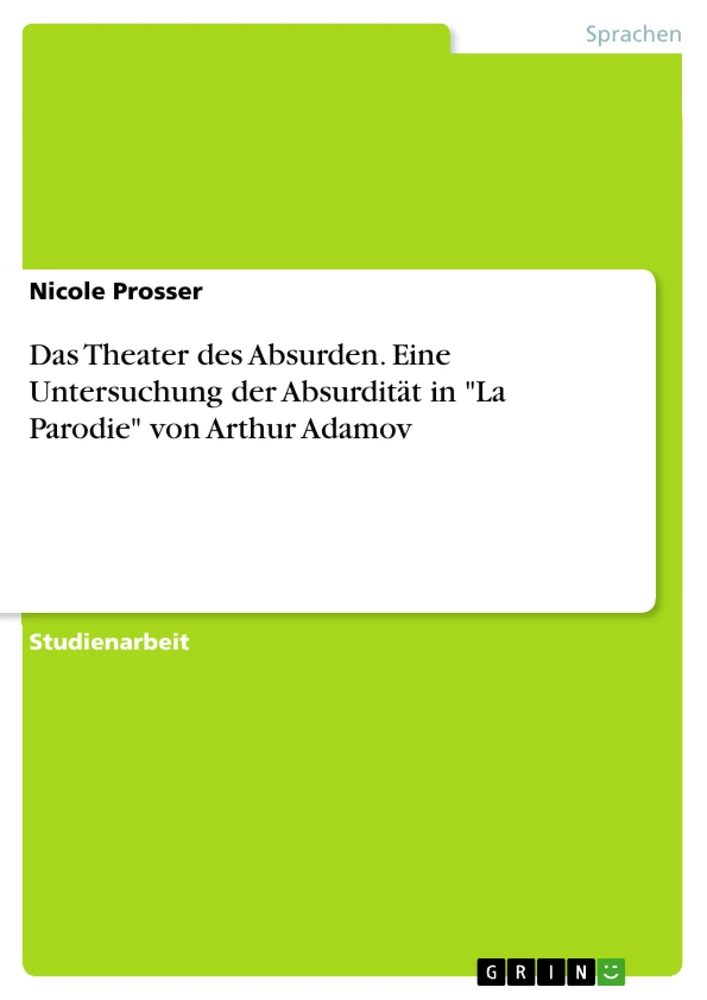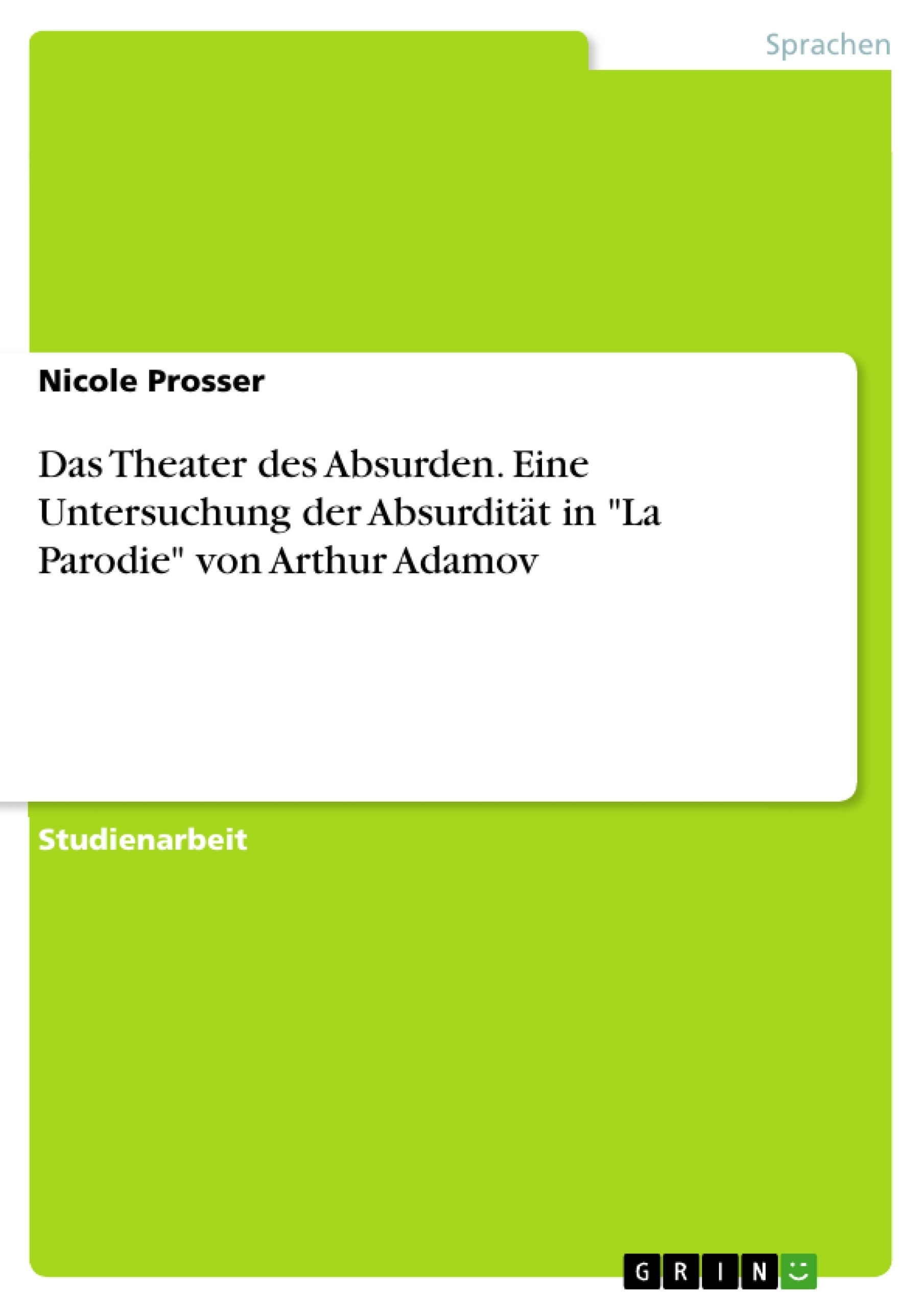Der Dramatiker Arthur Adamov wird nicht nur der Avantgarde des 20. Jahrhunderts zugeordnet, sondern spätestens seit der Veröffentlichung von Martin Esslins Buch „Das Theater des Absurden“ wird Adamov zudem gemeinsam mit Beckett und Ionesco als einer der wichtigsten Vertreter eines Theater des Absurden gesehen. Dennoch scheint es schwierig, den Begriff des Absurden auszuklammern, wenn man eines seiner frühen Stücke analysieren möchte.
Adamov sah im Theater vor allem die Möglichkeit, seinen inneren psychischen Zwängen Ausdruck zu verleihen. Das Gefühl, entfremdet und getrennt zu sein von der Welt, innere Zweifel und Selbsthass lagen vielen seiner Stücke zu Grunde. Adamov, welcher zeitlebens unter schweren Neurosen litt, sah im Schreiben darüber hinaus auch eine Art Selbsttherapie: Indem er seinen krankhaften Gefühlen und Gedanken Ausdruck verlieh, konnte er diese zum Teil sogar überwinden. Auch wenn es nicht Adamovs Intention gewesen sein mag, ein „Theater des Absurden“ zu kreieren, so hilft es uns, sein Stück unter jenen Aspekten zu betrachten, die diese Bezeichnung mit sich bringt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung
- Adamovs Leben und Werk: Von der Absurdität zur Revolte
- Das Theater des Absurden
- Adamovs erstes Stück: La Parodie
- Dramenanalyse
- Figurenkonzeption
- Figurencharakterisierung
- Dialog und Sprache: Über die Unmöglichkeit zwischenmenschlicher Kommunikation
- Handlung: La Présence de l'absence
- Raum und Requisiten
- Zeit: L'horloge sans aiguilles
- Schlussbetrachtungen
- La Parodie - Une parodie de quoi?
- Wirkungsabsicht: Rechtfertigung und Revolte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, Arthur Adamovs frühes Stück „La Parodie“ im Kontext des Theaters des Absurden zu analysieren und seine Bedeutung in der Entwicklung des Dramatikers aufzuzeigen. Adamov, der zeitlebens mit existenziellen Fragen und psychischen Problemen kämpfte, suchte im Theater einen Ausdruck für seine inneren Zwänge und ein Mittel zur Selbsttherapie. Seine frühen Werke spiegeln die Absurdität der menschlichen Existenz, die Unmöglichkeit menschlicher Kommunikation und die Fragilität der Identität wider.
- Die Absurdität der menschlichen Existenz und der Suche nach Sinn
- Die Unmöglichkeit zwischenmenschlicher Kommunikation und das Scheitern von Beziehungen
- Die Fragilität der Identität und die Auswirkungen von psychischen Belastungen
- Die Rolle des Theaters als Mittel zur Selbsttherapie und zur Bewältigung existenzieller Krisen
- Der Einfluss des Theaters des Absurden auf Adamovs Schaffen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen Überblick über Adamovs Werk und seine Bedeutung im Kontext des Theaters des Absurden. Es wird dargelegt, wie Adamov seine inneren Konflikte und die Absurdität des Lebens in seinen Theaterstücken thematisierte.
Die Dramenanalyse konzentriert sich auf die Figurenkonzeption, die Figurencharakterisierung, den Dialog und die Sprache, die Handlung, den Raum und die Requisiten sowie die Zeit in „La Parodie“. Es wird aufgezeigt, wie Adamov die Absurdität der menschlichen Existenz durch die Verwendung von reduzierter Handlung, schemenhaften Figuren und sinnfreien Dialogen darstellt.
Die Schlussbetrachtungen untersuchen die Parodie in Adamovs Stück und die Wirkungsabsicht des Autors. Es wird gezeigt, dass Adamov durch die Darstellung der Absurdität des Lebens gleichzeitig eine Kritik an den gesellschaftlichen Normen und den Konventionen der Theatertradition übte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Theater des Absurden, Absurdität der menschlichen Existenz, Unmöglichkeit menschlicher Kommunikation, Fragilität der Identität, Selbsttherapie, existenzielle Krisen, Arthur Adamov, La Parodie, Dramenanalyse.
- Quote paper
- Nicole Prosser (Author), 2017, Das Theater des Absurden. Eine Untersuchung der Absurdität in "La Parodie" von Arthur Adamov, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1032521