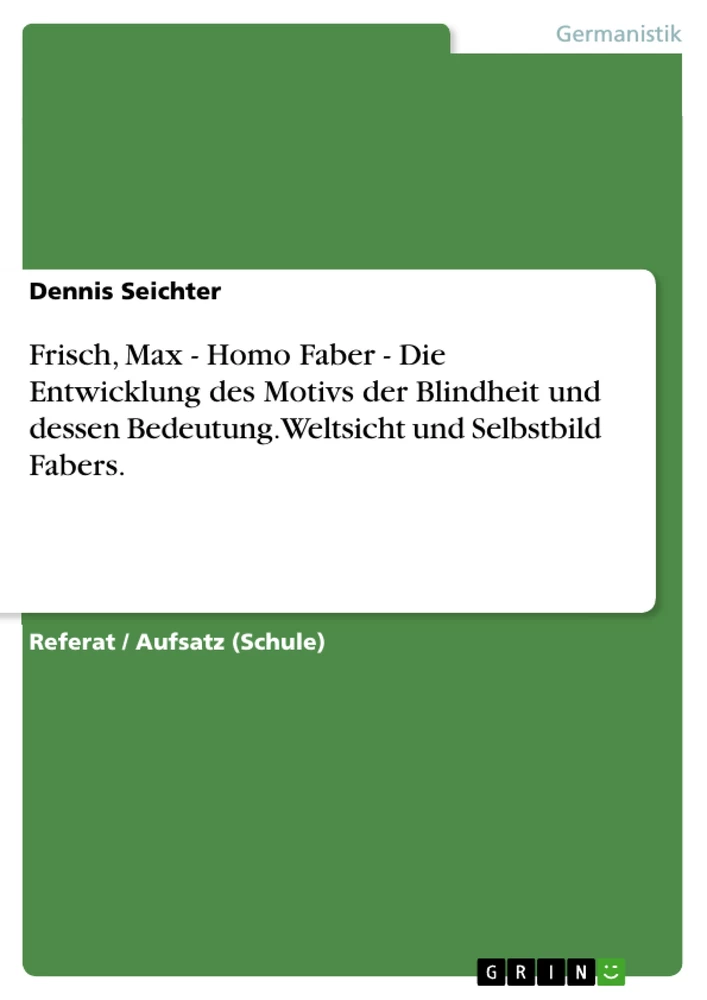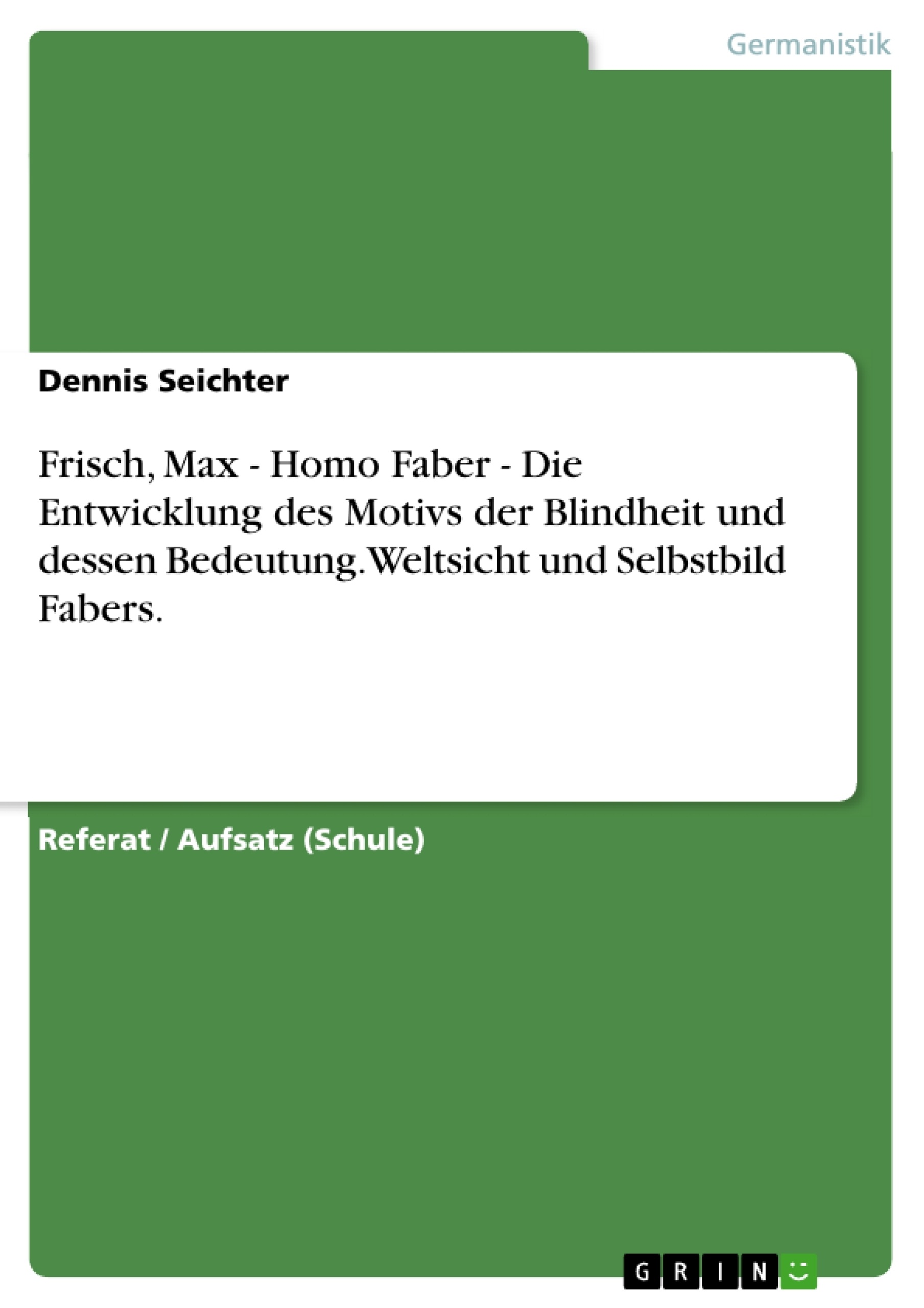Was bedeutet es, blind zu sein für die Wahrheit, für das eigene Leben? Walter Faber, der rationale Techniker, dessen Weltbild auf Wahrscheinlichkeiten und Berechenbarkeit basiert, sieht sich plötzlich mit dem unvorstellbaren Schmerz des Verlustes konfrontiert. Nach einer lebensverändernden Begegnung mit Sabeth und dem Wiedersehen mit Hanna, droht sein sorgfältig konstruiertes Weltbild zu zerbrechen. In einer Schlüsselszene, geplagt von Schuldgefühlen und der Erkenntnis seiner emotionalen Verblendung, flieht Faber vor der Realität und sinniert über die Auslöschung seines Augenlichts. Diese tiefgreifende Krise, die im Düsseldorfer Stadtverkehr ihren Anfang nimmt und sich in der klaustrophobischen Atmosphäre eines Zuges fortsetzt, markiert den Beginn einer schmerzhaften Selbstfindung. Der Roman thematisiert aufwühlend die Auseinandersetzung mit Schuld, die Suche nach Identität und die Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit. Fabers Reise ist nicht nur eine physische, sondern vor allem eine seelische Odyssee, die ihn zwingt, die Grenzen seiner technischen Weltsicht zu erkennen und sich der Komplexität menschlicher Beziehungen und Gefühle zu stellen. Eine Geschichte über die Blindheit der Vernunft und die schmerzhafte Geburt eines neuen Bewusstseins, in der die Motive von Schuld, Sühne und der Möglichkeit einer späten Läuterung auf bewegende Weise verhandelt werden. Begleiten Sie Faber auf seiner Reise durch innere und äussere Landschaften, auf der Suche nach Wahrheit und Erlösung. Ein ergreifender Roman über die Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz und die Kraft der Liebe, der den Leser bis zur letzten Seite fesselt. Eine packende Analyse der menschlichen Psyche und ein Spiegelbild der modernen Gesellschaft, die von Technik und Fortschritt getrieben wird, aber die essentiellen Fragen des Lebens oft übersieht. Tauchen Sie ein in Fabers Welt, in der sich die Abgründe der Seele und die Schönheit der Erkenntnis auf einzigartige Weise begegnen.
Klassenarbeit 11. Klasse Aufgabenstellung:
Text: S. 192 oben ("Ich ging in das Vorzimmer...") bis S. 192 Mitte ("..., um meine Augen loszuwerden?")
Schreibe einen zusammenhängenden Interpretationsaufsatz, in dem du die aufgeführten Aspekte berücksichtigst. Ordne die Textstelle ganz kurz in den Handlungszusammenhang ein.
Fasse den Inhalt des Abschnittes kurz zusammen und stelle von dieser Textstelle aus dar
- welche Überzeugungen Fabers Weltsicht und Selbstbild bis zu diesem Augenblick geprägt haben
- inwiefern Faber hier zu einer veränderten Einstellung gefunden hat
- die Entwicklung des Motivs der Blindheit und dessen Bedeutung
Belege deine Aussagen unbedingt am Text! Du kannst natürlich auch noch andere Textstellen heranziehen.
Die angegebene Textstelle auf S. 192 beschreibt, wie Faber fluchtartig die Vorführung des von ihm aufgezeichneten Films von Joachims Leiche wegen angeblicher Magenschmerzen absagt und fluchtartig die ehemalige Firma von Joachim verlässt.
Er läuft daraufhin ziellos durch den Verkehr von Düsseldorf und kauft sich am Bahnhof irgendeine Fahrkarte, ohne zu wissen wohin er fahren will.
Im Speisewagen des Zuges fällt er in tiefe Depression und trägt sich mit dem Gedanken, sich beide Augen auszustechen weil er ja doch nichts mehr zu sehen habe.
Die Textstelle steht kurz nach seinem Aufenthalt in Kuba, wo er zum ersten Mal aus eigenem Antrieb die Welt um sich wirklich wahrnimmt und für kurze Zeit sein Leben genießt. Unmittelbar vor der Textstelle steht jedoch jene Szene, in der er mit dem jungen Techniker seine Filmspulen durchsieht, auf denen er Sabeth noch einemal sieht, was ihm auf unmittelbare Weise den Verlust klar macht, den er erlitten und zum Teil selbst verschuldet hat.
Das Selbstbild Walter Fabers ist bis zu dieser Textstelle auf S. 192 von einer großen Selbstsicherheit geprägt. Er nimmt für sich in Anspruch, allein mit Hilfe von Technik und Formeln alles erklären und somit mit jeder Situation fertig werden zu können. Er sieht in sich selbst den Prototyp des Technikers, der die Natur beherrscht.
Dies hat auch unmittelbaren Einfluss auf sein Welt- und Frauenbild. Die Welt ist für ihn nichts anderes als eine Ansammlung von erklärbaren Dingen. Er kann nicht verstehen wie man, um ein Beispiel zu nennen, in den Felsen der mexikanischen Wüste "urweltliche Tiere" und "Dämonen" (S.24) sehen kann. Er weigert sich schlicht, sich solche "weibischen" (S.24) Dinge einzubilden.
Solche Phantasien sind für ihn Sache der Frauen, ebenso wie der Glaube an Schicksal und Mystik. Er erklärt sich alles anhand von Wahrscheinlichkeiten, konkret sagt er dies auf S.22, wo er umfangreich erklärt, dass durch eine Wahrscheinlichkeitsberechnung schon alle Möglichkeiten abgedeckt seien und somit keine Notwendigkeit für irgendwelchen Aberglauben bestehe. Selbst als Sabeth im Krankenhaus liegt, versucht er Hanna durch die Statistik der Mortalitätsrate bei Schlangenbissen zu beruhigen, da simit die Chance, dass sie überlebe, sehr groß sei.
Und damit sind wir an dem Punkt, der eben dieses Weltbild und den alleinigen Glauben an die Mathematik einstürzen lässt. Denn Sabeth stirbt, doch nicht an dem Schlangenbiss, sondern an dem Sturz über die Brüstung, als sie vor Faber zurückgewichen ist. Diese Sache hatte Faber verschwiegen, und somit schlicht und einfach aus seinem Bewußtsein, aus seinen Berechnungen verdrängt.
Seit er Sabeth kennen und lieben gelernt hat, hat sich sein Blick sowieso zumindest erweitert. Er weigert sich zwar oft noch, wie bei bei der Erinnye, die durch den speziellen Lichteinfall wie lebendig zu wirken scheint (S.111), die Dinge mit Sabeths romantischem Blick zu sehen, doch er ist dem nicht mehr vollständig verschlossen.
Sabeth scheint mehr und mehr eine Seite von Faber hervorzubringen, die er bisher verdrängt hat. Als Sabeth jedoch unter anderem durch Fabers Verschulden stirbt, sieht er sich in ein Loch gestürzt. Dazu kommt noch das Wiedersehen mit Hanna, was eine weitere enorme psychische Belastung für ihn darstellt. Er flüchtet sich wieder in seine mathematische Welt, um sich selbst zu "beweisen", dass Sabeth nicht seine Tochter sein kann. Doch es gelingt ihm nicht mehr überzeugend. Als er schließlich in Düsseldorf seine alten Filmaufzeichnungen von Sabeth ansehen muß scheint etwas in ihm vollständig zu zerbrechen. Ihm wird die Sinnlosigkeit seiner Selbsttäuschung klar, der gigantische Fehler, den er Zeit seines Lebens begangen hat.
Er fühlt sich mit einem Male wie "blind" (S.192) und läuft völlig ziellos durch den Stadtverkehr von Düsseldorf, nachdem er mit einer Ausrede vor der Filmvorführung geflüchtet ist. Als er dann im Zug sitzt und aus dem Fenster sieht, wird ihm klar, dass er Sabeth nie wieder sehen wird, dass er sie für immer verloren hat.
Deshalb möchte er überhaupt nichts mehr sehen, er sieht keinen Sinn mehr in seinem Augenlicht. Er möchte nur noch "nie gewesen sein" und "die Augen loswerden" (S.192).
Dies ist zum einen ein deutlicher Bezug auf das Oedipusmotiv der griechischen Sagenwelt, zum anderen der Moment, in dem Faber selbst bewußt wird, dass er sich sein ganzes Leben lang selbst geblendet hat.
Dies ist schon ganz zu Beginn des Berichtes ersehbar, nämlich an der Stelle, wo beim Start der Maschine von La Guardia solch ein heftiger Schneesturm wütet, dass Faber sich "wie ein Blinder" vorkommt, weil er das Blinklicht des Flugzeugs nicht sehen kann, also in gewisser Weise ein Symbol für die Technik aus den Augen verliert.
Weiter ist die Filmmanie Fabers, das fast zwanghafte Festhalten von allem auf Zelluloid ein Symbol für die Blindheit Fabers. Er will der Natur auf diese Weise die Einmaligkeit des Moments nehmen und kann gleichzeitig alles durch die Distanz der Linsenoptik sehen, ohne direkt am Geschehen beteiligt sein zu müssen.
Nach seiner Zeit mit Sabeth legt er dieses Verhalten ab, am deutlichsten wird dies währen seines Aufenthaltes in Kuba. Dort sitzt er in einem Gewitter am Strand und lässt das Naturspektakel auf sich wirken (S.175). In den kurzen Lichtstößen der Blitze sieht er die "schwefelgrüne Palme im Sturm" und den Rest der Natur mit Sabeths Blick. Doch sofort danach, als es wieder dunkel um ihn ist, fühlt er sich "wie blind" (S.175).
Auf diese Textstelle findet sich ganz am Ende des Buches, kurz vor der wahrscheinlich tödlichen Operation, ein Rückbezug. In einem fast verklärt wirkenden Abschnitt definiert Faber das "auf der Welt sein" mit "im Licht sein", dem "Licht standhalten" (S.199). Hier hat er endgültig erkannt, was für ihn das ganze Leben lang hätte zählen müssen, doch es wird ihm zu spät klar. Durch Sabeth ist er zwar näher zu sich selbst gekommen, doch mit ihrem Tod hat er das in gewisser Weise auch gleich wieder verloren. An dieser Stelle, auf S.199, wäre er wohl soweit gewesen ein neues Leben mit Hanna zu beginnen, doch seine "Sünden" der Vergangenheit holen ihn ein, schließkich hat er lange Zeit wegen seines naiven Glaubens, der Natur überlegen zu sein, sein Magenkrebsleiden ignoriert.
An den Schluß dieser Interpretation möchte ich noch zwei Zitate stellen, die meiner Meinung nach perfekt auf die Figur des Walter Faber passen:
"Man muß erst einmal ganz aus sich selbst heraus gegangen sein, um zu sich selbst zu finden."
und
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Klassenarbeit zur Interpretation der Textstelle aus dem Buch?
Die Klassenarbeit in der 11. Klasse befasst sich mit einer Textstelle aus einem Buch (S. 192), in der Faber die Vorführung eines Films von Joachims Leiche abbricht und ziellos durch Düsseldorf irrt. Er denkt über sein Leben nach und erwägt, sich die Augen auszustechen.
Welche Aspekte sollen bei der Interpretation berücksichtigt werden?
Der Interpretationsaufsatz soll folgende Aspekte behandeln:
- Einordnung der Textstelle in den Handlungszusammenhang
- Kurze Zusammenfassung des Inhalts
- Fabers Weltsicht und Selbstbild bis zu diesem Zeitpunkt
- Inwiefern Faber hier eine veränderte Einstellung entwickelt
- Die Entwicklung des Motivs der Blindheit und dessen Bedeutung
Die Aussagen sollen unbedingt mit Textstellen belegt werden.
Wie wird Fabers Selbstbild vor dieser Textstelle beschrieben?
Fabers Selbstbild ist geprägt von großer Selbstsicherheit. Er glaubt, alles mit Technik und Formeln erklären und somit jede Situation meistern zu können. Er sieht sich als Prototyp des Technikers, der die Natur beherrscht.
Wie beeinflusst das Fabers Welt- und Frauenbild?
Die Welt ist für Faber eine Ansammlung erklärbarer Dinge. Er kann Vorstellungen wie "urweltliche Tiere" oder "Dämonen" in Felsen nicht nachvollziehen und hält sie für "weibisch". Er erklärt alles durch Wahrscheinlichkeiten und lehnt Aberglauben ab. Selbst als Sabeth im Krankenhaus liegt, versucht er Hanna mit Statistiken zu beruhigen.
Welchen Einfluss hat Sabeth auf Fabers Weltbild?
Durch Sabeth erweitert sich Fabers Blickwinkel. Er weigert sich zwar oft, die Dinge mit ihrer romantischen Sichtweise zu betrachten, ist dem aber nicht mehr vollständig verschlossen. Ihr Tod und das Wiedersehen mit Hanna führen jedoch zu einer psychischen Belastung und dem Gefühl des Scheiterns seines Weltbildes.
Wie äußert sich das Motiv der Blindheit in der Textstelle?
Faber fühlt sich "blind" und möchte sich die Augen ausstechen, da er keinen Sinn mehr im Sehen sieht. Dies ist eine Anspielung auf das Ödipusmotiv und den Moment, in dem Faber erkennt, dass er sich sein Leben lang selbst geblendet hat.
Welche weiteren Beispiele für das Motiv der Blindheit werden im Text genannt?
Weitere Beispiele sind:
- Der Schneesturm beim Start in La Guardia, bei dem Faber das Blinklicht des Flugzeugs nicht sehen kann.
- Fabers Filmmanie, die ihm eine distanzierte Sicht auf die Welt ermöglicht.
- Die Beschreibung seines Gefühls in Kuba, sich "wie blind" zu fühlen, wenn es dunkel ist.
Wie wird das Motiv der Blindheit am Ende des Buches aufgegriffen?
Am Ende des Buches definiert Faber "auf der Welt sein" mit "im Licht sein", dem "Licht standhalten". Hier erkennt er, was für ihn hätte zählen müssen, aber es ist zu spät.
Welche Zitate passen laut dem Text perfekt auf Walter Faber?
Folgende Zitate werden genannt:
- "Man muss erst einmal ganz aus sich selbst heraus gegangen sein, um zu sich selbst zu finden."
- "Die Zeit verwandelt uns nicht. Sie entfaltet uns nur."
- Quote paper
- Dennis Seichter (Author), 2001, Frisch, Max - Homo Faber - Die Entwicklung des Motivs der Blindheit und dessen Bedeutung. Weltsicht und Selbstbild Fabers., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103226