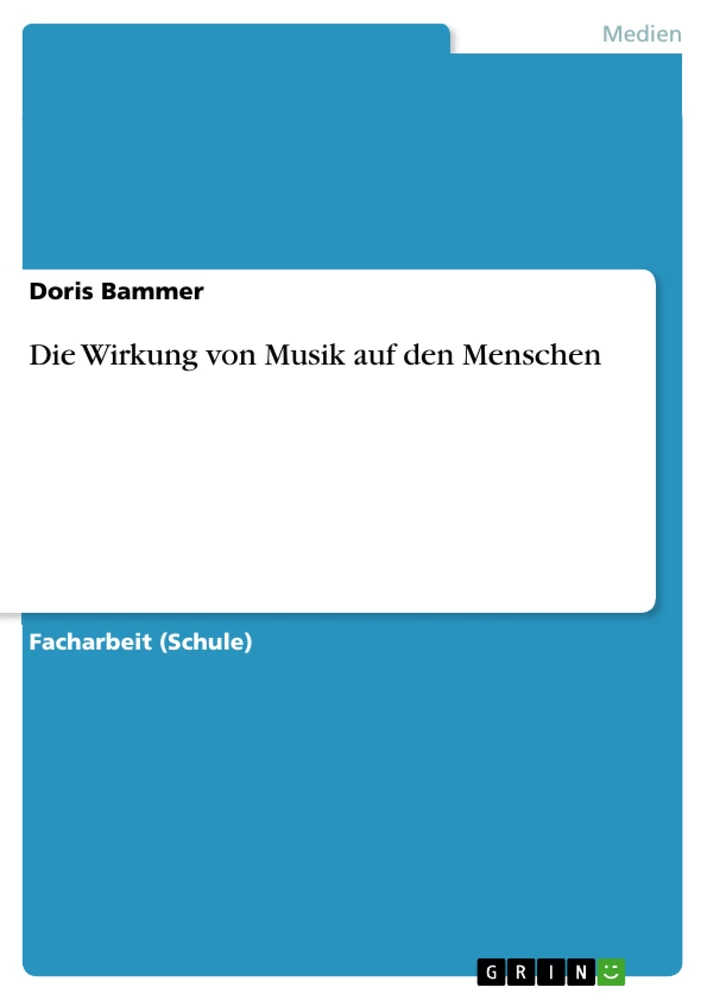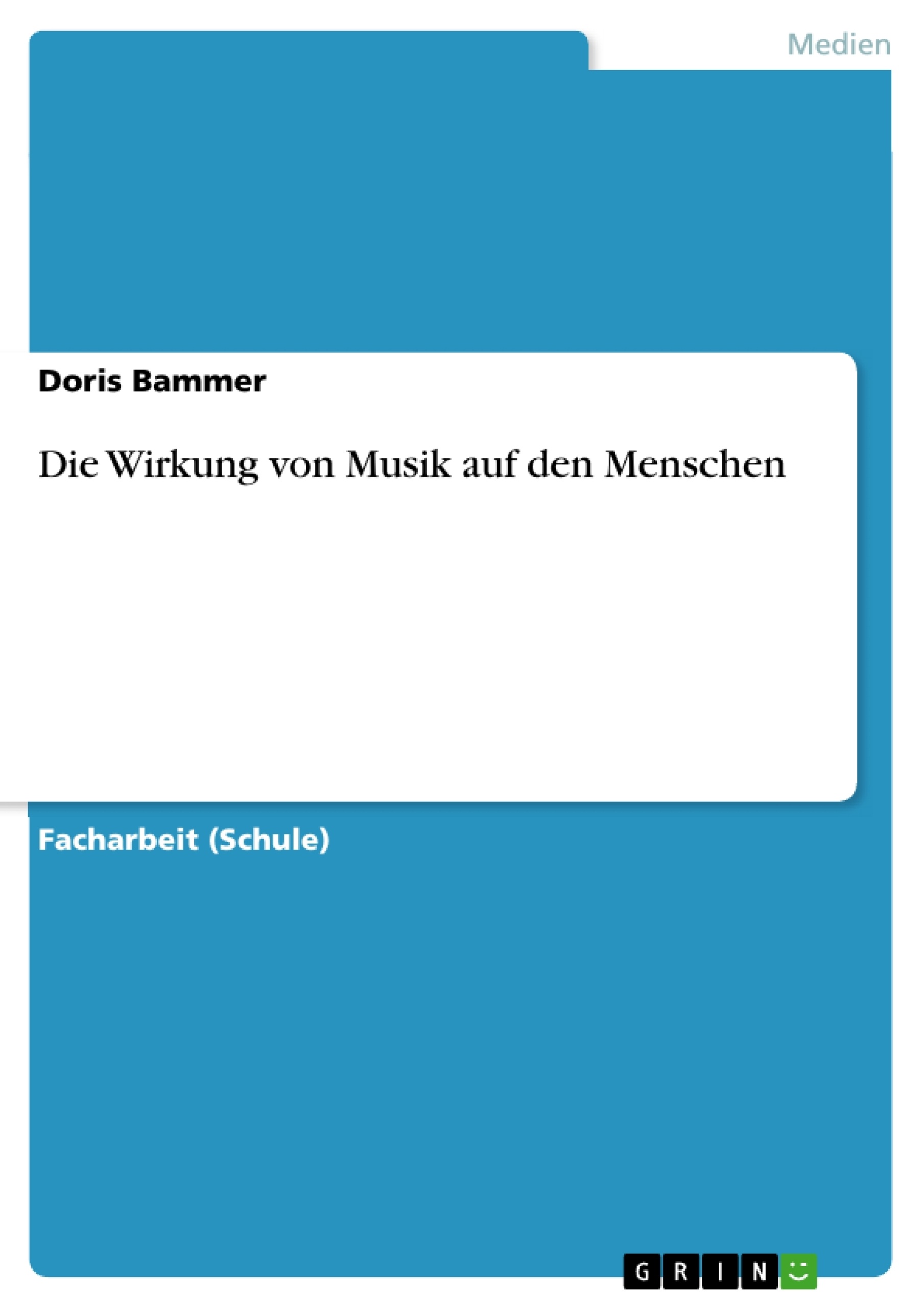Stellen Sie sich vor, Sie könnten die unsichtbaren Fäden der Musik greifen und damit nicht nur Ihre Seele berühren, sondern auch Ihren Körper heilen. Dieses Buch enthüllt die erstaunliche Macht der Musik, von ihren tiefgreifenden Auswirkungen auf unsere Physiologie bis hin zu ihrem Potenzial als therapeutisches Werkzeug. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Klänge Schmerzen lindern, Stress abbauen und sogar die Entwicklung von Säuglingen fördern können. Entdecken Sie, wie Musik unsere Herzfrequenz, unseren Blutdruck und unsere Gehirnaktivität beeinflusst, und lernen Sie die bahnbrechenden Erkenntnisse der auditiven Förderung kennen. Erfahren Sie mehr über die energetische Wirkung von Klängen und die heilende Kraft tibetischer Klangschalen und des Didgeridoos. Doch Vorsicht: Dieses Buch warnt auch vor den Gefahren des Lärms und der irreversiblen Hörschäden durch übermäßige Beschallung. Es ist eine Reise durch die faszinierende Welt der Musiktherapie, von den alten Weisheiten der Mönche bis zu den modernen Anwendungen in der Medizin. Ein Plädoyer für die Integration der Musik in unser Leben, nicht nur als Genuss, sondern als Schlüssel zur Selbstverwirklichung und zur Förderung sozialer Kompetenzen. Lassen Sie sich von den Erkenntnissen der Psychoakustik und den Auswirkungen akustischer Reize inspirieren und entdecken Sie, wie Sie die Kraft der Musik nutzen können, um Ihr Wohlbefinden zu steigern und Ihre Kreativität zu entfesseln. Ein unverzichtbarer Leitfaden für alle, die die transformative Kraft der Musik in ihrem Leben und in der Welt um sie herum verstehen und nutzen möchten, gespickt mit praktischen Anleitungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen, die jeden Musikliebhaber und jeden, der an der Heilkraft der Klänge interessiert ist, begeistern werden. Ergründen Sie die Geheimnisse der Obertonreihe und lernen Sie, wie Sie Ihre Wahrnehmungsfähigkeit schulen können, um die verborgenen Dimensionen der Musik zu entdecken. Dieses Buch ist mehr als nur eine wissenschaftliche Abhandlung – es ist eine Einladung, die Musik in all ihren Facetten zu erleben und ihre tiefgreifende Wirkung auf Körper, Geist und Seele zu erfahren, sei es durch Entspannungsmusik in der Arztpraxis oder durch das aktive Musizieren als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit.
Die Wirkung von Musik auf den Menschen
1. Was versteht man unter „Musik“?
Wenn ich mir die Frage stelle, was Musik für mich bedeutet, dann muss die Frage wohl heißen, was versucht mir Musik zu sagen. Denn jegliche Art von Musik hat deshalb eine Bedeutung, weil sie etwas aussagt. Musik ist ein ähnliches Ausdruckmittel wie die Sprache. Wörter haben bestimmte Bedeutungen, denn wenn man ein Wort hört, stellt man sich etwas darunter vor. Der Satz etwa: „Au, ich habe mich verbrannt!“ löst gewisse Gedankengänge aus. Eine logische Assoziation wird sein, dass man sich denkt, dass es Schmerzen verursacht. Es kann aber auch sein, dass ein anderer Mensch einen völlig konträren Gedankenweg geht, indem er zum Beispiel denkt, dass die Verbrennung eine Einschränkung bedeutet, weil diejenige Person den verbrannten Körperteil nicht mehr uneingeschränkt einsetzen kann. Das, was jeder einzelne aus Musik oder aus Worten für sich herausholen kann ist individuell und subjektiv.
Generell ist der Begriff Musik sehr subjektiv.
Eine möglichst sachliche Beschreibung fand ich in diversen Lexika:
Musik (griech.) bedeutete ursprünglich „Kunst der Musen“, bei den Griechen zunächst zusammenfassender Begriff für Tonkunst, Dichtkunst und Tanzkunst; daraufhin war Musik der Name für die schönen Künste, dann Tonkunst alleine; unter Tonkunst versteht man die Kunst, durch Töne Empfindungen oder Inhalte auszudrücken; diese wirkt durch Töne nach musikalischen Formgesetzen und durch Beziehung zu bestehendem Gefühlsinhalt; Verwandtschaft mit Poesie und Mimik; Musik wird durch Instrumente oder durch die menschliche Stimme erzeugt, nach theoretischen Gesetzen gestaltet (Harmonielehre, Generalbass, Kontrapunkt, Kompositionslehre, Instrumentation), bei Naturvölkern durch das Gehör, bei Kulturvölkern durch Notenschrift überliefert. Mit der Wirkung der Musikelemente (Melodie, Rhythmus, Metrik, Harmonie, Dynamik, Agogik) und der Beurteilung des Gehaltes eines Musikwerkes befasst sich die Musikästhetik; die Physiologie behandelt die Funktionen der Hörnerven, die Psychologie das Hören, soweit Geistestätigkeit dabei ist. Die Akustik untersucht die Bewegungsformen tönender Körper im Naturreich (Schwingungen und Wesen des Klangs, Schall); sie gelangt zu den Begriffen Konsonanz, Dissonanz, Tonalität. Nach den Darstellungsmitteln teilt man die Musik ein in Gesang (Vokalmusik) und in Instrumentalmusik. Werden viele Musikinstrumente verwendet, spricht man von Orchestermusik, bei einigen wenigen von Kammermusik. Historisch entwickelte sich Musik aus dem Boden der Volksmusik zu einer persönlich gestalteten Kunstmusik. Neben der letzteren unterscheidet man folgende Arten der Musik: Kirchenmusik, Unterhaltungsmusik, Tanzmusik, Jazzmusik; Musik in Verbindung mit Darstellung auf der Bühne: Oper, Operette, Musical, Singspiel, Programmmusik, serielle Musik, Zwölftonmusik; Doch wird mit diesen Beschreibungen nicht klar, was Musik bewirkt.
Gut Musik besteht aus Tönen. Dies sagt aber noch nicht viel darüber aus, was Musik im Menschen auslöst, wenn er diese akustisch wahrnimmt. Ein Ton für sich allein bedeutet nicht. Er ist entweder ein tiefer, hoher, lauter oder leiser Ton. Der Klang, der durch den Ton erzeugt wird, klingt verschieden, was davon abhängt, mit welchem Instrument ich diesen Ton erzeuge. Es ist immer derselbe Ton, doch klingt er immer anders. Musik ist eine mehr oder weniger geplante Zusammenstellung solcher Klänge. Derjenige, der diesen Plan erstellt, ist der Komponist. Er hat die Absicht die Klänge eines oder verschiedener Instrumente oder Stimmen so zusammenzufügen, dass dabei etwas herauskommt, das den Zuhörer erregt, erfreut, bewegt, beflügelt, interessiert, berührt, einnimmt, bedrückt, ...usw. Ich könnte hier endlos aufzählen, was zeigt, dass die Wirkung von Musik sehr vielseitig ist.
Für die meisten Menschen ist Musik eine Melodie. Denn wenn man sagt denke an Musik, dann fällt ihnen eine Melodie ein, wahrscheinlich die, die sie am liebsten hören. Eigentlich ist diese Assoziation nicht so abwegig, denn Musik besteht aus Tönen, wie oben erwähnt, und mehrer aneinander gereihte Töne ergeben eine Melodie. Wo Musik ist, da sind auch Melodien, beides getrennt voneinander gibt es nicht. Viele Menschen beschweren sich, dass bestimmte Musik keine Melodie hat. Bachs Fugen werden von vielen verurteilt, dass sie zuwenig melodisch sind. Doch was versteht der Volksmund unter „melodisch“? Es ist doch jede Folge von Tönen eine Melodie!
Eine Melodie kann viel Verschiedenes sein: ein Thema, ein Motiv, eine melodische Linie, eine Bass - Figur, eine Mittelstimme, ...usw. Die meisten Menschen glauben aber, dass eine Melodie etwas ist, was man leicht nachsingen oder pfeifen kann und was man sofort wiedererkennt, sozusagen ins „Ohr geht“.
2. Die Wirkung von Musik auf den Körper
Die Wahrnehmung von Musik geschieht meist passiv. Auch wenn wir uns nicht bewusst sind, dass wir Musik hören, unser Körper reagiert trotzdem darauf. Musik ist mehr als Ablenkung, Untermalung oder kurzweiliger Zeitvertreib. Sie kann auch Schmerzen lindern, Muskelverspannungen lösen, den Blutdruck senken und Stress abbauen.
Die Wirkung von Musik auf den Menschen lässt sich nicht verleugnen. Doch abgesehen vom subjektiven Glücksgefühl, welches zum Beispiel durch sein Lieblingsmusikstück ausgelöst werden kann, lassen sich auch objektiv messbare physiologische Veränderungen feststellen. Musik hat einen großen Einfluss auf die körperliche Befindlichkeit und wirkt auf die Körperrhythmen, also auf die Herzfrequenz und die Intensität des Pulsschlags. Dadurch steuert Musik den Blutdruck und somit auch die Gehirnaktivität.
Ebenso reagieren Atemrhythmus, Stoffwechsel, Schmerzempfinden und Sauerstoffverbrauch auf musikalische Reize. Dies Kraft der Musik wird in der modernen Medizin bereits vielfach genutzt. Es wurden bereits physiologische Musikprogramme entwickelt, die sowohl andere medizinische Maßnahmen unterstützen, effektive Hilfe zur Selbsthilfe als auch vorbeugende Maßnahme gegen schwerwiegende Leiden sein kann.
Seit Menschengedenken gehören Musik und Medizin zusammen. Was unter anderem an der Natur des Hörens liegt. Die Ohren gehören zu den ältesten Organen überhaupt, denn die Gehörzellen im Innenohr waren die ersten spezialisierten Zellen der Evolution. Mit der Basiliarmembran zusammen bilden sie tief im Zentrum der Schnecke das eigentliche Hörorgan, genannt „Cortisches Organ“. Hier wandeln feine Haarezellen Schallwellen in elektrische Impulse um. Diese Informationen werden über den Hörnerv zur Hörrinde im Gehirn weitergeleitet, wo das Gehörte dem Bewusstsein vermittelt wird. Musik ist eine ganz besondere Form von Geräusch: in vielerlei Hinsicht. Es wird sowohl zum Kleinhirn, das Körperbewegungen und den Gleichgewichtssinn kontrolliert, zum Großhirn, das für höhere Funktionen des Bewusstseins zuständig ist, als auch zum limbischen System geleitet. Musik hören spricht somit sämtliche Bereiche des Menschen an. Kein Wunder, dass große Denker, wie Konfuzius oder Platon einen heilsamen medizinischen Aspekt der Musik beobachteten. Leonardo da Vinci verfasste eine Pulsschrift, die den Zusammenhang von Takt, Musik und Herzschlag wissenschaftlich - systematisch behandelte. Erst Anfang des 17. Jahrhunderts trennten sich im Rahmen der allgemeinen Spezialisierung der Wissenschaften die Wege von Musik und Medizin.
Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die Musik als Therapie begleitendes Mittel wiederentdeckt. In der Schmerztherapie, Geburtshilfe und Neugeborenenbetreuung findet Musik ebenso Anwendung, wie bei der Beschleunigung postoperativer Heilungsprozesse, der Behandlung von Depressionen und Asthma sowie der Drogen - und Alkoholvergiftung. Auch zur Angstverminderung in der pre - operativen Phase, bei Rehabilitationsmaßnahmen in der Physiotherapie und bei der Arbeit mit geistig Behinderten, Lernbehinderten und psychologisch - psychiatrischen Problemfällen. Sogar bei Komapatienten erweist sich der Einsatz von Musik als wirkungsvoll.
Die Anpassung der Körperrhythmen an die Rhythmen der Musik hängt nicht von der Musikalität des Zuhörers ab.
Grundsätzlich gibt es eine Voraussetzung dafür, dass Musik den Körper beeinflusst, nämlich ob diese eine rhythmische Bassführung hat. Ebenso sollte sie dominante Percussioninstrumente mit einem sich rhythmisch wiederholenden Grundschlag enthalten. Die Anpassung der Körperrhythmen an die Rhythmen der Musik hängt aber nicht von der Musikalität des Zuhörers ab. Durch die Musik kann es zu einer Hebung oder Senkung des Pulses und des Blutdrucks kommen. Hierbei bestimmt das Tempo der Grundschläge ob eine aufputschende oder beruhigende Wirkung eintritt. Normale Körperfunktionen laufen bei 72 Herzschlägen pro Minute ab. Bei einem Tempo von mehr als 72 Hz wirkt Musik aufputschend, bei weniger beruhigend. Auffällig hierbei ist, dass ein Tempo von 60 Hz die stärkste Reaktion des menschlichen Körpers hervorruft. Dabei kommt es zur größten Entspannung und zu einer Entkrampfung. Die einzige Erklärung, die bis heute dafür gefunden wurde, beruht auf der Theorie, dass 60 Hz die ursprüngliche Herzfrequenz des Menschen war in einer Zeit vor dem Zivilisationsstress.
Der Bulgarier Georgie Losanow führte dazu einige Experimente durch. Bei Barockmusik mit einem Grundschlag von 60 Hz kam es bei einem Probanden zu einer Verlangsamung des Herzrhythmus um 5 Hz. Der Blutdruck sank und die Gehirnwellenaktivität fiel auf Entspannungsniveau bei hoher geistiger Wachheit. Diese Messungen zeigen eindeutige Parallelen zu den Gehirnwellenaktivitäten von Yogas während der Meditation.
Ähnliche Ergebnisse ließen sich auch mit einem Metronom oder dem Ticken einer Uhr erreichen. Allerdings wurden sich die Versuchspersonen hier sehr schnell der Monotonie bewusst und empfanden dies als Störung. Daher ist es von Vorteil, wenn der gleichbleibende Rhythmus in Musik „verpackt“ wird.
Die nicht bewusste Wahrnehmung von Musik kann dazu genutzt werden eine angenehme Stimmung und Atmosphäre zu schaffen. Musik kann zum Beispiel helfen, dass Hausarbeit leichter von der Hand geht. Hier kann sogar die völlige Abwesenheit von Musik, also die totale Stille, als störend empfunden werden. Dies wird dadurch verstärkt, dass Menschen heutzutage eine permanente Berieselung durch Musik gewohnt sind. Die totale Stille wird als unnatürlich empfunden und mit dem Tod assoziiert.
Besonders Musik mit Text kann starke emotionale Reaktionen des Zuhörers hervorrufen. Diese beziehen sich dann auf Assoziationen mit Erfahrungswerten, die bei bestimmten Wortreizen hervorgerufen werden. Emotionen entstehen aber nie durch den kompletten Liedtext, sondern immer nur durch einzelne Phrasen oder Schlüsselworte.
Dazu kommt, dass Musik verstärkt auf das limbische System des Gehirns wirkt. Der Limbus ist für die Entstehung von Gefühlen verantwortlich. Somit wird Musik zu einem Auslöser von Gefühlen.
Beispiel:
Wirkung von Entspannungsmusik in einer Arztpraxis
In einer internistischen Praxis in Dresden (Spezialgebiet: Krankheiten des rheumatischen Formenkreises, chronische Schmerzen) wurden 123 Patientinnen und 77 Patienten über ihre Wahrnehmung und Bewertung von sanfter Entspannungsmusik mit einer Taktfrequenz von 60 Hz befragt.
Ergebnisse:
Etwa 52 % der Befragten bemerkten die entspannende Musik sofort, 32 % während der Wartezeit, 14 % bei und 2 % nach der Behandlung. Daraus lässt sich schließen, dass die Menschen verschieden stark an Musik konditioniert sind. Für manche Menschen ist es bereits fast selbstverständlich, dass sie Musik „ausgesetzt“ sind. Die Tatsache, dass es aber eine besondere Form von Musik ist, nämlich Entspannungsmusik, wird aber allen Menschen früher oder später bewusst.
Antworten zur Wirkung der Musik
(Mehrfachantworten waren möglich):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Kein Patient erlebte die Musik als unangenehm oder störend, vorausgesetzt, sie wurde in einer dezenten Lautstärke gespielt.
Fazit:
Sanfte Entspannungsmusik im Pulstakt von 60 Schlägen pro Minute kann die Atmosphäre in einer Arztpraxis deutlich positiv beeinflussen. Zusammenfassend kann man sagen, dass gezielt eingesetzte Musik nicht nur Unterhaltungswert hat. Es ist auf diesem Weg möglich die Körperrhythmen des Zuhörers zu beeinflussen und emotionale Reaktionen hervor zu rufen.
3. Auditive Förderung bei Säuglingen
In einer von Monika Nöcker - Ribaupierre veröffentlichten Arbeit werden mittels der gefilterten Mutterstimme im stark lärmbelasteten Inkubator den Frühgeburten wichtige entwicklungsfördernde Reize dargeboten. Die Kinder konnten sich auf motorischer, wie auf sprachlicher Ebene besser entwickeln und hatten weniger Probleme mit der physischen Entwicklung. Das technische Verfahren mit kleinen Boxen, die in den Inkubator gestellt werden, ist einfach durchzuführen. Mittels eines Hochtonfilters kann man die Mutterstimme live filtern und im Inkubator wiedergeben. Auch die Herstellung von Tonband - oder Kassettenaufnahmen sind möglich, wenn auch in der Abwesenheit der Mutter stimuliert werden soll.
Auch in der Arbeit von Dr. Hans Grohneck aus der Kinderklinik Köln wurden ähnliche Erfolge erzielt. Man verwendete dort Werke von W.A. Mozart als Stimulierungsmittel. Die Kinder erreichten ihr Normalgewicht im Durchschnitt 2 Monate früher, als Kinder ohne auditiver Stimulierung.
Für die Entwicklung des Kleinkindes ist die Qualität der akustischen Umgebung von ausschlaggebender Bedeutung. Schließlich nehmen Kinder auditive Informationen immer auf. Erwachsene sind sich oft nicht bewusst, welche Wirkungen das eigene Gespräch, wie auch die Berieselung durch die Medien zur Folge hat.
Kleinkinder kommen mit einer neuronalen Stammhirnstruktur auf die Welt, die bereits wichtige auditive Merkmale differenziert:
- Richtungsgehör - Hinwendungsreflex
- Unterscheidung verschiedener Formate der Sprache bzw. Oberwellen der Musik
- Erkennen der Mutterstimme
Entscheidend für die Wirkung von klassischer Musik ist wohl der hohe Harmoniegehalt. Musikalisch aufgebaute Spannungen werden immer wieder aufgelöst (Barock). Ganz anders als in moderner Pop - , Rock - , Techno - usw. Musik, bei denen musikalische Spannungen oft dauerhaft aggressiv getragen werden (limbisches System).
4. Energetische Wirkung von Klängen
Die Wirkungsweise von Klängen beim Auftreffen auf den physischen Körper ist eine völlig andere als bei der Aufnahme durch das Ohr. Während beim Hörvorgang die Schallwellen im Ohr in Nervenimpulse umgewandelt und dem Gehirn zugeführt werden, pflanzen sich diese im Körper infolge dessen hohen Wassergehalts fort und versetzen das durchdrungene Gewebe in Vibration. Sie bewirken quasi eine mehr oder weniger tief ins Körperinnere reichende zarte Massage auf molekularer Ebene. Während die Wirkung von Musik auf die Stimmungslage und damit das psychische Wohlbefinden weitgehend vom persönlichen Geschmack beeinflusst wird, kommt es hier ausschließlich auf den Resonanzeffekt, das heißt das Mitschwingen an, unabhängig davon, ob einem die verwendeten Klänge gefallen oder nicht.
In ähnlicher Weise lässt sich eine körperliche Störung auch als falscher Ton am falschen Ort verstehen, wenn man davon ausgeht, dass jedes Organ, jedes Gewebe seine eigene Frequenz besitzt, in der es normalerweise schwingt. Versetzt man eine blockierte Körperstelle in Vibration, so wird diese stimuliert, zunächst mit der äußeren Frequenz mitzuschwingen und anschließend zu ihrer eigenen, harmonischen Frequenz zurückzukehren. Verwendet man dabei von vorne herein einen Ton mit der Frequenz, die der jeweiligen Stelle entspricht, so ist der therapeutische Effekt wesentlich höher, da die Zellen gleich in der Eigenfrequenz mitschwingen. Leider sind die Resonanzfrequenzen der einzelnen Organe und Gewebe im Körper bislang noch nicht bekannt, sodass man auf das Experimentieren angewiesen ist.
Manche Musikinstrumente erzeugen bereits beim Erklingen im Abstand von einigen Metern ein mehr oder weniger deutlich wahrnehmbares Mitvibrieren des Körpers. Hierzu gehören vor allem verschiedene Arten von Trommeln (besonders die Basstrommel) und einige ethnische Instrumente. Erheblich intensiver ist dieser Effekt bei den tibetischen Klangschalen und beim australischen Didgeridoo.
Beim letzteren handelt es sich um ein Holzblasinstrument, das aus einem ca. 1,30 Meter langen und etwa 15 Zentimeter dicken, von Termiten ausgehöhlten Ast gefertigt wird und beim Anblasen einen tiefen, durchdringenden und verhältnismäßig lauten Brummton ähnlich einer Maultrommel von sich gibt. An sich geht dieser Klang schon „durch und durch“ und erzeugt ohnehin einen therapeutischen Effekt. Dieser lässt sich steigern, indem man erkrankte Körperteile „bespielt“, das heißt mit dem Instrument anbläst.
Ähnlich durchdringend ist der Klang tibetischer Klangschalen, die aus verschiedenartigen Metalllegierungen bestehen und von ihrer Form her Essschalen ähneln. Sie werden mit einem Klöppel angeschlagen oder mit einem Holzstab durch Reiben entlang des Schalenrands zum Klingen gebracht. Dabei entstehen summende, singende, schwebende Klänge, die nicht nur den Körper zu durchdringen scheinen, sondern auch das Bewusstsein beeinflussen. Neben sehr individuellen Erfahrungen kommt es dabei meist zu einem Gefühl körperlichen Wohlbefindens und angenehmer Entspannung. Für Behandlungszwecke kann man eine Klangschale vor einem erkrankten Organ aufstellen oder entsprechend auf dem Körper auflegen, um die betroffene Stelle besonders intensiv in Vibration zu versetzen.
Eine andere Methode ist das Arbeiten mit Stimmgabeln. Neben dem Lauschen und meditativen Einstimmen auf den durch sie erzeugten Klang kann man diese auch auf blockierte Körperstellen aufsetzen, um deren Schwingungen auf den Körper zu übertragen. Diese Methode wird bislang nur von wenigen Musiktherapeuten angewendet.
Diese Informationen stammen von einem Verein für sanfte Therapien. Ich denke, dass Vibrationen an den kranken Körperstellen durchaus entspannend wirken können und eine temporäre Linderung der Schmerzen erzielt werden kann, jedoch ist fraglich, ob durch solche Methoden Krankheiten geheilt werden können.
Eine weitere Möglichkeit, den physischen Körper mit Hilfe von Klängen in Vibration zu versetzen, ist das Obertonsingen. Obertöne sind Vielfache der Grundfrequenz eines Tones, die bei dessen Erzeugung mit entstehen. Während der Grundton selbst die wahrgenommene Tonhöhe festlegt, bestimmen die Intensität und das Verhältnis der mitschwingenden Obertöne untereinander den Klang eines Instrumentes. Dies gilt auch für die menschliche Stimme.
Das Obertonsingen ist eine ganz spezielle Technik, bei der möglichst viele Obertöne gebildet werden. Dabei wird gleichzeitig auch die größtmögliche Resonanz der eigenen Stimme im Körper erzielt. Neben dem auch für Außenstehende überwältigenden Klangeffekt vermittelt diese Art von Gesang innere Ruhe und Sicherheit und eine erhöhte Empfindsamkeit für äußere Geräusche.
Diese in den letzten Jahren vor allem in der „New Age“ Szene bekannt gewordene meditative Methode des Singens ist Jahrhunderte alt und Bestandteil religiöser Riten vieler Kulturen. Sie ist in Tibet, Nordindien, China, Japan, Sibirien, Rumänien, Bulgarien, Zentralafrika, den südamerikanischen Anden und in der Mongolei bekannt und wird zum Teil noch heute praktiziert, insbesondere von buddhistischen Mönchen.
5. Die Obertonreihe
Die Kenntnis der Intervallunterteilungen einer Saite waren in der Antike schon vorhanden. Diese Grundgesetze beweisen den Zusammenhang von Tönen und Zahlen. Intervalle sind psychisch erlebbar, und die einzelnen Zahlenverhältnisse entsprechen bestimmten Gefühlen. Da diese Proportionen vom Gehör wahrgenommen werden können und schon für die damalige Zeit als Grundgesetze der Musik existierten, rückten im frühen Griechenland musikalische Vorstellungen in das Zentrum des Weltbildes. Nun versteht man unter Ton im physikalischen Sinne eine einzige hörbare Schwingung, doch kommen bei jedem auf natürliches Weise erzeugten Ton naturgesetzlich weitere, sehr leise mitklingende Töne hinzu, die man als Obertöne bezeichnet, und ein Ton mit seinen Obertönen wird als Klang bezeichnet. Man spricht auch von Partialtönen oder Teiltönen. Die Obertöne stehen zum Grundton in ganzzahligen Frequenzverhältnissen.
Jeder Ton eines klassischen Musikinstrumentes hat einen entsprechenden speziellen Klang, der durch eine bestimmte Konstellation verschiedener Obertöne seine Farbe und seinen unverwechselbaren Charakter erhält. Die Klangfarbe eines Tones ist also abhängig von dem jeweilig vorhandenen Ausschnitt des Obertonspektrums, wobei einige Töne weniger, andere mehr hervortreten können. Es besitzen allerdings nicht alle Klangkörper harmonische Obertöne mit ganzzahligen Frequenzverhältnissen. Bei angeschlagenen Glocken, Becken oder Gongs erklingen auch unharmonische, manchmal falsch klingende Teiltöne mit.
Auf einem Monochord oder einem beliebigen Streich - oder Zupfinstrument kann man die harmonische Naturtonreihe leicht durch zartes Berühren an den oberen beschriebenen Stellen der Saite hörbar machen. Diese werden als Flageoletts bezeichnet. Die Naturtonreihe konnte bis zum 40. Teilton physikalisch nachgewiesen werden.
Es ist anfangs kaum möglich, einzelne Obertöne aus einem Klang herauszuhören, selbst wenn man ein noch so gutes Gehör besitzt. Es ist eine ganz besondere Art von Aufmerksamkeit notwendig, um Obertöne wahrzunehmen, sonst bleiben sie verborgen. Denn alle unsere sinnlichen Wahrnehmungen sind nicht bloß Empfindungen des Nervenapparates.
„ Sondern es gehört noch eine eigentümliche Tätigkeit der Seele dazu, um von der Empfindung der Nerven aus zu der Vorstellung desjenigen Objekts zu gelangen, welches die Empfindung erregt hat. “ 1
Das Hören des Obertonspektrums, die Versenkung in die Naturtonreihe, ist innerhalb zahlreicher asiatischer und arabischer Schulen eine Tonmeditation zur Selbstverwirklichung.
6. Faktoren, die die Wirkung von Musik beeinflussen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Alle Faktoren können mehr oder weniger stark wirksam werden, aber erst gemeinsam lassen sie das Erlebnis Musik im Hörer entstehen. Ein - und dasselbe Musikstück können beim selben Hörer zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedliche Wirkungen haben.
„ So wirkt die Musik letztlich auf jeden so, wie er selbst ist. Beim Hören von Musik gibt es keine Lüge. “ 2
7. Auswirkungen akustischer Reize
Jede Schallwahrnehmung hat eine mehr oder weniger spezifische Wirkung auf den Menschen. Abwechslungsreiche, komplexe Geräusche mit einem hohen Grad an Verschiedenheit wirken anregend, geordnete Geräusche, die eine innere Systematik erkennen lassen wirken beruhigend. Schallwahrnehmungen haben immer auch eine Bedeutung. Geräusche mit hohem Informationsgehalt aktivieren stärker als mit niedrigem, auch die Orientierungsreaktion hält länger an.
- Informationsgehalt
Komplexe Musik, bei der man nicht im vorhinein weiß, was auf einen zukommt, leitet viel Information, das heißt der Zuhörer weiß nachher mehr als vorher. Ein mittlerer Informationsgehalt wird als ideal angesehen, wobei der situative Zustand die Informationsverarbeitung beeinflusst: Ärger, Stress und intellektuelle Tätigkeit führen zu einer Bevorzugung einfacher Reize.
- Orientierungsreaktion
Ungewöhnliche akustische Reize lösen außerhalb des Bewusstseins einen Mechanismus aus, der diesen Reiz zu analysieren versucht. Eigenschaften von Reizen, die eine Orientierungsreaktion auslösen, sind: eine Veränderung der Intensität, der zeitlichen Struktur, der absolute oder relative „Neuheitsgrad“ des Reizes, die Intensität des Reizes;
8. Schädliche Wirkung durch Hörschall
Beispiele aus Zeitungsartikeln:
- 70 % der Bevölkerung werden durch Lärm des Straßen - oder 55 % durch den des Flugverkehrs belästigt.
- 5 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland sind während ihrer Arbeit gesundheitsgefährdendem Lärm von über 85 dB ausgesetzt. Die folge sind jährlich ca. 3000 anerkannte Fälle der Berufskrankheit „lärmbedingte Schwerhörigkeit“.
- ¼ der jungen Erwachsenen sind auf Grund ihrer Musikhörgewohnheiten irreversibel hörgeschädigt.
- Autounfälle nach Disko - Besuchen sind zu 2/3 Folgen zu lauter Musik während des Besuchs in den Diskotheken und weitaus weniger Folgen durch Alkoholkonsum, wie man früher angenommen hatte.
Auf Grund der Zeitungsartikel lässt sich feststellen, dass beim Hörschall der „Lärm“ eine beachtliche und tragende Rolle spielt.
Was ist Lärm?
Eine einfache Definition von Lärm: negativ bewerteter Schall. Zum Lärm kann man keine physische Angabe machen. Lärm ist von den jeweiligen Einstellungen abhängig und ist an situative Voraussetzungen gebunden. Von Menschen wird Lärm als Geräusch wahrgenommen, das stört, belästigt, gefährdet und schädigt. Dabei sind Störung und Belastung subjektiv, wogegen Gefährdung und Schädigung medizinisch nachweisbar sind. Das Problem bei Lärm ist, dass er weder stinkt noch strahlt und auch keine giftigen Rückstände hinterlässt, also im nachhinein nicht mehr nachvollziehbar ist. Erst spätere Beeinträchtigungen im Innenohr und im Allgemeinzustand von Menschen lassen möglicherweise die Folgen des Lärms erkennen.
Wie kann man Lärm messen?
Wie schon erwähnt, kann man Lärm nicht direkt messen, aber man kann einen Richtwert, den Schallpegel angeben.
Der Schalldruck ist die durch einen Ton hervorgerufene Abweichung des Luftdrucks von dem sonst herrschenden Luftdruck. Dieser physikalisch messbare Wert ist sehr klein, und es ist deshalb umständlich mit ihm zu arbeiten. Aus diesem Grunde wird bei der Angabe der Stärke des Schalls der Schalldruck eines Tones mit dem Druck eines gerade noch wahrnehmenden Tones bei 1 kHz verglichen. Dies nennt man dann Schalldruckpegel, kurz Schallpegel. Er drückt lediglich aus, um wie viel stärker der Schall zum Zeitpunkt der Messung als der gerade noch wahrnehmbare ist. Diese Maßangabe erfolgt in Bel (B) oder B/10 = Dezibel (dB) genannt. Die Größe des Schalldrucks ist für das Ausmaß von Gehörschäden entscheidend.
Für die Schädigung des Ohres ist der mit dem Schall auf das Ohr übertragene Energiebetrag, die Schallintensität besonders wichtig. Die Schallenergie oder Schallintensität ist an der Schmerzgrenze zehnbillionenmal größer als an der Hörschwelle. So schädigen zum Beispiel 40 Arbeitsstunden bei 85 dB (Beginn des Risikos für Lärmschwerhörigkeit) pro Woche nicht mehr als 4 Stunden Aufenthalt pro Woche in einer gar nicht so lauten Disko mit 95 dB. In einer lauten Disko mit 105 dB ist diese Schädigungsgrenze bereits nach 24 Minuten erreicht.
Die markanten Grenzwerte liegen bei:
- 0 dB Hörschwelle des menschlichen Ohres
- 60 dB Stressreaktion im Schlaf
- 90 dB Auftreten von Hörschäden bei längerer Einwirkung
- 130 dB Schmerzgrenze des menschlichen Ohres
- 150 dB führt zu irreparablen Schäden im Innenohr in ca. 1 Sekunde
Ein weiterer Aspekt ist die zeitliche Dynamik des Hörgeschehens, das heißt bei sehr schnellem Anstieg des Schalls und sehr kurzer Zeitdauer wirkt in einem extrem kurzen Zeitraum eine enorme Energie auf das Ohr ein. Das heißt, der Schall erreicht die volle, subjektiv wahrgenommene Lautheit erst nach etwa 200 ms ( = 1/5 sec ), sodass kürzere Signale, auch wenn sie hohen Schallpegel haben, als nicht sehr laut empfunden werden, und zwar weniger so laut, je kürzer sie sind.
Beispiele:
- Der Knall einer Kinderspielzeugpistole, der über 160 dB hat, ist nur einen Bruchteil von Millisekunden lang und wird deshalb als relativ leise empfunden. Trotzdem kommt ihm eine hohe Schädlichkeit für das Ohr zu, die aber durch die subjektive Wahrnehmung nicht realisiert wird.
- Das Schießen mit einem Gewehr hat als Spitzenwerte 160 - 165 dB zur Folge.
Aufgliederung der Lästigkeit von Lärm
1. Ein gleichmäßiges Grundgeräusch, das von einem hervortretendem Geräusch überlagert wird.
2. Geräusche mit hohen Frequenzanteilen wirken lästiger als tiefe
3. Einzeltöne sind unangenehmer als Bandrauschen.
4. Impulshafte Geräusche sind lästiger als Punkt 1 - 3. (Verkehrslärm)
5. Impulse mit langsamer Abfolge sind lästiger als in schneller Folge.
6. Eine Steigerung eines unregelmäßigen Geräusches (eine herannahende Eisenbahn ist weniger lästig als Verkehrslärm).
7. Wenn durch plötzlich auftretende Geräusche oder einen Knall eine Schreckreaktion ausgelöst wird.
9. Musik als Chance für die Persönlichkeit
Musik ist eine Ausdrucksform, die der Befriedigung des Bedürfnisses der Selbstverwirklichung dienen kann.
Hier verschiedene Begründungen, warum dies so ist:
1. eine anthropologische Begründung:
Musikmachen und Musik erleben sind besondere Arten und Weisen des sich in der Welt befindens und sich darin zu finden. Musik ist Medium und Bestandteil menschlicher Selbstverwirklichung.
2. eine kulturpädagogische Begründung:
Der Mensch ist von Natur aus ein Kulturwesen, er ist Schöpfer und Geschöpf von Kultur. Es gibt in der Geschichte und in der Gegenwart keine Kultur ohne Musik. Der Mensch sollte versuchen eine vermittelte Kultur aus zweiter Hand durch eine Primärkultur zu ersetzen. Dies bedeutet, dass der Mensch durch selbsttätiges Singen und angeregtes instrumentales Musizieren eine wiederum neue Kultur schaffen soll, sodass die derzeitige Kultur in Bewegung bleibt.
Mit Musikerziehung macht man aus jungen Menschen Schöpfer von Kultur.
3. eine musikontologische Begründung:
Ontologie ist die Lehre vom Sein! Musik ist anders als andere Kulturtechniken. Musik besteht auf einer anderen Ebene. Die hörsinnliche Wahrnehmung eines Klanges ist die Begegnung mit der Welt. Musik ist sprachlose und begriffslose Kunst und somit für jeden zugänglich, da sie jedem etwas zu sagen hat.
4. eine schultheoretische und bildungspolitische Begründung:
Die Schule verkommt mehr und mehr zu einer Unterrichtsanstalt mit einseitig kognitiven Leistungen, die durch die Computerwelt beeinflusst wird. Das von Kindern spielend beherrschte Internet macht die Welt zu einem vernetzten Dorf. Die Gefahr besteht darin, dass die Gesellschaft zum ab - und eingegrenzten sozialen Ghetto wird und Kommunikation einzig und allein auf PC - Tasten geschieht. Auf Schulen kommen ungeahnte neue Aufgaben zu. Soziologen bedauern bereits Lehrer, da sie gegen den heimlichen Lehrplan des Datenverarbeitungsmodells „Schüler“ ankämpfen müssen und die Schüler stärken müssen um naives Staunen ausschließen zu können. Wenn man also in die Zukunft blickt, so gehören die Künste entscheidend in die Schulen, weil Musik einen unvergleichlich hohen Stellenwert in der Lebenswelt des Schülers hat.
5. eine sozialpädagogische Begründung:
Musik ist die sozialste aller Künste.
„ Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. “ 3
Musik öffnet den Menschen zum Mitmenschen. Musik fördert die soziale Kompetenz sensationell. Gerade deshalb, weil Musik eine sozialisierende Wirkung hat, ist es enorm wichtig, dass Musik auch in die Erziehung einfließt.
6. eine therapeutische Begründung:
Man kennt die Wirkung der Musik auf die Psyche durch die Musiktherapie, wo ich aber nicht detailliert eingehen kann, da dies den Rahmen sprengen würde. Die Musiktherapie wendet Musik rezeptiv und aktiv an, um therapeutische Effekte bei psychischen Erkrankungen zu erzielen.
Psychotherapie: Suchterkrankungen, Depressionen Psychoanalyse: Neurosen, Schmerztherapie, viele andere medizinische Bereiche Musik kanalisiert Aggressions - und Gewaltpotentiale, sie baut Stress ab und erleichtert die Motorik.
7. eine außermusikalische Begründung: Musik wirkt sich auf die Entwicklung der Intelligenz und auf die soziale Kompetenz aus. Mit höheren Musikalitätswerten steigt auch der IQ.
Sozial benachteiligte und in ihrer kognitiven Entwicklung weniger geförderte Kinder profitieren von einer erweiterten Musikerziehung am meisten. Musik ist ein Zusammenhang von Syntax und der Struktur kognitiven Kompetenzen. Musik verlangt das Entdecken von Formen und Formprinzipien. Man muss beim Musizieren voraushören, mithören und nachhören. Das erlernen eines Instrumentes ist eine der komplexesten menschlichen Tätigkeiten. Es werden die Fähigkeiten des Intellektes, das Begreifen, die Motorik und die Emotionen beansprucht. Die Koordination der Hände verlangt eine gewisse Feinmotorik und Vorstellungsvermögen. Dabei werden abstraktes und komplexes Denken beansprucht. Beim Musizieren muss der Mensch viele Entscheidungen gleichzeitig treffen. Dies hat einen erzieherischen Wert.
Das Ergebnis einer Berliner Studie zeigt, dass auf Grund eines Soziogramms festgestellt wurde, dass die Quote der Kinder, die keine einzige Ablehnung erhielten, in Klassen mit Musikschwerpunkt und Ensemblemusizieren doppelt so hoch ist wie in Klassen ohne Musik. Dadurch wurde dargestellt, wie sich Musik auf die soziale Kompetenz des Menschen auswirkt.
8. eine musikimmanente Begründung:
Musik dient auch zukünftig der Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit gegen einen Bild - , Musik - , und Lärmimperalismus der heutigen Zeit, denn Musik ist das einzige reine Hör - Fach.
Musizieren ist zweifelsfrei ein Königsweg jeden Erziehung, die eine umfassende gebildete Persönlichkeit zum Ziel hat. Musik ist ein Ansporn aus einer Kommerzpassivität zu erwachen, eigene Begabungen zu entdecken und über das Musizieren zu entdecken: „ Ich kann etwas, deshalb bin ich auch etwas!“
„ Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann, worüber aber zu schweigen unmöglich ist. “
„ Mensch zu werden ist eine Kunst! Kunst kann helfen, Mensch zu werden! “ 4
10. Praktischer Teil
Vorüberlegungen:
Ich wollte einen Weg finden, wie ich Kindern verschiedenste Musikrichtungen näher bringen kann. Als Ergebnis sollte man sehen können, wie sich die unterschiedlichen Richtungen auf die Kinder auswirken. Anfangs dachte ich an Tanz oder sonstige Bewegungsformen. Doch dies ist sehr schwer zu dokumentieren und ich hätte nur sehr wenig handfestes „Beweismaterial“ vorweisen können, da einzig und allein Fotos oder ein Video als Anschauungsmaterial dienen hätte können.
Deshalb entschied ich mich für Malen zur Musik, wo die Kinder sehr selbständig kreativ sein können und ihren Gefühlen freien Lauf lassen können. Und weiters habe ich neben den Fotos, die ich während dem Malen gemacht habe, noch die Malereien, die man in die Bewertung miteinbeziehen kann.
Ich nahm mir vor alle Materialien den Kindern zur Verfügung zu stellen, sodass sie ungehindert arbeiten können.
Dazu überlegte ich mir verschiedenste Materialien auszuprobieren, wobei ich gleich bei der ersten Durchführung auf ein Problem stieß. Denn beim ersten Mal verwendete ich als Malmaterial Ölkreiden. Die Kinder waren es aber gewöhnt mit den Ölkreiden eher zu zeichnen als zu malen. Vor allem lösten die Ölkreiden das aus, dass die Kinder alle einheitlich begannen gegenständlich zu zeichnen. Meine Besuchskindergärtnerin erklärte mir dann, dass es üblich ist, dass die Kinder zum Beispiel nach Geschichten eine besondere Szene nachzeichnen, wobei Ölkreiden verwendet werden. Die Kinder hatten also mit den Ölkreiden sofort verbunden, dass sie ein Bild zeichnen sollen. Ich konnte ihnen so oft ich wollte erklären, dass sie nicht unbedingt etwas bestimmtes malen müssen, wo man im nachhinein erkennen kann, was es ist, aber es war zwecklos. Deshalb entschied ich mich bei der nächsten Durchführung Wasserfarben zu verwenden. Der praktische Teil ist also auf Wasserfarben aufgebaut.
Ich kam zu dem Schluss, dass es besser ist dieselben Kinder mit denselben Materialen in das Projekt mitein zu beziehen. Denn somit ist das einzige Medium, das verändert wird die Musik, womit deutlicher wird, welche Auswirkungen diese auf die Kinder hat. Somit sind annähernd gleiche Bedingungen bei jeder Aktivität gewährleistet, wodurch lediglich die Musik ausschlaggebend sein sollte. Natürlich kann ich die augenblickliche Befindlichkeit der Kinder nicht beeinflussen und aus dem Umfeld, welches das Ergebnis natürlich mit beeinflusst, ausschließen, denn die Tagesverfassung jedes einzelnen wirkt auch auf die Kreativität der Kinder. An manchen Tagen reagieren die Kinder aufmerksamer und können sich besser konzentrieren, wodurch sie natürlich auch sensibler auf die Musik eingehen können. Ich habe mir aber besondere Ereignisse im Tagesgeschehen auf der Rückseite der Bilder notiert, wodurch ich sie objektiver beurteilen kann.
Konzept
1. Intention
Ich möchte, dass man anhand der Malerei der Kinder erkennt, dass verschiedene Arten von Musik verschiedenste Eindrücke hinterlassen und verschiedenste Gefühle verursachen.
2. Sozialform
Ich führte diese Aktivität mit einer Kleingruppe von maximal 4 Kindern durch. Es handelte sich dabei im Verlauf des Projektes um dieselben Kinder, sodass man Unterschiede erkennen kann, denn jedes Kind reagierte wiederum individuell.
3. Raumsituation
In meinem Besuchskindergarten gibt es ein sogenanntes „Soki - Zimmer“. Dabei handelt es sich um einen eigenen Raum, den die mobile Sonderkindergärtnerin benützt. An den Tagen, an denen sie nicht im Kindergarten ist, kann dieser Raum von den regulären Kindergärtnerinnen genützt werden. Dort durften die Kinder am Boden malen, wodurch sie räumlich fast nicht eingegrenzt wurden.
4. Medien
Kassettenrekorder, Kassette, Fotoapparat, Blätter Papier, Tixo zum Befestigen des Papiers am Boden, Malschürzen, Pinsel, Unterlagen, Wasserfarben;
5. Vorbereitungen vor der Aktivität:
a. Zusammenstellung der Materialien (Farben, Pinsel, Papier, Malschürzen)
b. Vorbereitung der Medien:
- Verteilung des Papiers im Raum, sodass die Kinder möglichst nicht voneinander abschauen können und sich gegenseitig beeinflussen; dazu lege ich die Bögen im Kreis auf, wobei die Kinder nicht in die Kreismitte schauen sollen, sondern nach außen, sodass jedes Kind nur sein Blatt Papier sehen kann;
- Befestigung des Papiers am Boden; ich denke mir, dass es für die Kinder leichter ist, wenn das Papier fix am Boden befestigt ist, sodass es während des Malens nicht verrutschen kann;
- Bereitlegung der Malschürzen neben dem Blatt Papier
- Bereitstellung der Malfarben in der Mitte des Kreises auf einem Blatt Papier, wodurch der Boden nicht beschmutzt werden kann; - Bereitstellung des Kassettenrekorders mit der entsprechenden Musik;
6. Einleitung:
a. Ich erklärte den Kinder, dass sie sich einen Platz im Raum suchen können, wo sie es sich gemütlich machen können , da ich ihnen anschließend etwas vorspielen möchte. Als alle Kinder einen Platz gefunden hatten, schlug ich ihnen vor die Augen zu schließen, da somit die Konzentration auf die Musik wesentlich weniger durch visuelle Reize abgelenkt wird.
b. Ich spielte den Kindern die Musik einmal vor.
c. Dann durften sie die Augen wieder öffnen und mir erzählen, an was sie während der Musik dachten. Hauptsächlich wurden dabei Ereignisse des Tages reflektiert und verarbeitet.
d. Als nächstes durfte sich jedes Kind ein Blatt Papier aussuchen, zu dem es sich setzen durfte.
e. Ich gab den Kindern Hilfestellungen beim Anziehen der Malschürzen.
7. Hauptteil:
Ich schaltete die Musik ein, was sozusagen das Startzeichen für die Kinder darstellte. Nun lies ich sie uneingeschränkt malen und kreativ sein. Ich gab lediglich Anweisungen, wenn die Kinder nicht sorgsam mit den Farben umgingen oder sie den Boden beschmutzten. Auch Konflikten, wer welche Farbe haben darf, wollte ich möglichst aus dem Weg gehen, da ich die Kinder ansonsten zuviel beeinflusst hätte.
8. Schluss:
a. Sobald ein Kind von sich aus sagte, dass es fertig ist, fragte ich es, was es gemalt hatte und ob eine Verbindung zur Musik besteht.
b. Das Kind durfte anschließend die Malschürze ausziehen und in den Gruppenraum zurückgehen.
Erfahrungen, die ich während des Projektes machte:
Ich dachte mir, dass die Kinder, wenn sie die Bilder der anderen nicht sehen können, sich nicht gegenseitig beeinflussen können. Dabei hatte ich mich geirrt, denn die Kinder machen natürlich Pausen in ihrem aktiv Sein und dabei drehen sie sich um, was ich ihnen natürlich nicht verbieten möchte, um zu sehen, was denn die anderen so machen. Auch kommunizieren die Kinder untereinander, sie erzählen sich gegenseitig, was sie gerade malen. Oft kam es vor, dass eine bestimmte Farbe gerade im Besitz eines Kindes war, was bei anderen Kindern die Reaktion auslöst, dass sie dasjenige Kind fragen, warum es gerade diese Farbe braucht. Somit wissen sie untereinander Bescheid, was die anderen gerade malen.
Somit muss ich leider ausschließen, dass das Ergebnis ganz allein von dem Kind abstammt, welches das Bild gemalt hat. Ich hätte die Aktivität einzeln mit den Kindern durchführen müssen, was aber nicht im Zeitrahmen der Praxis möglich ist.
Weiters musst ich feststellen, dass die Kinder ohne eine ungefähre Anleitung, was sei malen sollen, nicht eigenständig arbeiten können. Denn nicht die Ölkreiden alleine waren Schuld, dass die Kinder gegenständlich malten. Sie malen generell gegenständlich, außer wenn man ihnen Alternativen anbietet. Deshalb entschloss ich mich jeweils vor dem Hauptteil den Kindern zu zeigen, wie ich zur Musik malen würde. Anfangs hatte ich Bedenken dabei, denn ich hatte Angst, dass die Kinder mich nachahmen und keinerlei Eigenständigkeit mehr aufweisen können. Dem ist aber nicht so, sie brauchen lediglich einen Anstoß, woraufhin sie ohne weiteres kreativ sein können.
Um den Kindern noch besser verdeutlichen zu können, was ich mir von ihnen erwarte, kam ich auf die Idee es ihnen folgendermaßen zu veranschaulichen:
Ich erklärte den Kindern, dass der Pinsel zur Musik tanzt und führte es ihnen auch vor. Dadurch konnte ich sie nicht nur motivieren genauer auf die Musik zu horchen, sondern konnten sie sich generell diese Situation gut vorstellen. Jedes Kind wollte einen besonderen Tanz kreieren, womit ich mein Ziel erreichte.
Wenn ich das Gefühl hatte, dass sich die Kinder eher damit beschäftigten einen besonderen Tanz zu erfinden, machte ich sie wieder auf die Musik aufmerksam, indem ich die Melodie mitsummte oder bei bestimmte rhythmischen Stellen auf den Boden klopfte.
Musik
1. Bereich Entspannungsmusik
Interpret: Enya
Album: The best of Enya
“Paint the sky with stars” Track: Nr. 11
“Watermark”
2. Bereich Tanzmusik
Ich zähle dieses Lied deshalb zur Tanzmusik, da ich dazu in einer anderen Gruppe mit Kindern einen Tanz erarbeitet habe, und es sich sehr gut dafür geeignet hat.
Interpret: Michael Langer Album: „Fingerstyle“ Track: Nr. 5
„Chattanooga choo choo“
3. Bereich Popmusik
Interpret: Michael Jackson
Album: “They don`t care about us” Track: Nr. 1
“They don`t care about us” (Single - Version)
4. Bereich Klassik
Interpret: Anton Bruckner
Album: 4. Symphonie (die Romantische) Track: Nr. 3
5. Bereich Besondere
Interpret: Björk
Album: „Selma Songs“ (Filmmusik zu „Dancer in the dark“) Track: Nr. 7
„New world”
Auswirkungen:
Die Wirkung wird durch zwei verschiedene Ergebnisse klar. Auf der einen Seite sind die Malereien der Kinder sehr aussagekräftig, andererseits waren aber auch die verbalen Äußerungen über ihre Werke bedeutend.
Es ist sehr schwierig abschließend und generell zu bewerten. Anhand jedes Bildes kann ich genau sagen, welche Aussagen das jeweilige Kind dazu machte, und welche Bedeutung die Farbwahl und das Bild hat.
Prinzipiell kann ich sagen, dass die drei Kinder, die ich in mein Projekt mit einbezog unterschiedlich sensibel auf Musik reagierten. Ein Kind konnte dabei seine Aggressionen und emotionellen Spannungen abbauen, was das Gruppengeschehen erheblich beeinflusste.
Auch waren die verschiedenen Arten von Musik unterschiedlich ansprechend für die Kinder. Es gab aber kein Lied, was in den Kindern nichts auslöste!
Quellenverzeichnis
- Meyers kleiner Lexikon: Achte gänzlich neu bearbeitete Auflage in drei Bänden; zweiter Band; Bibliographisches Institut AG:/Leipzig, 1932;
- Grosses Handlexikon in Farbe; Lexikon Institut Bertelsmann
- Der Volksbrockhaus, Sechzehnte neu bearbeitete Auflage; F.A. Brockhaus Wiesbaden, 1981;
- Leonard Bernstein: Konzert für junge Leute; Die Welt der Musik in 15 Kapiteln; C. Bertelsmann Verlag; 1. Auflage 1999
- Peter Michael Hamel: Durch Musik zum Selbst; Wie man Musik neu erleben kann; dtV Bärenreiter Verlag, 4.Auflage 1986
- Joachim - Ernst Berendt: Das dritte Ohr; Vom Hören der Welt; Rowohlt Taschenbuch Verlag; überarbeitete Fassung 1998 - John Beaulieu: Music and Sound in the healing arts; Talman company, 1987
- Prof. Dr. Franz Lehner: Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, Universität Regensburg; Grundlagen der Psychoakustik, multimediales Lernprogramm, November 2000
- www.hausarbeiten.de/archiv/musik
- www.vtm-stein.de/wissenschaft_arztpr.htm
- www.dsathen.edu.gr/d/projekte/drogen/musik
- www.gesundheit.abacho.at/gesundheits_lexikon_anzeigen.phtml?doku ment=musik.html
- www.sanfte-therapien.de
- www.sm.xdv.org/research
- www.sunbear.de/projekte/schallwirkung
- www.audiva.de/Einfuehrung/Therapie_FG.htm
- www.schulen.eduhi.at/musikerziehung
[...]
1 Hermann von Helmholtz, bekannter Physiologe; 1857 Seite 8
2 Horst G. Klingenberg, Musik eine Droge? Die Antwort eines Mediziners Seite 9
3 Friedrich Nietzsche, Philosoph 1844 - 1900
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Musik laut dem Text "Die Wirkung von Musik auf den Menschen"?
Laut dem Text ist Musik ein Ausdrucksmittel ähnlich der Sprache, das Empfindungen oder Inhalte durch Töne ausdrückt. Der Begriff Musik ist subjektiv, und ihre Wirkung ist vielseitig, von Erregung und Freude bis hin zu Bedrückung.
Wie wirkt Musik auf den Körper?
Musik wirkt auf die Körperrhythmen wie Herzfrequenz und Pulsschlag, steuert den Blutdruck und die Gehirnaktivität. Sie beeinflusst auch Atemrhythmus, Stoffwechsel, Schmerzempfinden und Sauerstoffverbrauch. In der modernen Medizin wird sie zur Schmerzlinderung, Muskelentspannung, Blutdrucksenkung und Stressabbau eingesetzt.
Welche Rolle spielt der Rhythmus bei der Wirkung von Musik auf den Körper?
Eine rhythmische Bassführung und dominante Percussioninstrumente mit einem sich rhythmisch wiederholenden Grundschlag sind wichtig. Das Tempo der Grundschläge bestimmt, ob eine aufputschende oder beruhigende Wirkung eintritt. Ein Tempo von 60 Hz kann die stärkste Entspannung hervorrufen.
Welche Vorteile hat auditive Förderung bei Säuglingen?
Auditive Förderung mit der gefilterten Mutterstimme im Inkubator oder mit Werken von W.A. Mozart kann die motorische und sprachliche Entwicklung von Frühgeburten verbessern und die Gewichtszunahme beschleunigen.
Wie wirken Klänge energetisch auf den Körper?
Klänge versetzen das Gewebe im Körper in Vibration, was eine zarte Massage auf molekularer Ebene bewirkt. Dies kann blockierte Körperstellen stimulieren und ihnen helfen, zu ihrer harmonischen Frequenz zurückzukehren.
Was ist die Obertonreihe und welche Bedeutung hat sie?
Die Obertonreihe besteht aus Obertönen, die naturgesetzlich zu jedem erzeugten Ton hinzukommen. Die Kenntnis der Obertonreihe und das Eintauchen in sie können zu innerer Ruhe, Sicherheit und erhöhter Empfindsamkeit für äußere Geräusche führen.
Welche Faktoren beeinflussen die Wirkung von Musik?
Die Wirkung von Musik wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter das Musikstück selbst (Komplexität, Lautstärke, Wiederholungen), der Hörer (Erfahrung, Stimmung, Erwartungen) und die Situation (Kontext, Umgebung, soziale Interaktion).
Welche Auswirkungen haben akustische Reize?
Abwechslungsreiche, komplexe Geräusche wirken anregend, geordnete Geräusche beruhigend. Der Informationsgehalt und die Orientierungsreaktion spielen eine Rolle bei der Aktivierung des Zuhörers.
Welche schädlichen Auswirkungen kann Hörschall haben?
Lärm kann zu Hörschäden, Stressreaktionen und anderen gesundheitlichen Problemen führen. Hohe Schallpegel können das Ohr schädigen, insbesondere bei längerer Einwirkung.
Wie kann Musik die Persönlichkeit fördern?
Musik kann der Befriedigung des Bedürfnisses nach Selbstverwirklichung dienen. Sie ist eine Ausdrucksform, die soziale Kompetenz fördert, die Entwicklung der Intelligenz beeinflusst und zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit beiträgt.
Was sind die wesentlichen Punkte des praktischen Teils der Analyse?
Die Studie verwendete Malen zu Musik als Mittel zur Veranschaulichung, wie sich verschiedene Arten von Musik auf Kinder auswirken. Kinder malten zu verschiedenen Musikstücken, und die Farben wurden interpretiert, um die musikalische Wirkung zu bestimmen.
- Quote paper
- Doris Bammer (Author), 2001, Die Wirkung von Musik auf den Menschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103180