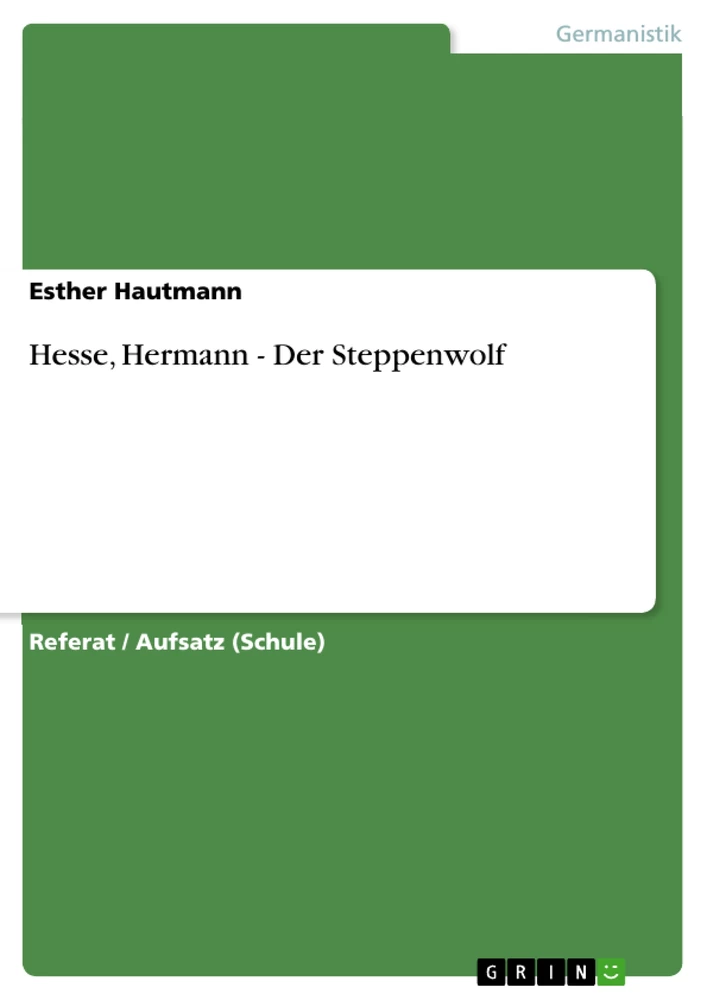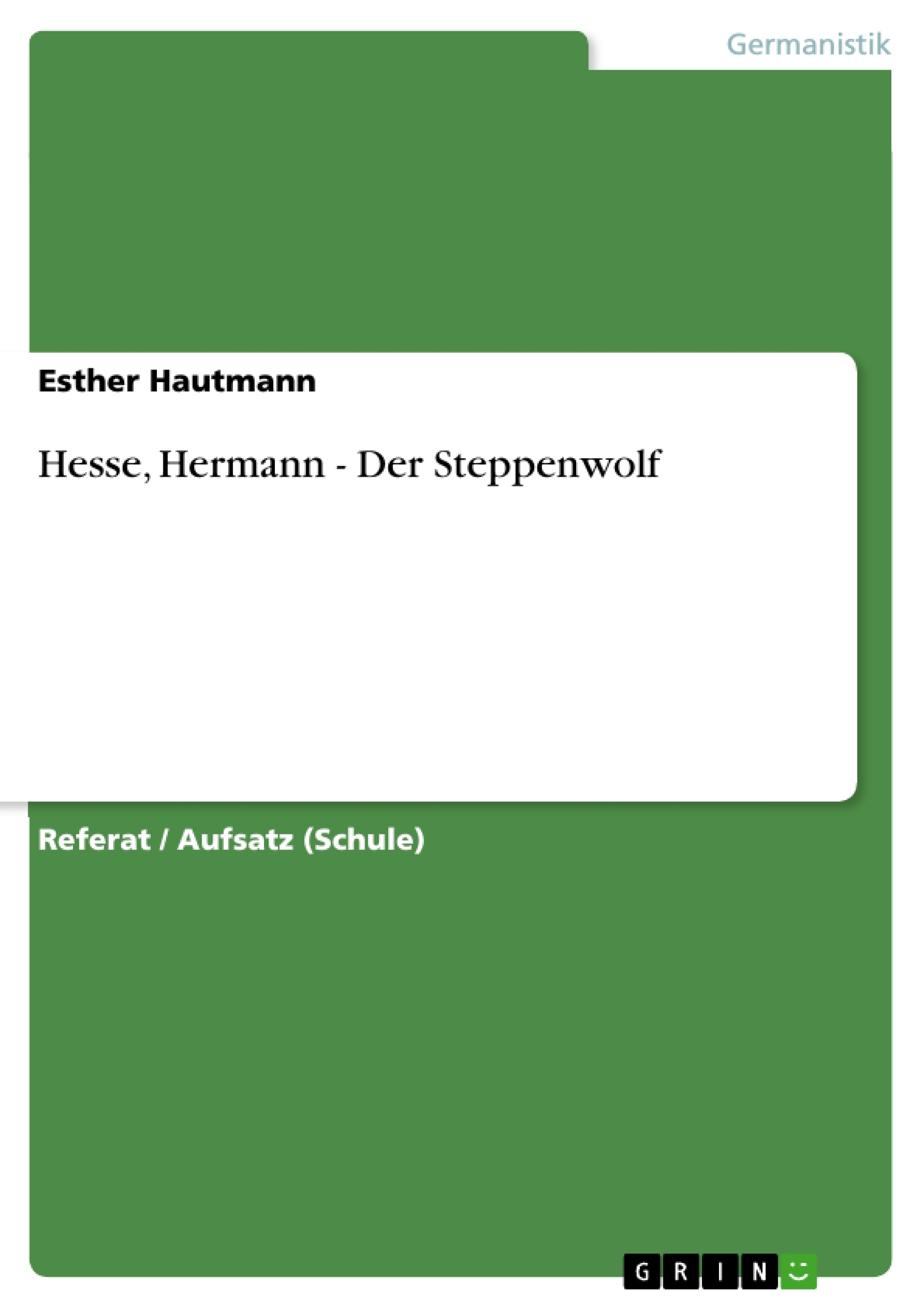Autor und Werk Biographie:
Hermann Hesse wurde am 2. Juli 1877 als Sohn des Missionars Johannes Hesse und Maria Gundert, der Tochter des Indologen Hermann Gundert in Calw, Württemberg geboren. 1890 besuchte er die Lateinschule in Göppingen, um eine Laufbahn als evangelischer Theologe einzuschlagen. Er flüchtete aber aus dem evangelischen Seminar, da er „entweder Dichter oder gar nichts“ werden wollte. Zunächst begab er sich jedoch von 1895 bis 1898 in eine Buchhändlerlehre in Tübingen und wurde erst 1904 freier Schriftsteller in Gaienhofen am Bodensee. Er heiratete Maria Bernoulli, die ihm 3 Söhne gebar. Von 1910 bis 1912 unternahm Hesse mehrere Reisen, mitunter nach Österreich, Italien, Indien und in die Schweiz. 1919 trennte er sich von seiner Familie und der schizophren gewordenen Ehefrau und zog nach Montagnola bei Lugano in der Schweiz um. 1924 wird er schließlich Schweizer Staatsbürger und ehelicht Ruth Wenger. Doch auch diese Ehe ist zum Scheitern verurteilt. 1931 vermählt sich Hesse mit Ninon Dolbin, seiner 3. und letzten Frau. Zur Zeit des Nationalsozialismus galt Hesse als Vaterlandsverräter, seine Werke wurden als entartete Kunst und völkerfeindlich verurteilt und aus diesem Grund verboten. 1946 aber, kurz nach Ende des Krieges wurde dem Autor der Nobelpreis für Literatur verliehen. Unter anderem war Hesse auch ein Träger des Goethe- und Gottfried- Keller Preises. Am 9.August 1962 stirbt Hesse schließlich an einem Gehirnschlag und wird in Lugano begraben.
Ein bedeutendes Werke Hesses` ist unter anderem der Roman „Peter Camenzind“, mit dem Hesse 1904 der Durchbruch gelang. Auch die folgenden Frühwerke des Autors waren von idyllischer, romantischer Natur. Er schrieb 1906 „Unterm Rad“, 1910 „Gertrud“ und 1914 „Rosshalde“. Die Werke seiner Mannesjahre wiesen oft eher grüblerische, seelanalytische und bekennerhafte Züge auf. Die Romane „Demian“ von 1919, „Klingors letzter Sommer“ von 1920, „Siddharta“ von 1922, der „Steppenwolf“ von 1927 und der 1930 veröffentlichte Roman „Narziß und Goldmund“ sind typische Vertreter für diese Schaffenszeit des Künstlers. In seinen Spätwerken „Die Morgenlandfahrt“, „Das Glasperlenspiel“ und der „Traumfährte“ beschäftigt sich Hesse vermehrt mit der Vereinbarung der östlichen und westlichen Geisteswelt.
Entstehungsgeschichte
Der Roman Steppenwolf geht aus einer schweren seelischen Krise des damals knapp 50 jährigen Autors hervor. 1922 schreibt Hesse eine Art Vorarbeit, das Fragment „Aus dem Tagebuch eines Entgleisten“. Im November 1924 beginnt er die Arbeit am Steppenwolf. Der Roman erscheint schließlich im Juni 1927 im S. Fischer Verlag Berlin.
Vorstellen der wichtigsten Personen
Harry Haller, der „Steppenwolf“, ist die Hauptperson des Romans. Er ist ein knapp 50 jähriger sensibler, hoch vergeistigter, intelligenter Mensch, der Mozart und Goethe verehrt. Äußerlich betrachtet ist er höflich, etwas unordentlich gekleidet, von Gicht geplagt, einsam und isoliert. In ihm leben 2 Persönlichkeiten, die eines Wolfes und die eines Menschen. Er verachtet das Bürgertum und fristet das Dasein eines Außenseiters.
Hermine ist eine junge Prostituierte, die durch ihr dominantes Auftreten Harry zurück in das normale, bürgerliche Leben führt. Sie hat ein Knabengesicht und ist trotz ihres Berufes eine gläubige Christin.
Pablo ist ein leichtlebiger, junger und hübscher Südamerikaner oder Spanier. Er spielt mit Leidenschaft Saxophon und genießt das ausschweifende Leben. Er ist der Besitzer des Magischen Theaters.
Maria, eine sehr schöne Prostituierte und Freundin Hermines ist im Roman ein Symbol für das oberflächliche, vergnügungsorientierte Leben. Sie führt Harry in diese schillernde Welt der Erotik und Ekstase ein.
Inhalt
Hermann Hesse in einem Brief an Georg Reinhardt (18.8.1925) :
„ es ist die Geschichte eines Menschen, welcher komischerweise darunter leidet, dass er zur Hälfte ein Mensch, zur andern Hälfte ein Wolf ist. Die eine Hälfte will fressen, saufen, morden und dergleichen einfache Dinge, die andere will denken, Mozart hören und so weiter, dadurch entstehen Störungen, und es geht dem Mann nicht gut, bis er entdeckt, dass es zwei Auswege aus seiner Lage gibt, entweder sich aufzuhängen oder aber sich zum Humor zu bekennen.“
Der Roman ist in 3 Hauptabschnitte eingeteilt und weist 3 verschiedene Erzählperspektiven auf. Der erste Teil ist das „Vorwort des Herausgebers“. Ein fiktiver Editor übernimmt die Funktion eines Ich- Erzählers. Im bürgerlichen Haus der Tante des Herausgebers mietet sich ein knapp 50 jähriger namens Harry Haller in die Mansardenwohnung ein. Der Neffe berichtet von der Bekanntschaft zu Haller und beschreibt ihn als einen ungeselligen, höflichen, unsorgfältig gekleideten Menschen, der sich nach näherem Kennen lernen als ein hochgeistiger, intelligenter, belesener und sensibler Zeitgenosse entpuppt. Haller bezeichnet sich selbst als den „Steppenwolf“ und fristet ein isoliertes, einsames Dasein in seiner unordentlichen und chaotischen Wohnung. Er führt während seines 9-10 monatigen Aufenthalts in der Stadt alles andere als ein geregeltes, bürgerliches Leben. Ohne Beruf und tägliche Pflichten lebt er zurückgezogen in einer Welt, bestehend aus Mozart, Goethe, Novalis und anderen Literaten und Musikern. Er bezeichnet diese Genies als die „Unsterblichen“, die den Menschen ein großes Kulturgut hinterlassen haben und sich von der Masse der Menschheit abheben.. Eines Tages verschwindet Harry spurlos aus der Stadt und hinterlässt nur ein Manuskript, das den Namen „Harry Hallers Aufzeichnungen - Nur für Verrückte“ trägt. Der Herausgeber findet diese tagebuchähnlichen Notizen Hallers` beim Durchstöbern der verlassenen Wohnung.
In diesen Aufzeichnungen erfährt der Leser mehr von dem Ich- Erzähler Harry Haller, einem Menschen, der nach der Scheidung seiner Frau dem Alltagsleben immer mehr entrückt ist und allmählich an ihm verzweifelt. Das Manuskript ist ein durchgehender innerer Monolog, in dem Harry von seinen ständigen Selbstmordgedanken berichtet. Er verachtet das mittelmäßige, normale und durchschnittliche Leben des Bürgers, ein sinnloses Leben, ohne intensive Erfahrungen und Emotionen, ohne Leidenschaften, ohne Ekstase, Dichtung und Erschütterungen, dessen verlogene Zufriedenheit Haller mehr als alles andere verhasst ist. Komischerweise übt diese Bürgerlichkeit jedoch eine starke, nahezu kindliche Anziehungskraft auf ihn aus. Er genießt beispielsweise die Sauberkeit der bürgerlichen Häuser und ist vom Anblick perfekt und penibel arrangierter Blumenensembles nahezu ergriffen und gerührt. Haller fühlt sich in der schillernden Konsum- und Industriegesellschaft der 20er Jahre nicht wohl, bezeichnet sich selbst als „Eremit“ und findet kein Vergnügen an allem, was modern ist: weder kann er die Faszination von Jazzmusik, Tanzbällen und Bars nachvollziehen, noch gelingt es ihm, ohne größten Widerwillen ein modernes Buch zu lesen oder das Kino zu besuchen.
Als der Weltfremde eines späten Abends wieder einmal durch die regennassen Gassen streift, erhält er unerwarteter Weise von einem Fremden (von Pablo, wie sich später heraus stellt) ein kleines Büchlein, eine Art Jahrmarktheftchen, mit dem Titel „Traktat vom Steppenwolf. Nicht für Jedermann“ überreicht. Zuhause angekommen liest Harry sogleich das Heft mit gespannter Aufmerksamkeit. Ein olympischer, bzw. auktorialer, allwissender Erzähler berichtet von Harry, dem Steppenwolf und stellt eine Art Charakterisierung bzw. innere Biographie oder Diagnose Hallers auf. Er beschreibt Harry als einen Menschen, der an einer inneren Zerrissenheit leidet und glaubt, zur einen Hälfte ein Mensch und zur anderen Hälfte ein Wolf, folglich ein Mensch mit 2 Seele n zu sein. Der Mensch in ihm verrichtet gute Taten, ist höflich, klug, kultiviert und angepasst, während der Wolf die animalische Natur vertritt: diese will körperlichen Trieben nachgeben, sucht nach gefühlsintensiven Erfahrungen und urteilt ständig mit verachtendem Blick über die Sittlich- und Manierlichkeit der Menschen. Das Problem des Steppenwolfs ist, dass stets beide Komponenten seiner Seele gleichzeitig zu Werke und selten im Einklang miteinander sind. Sein Handeln und Denken ist so nie richtig, da es von der Gegenseite, also dem Mensch oder dem Wolf stets kritisch überprüft wird. Harry glaubt, sich in einer solchen Sinnesspaltung zu befinden, worin die Wurzel seines ganzen Leids und Unglücks zu liegen scheint. Das Büchlein belehrt den Lesenden allerd ings eines Besseren und entwaffnet diese Theorie als simplen Dualismus. Der Mensch besteht nämlich nicht nur aus einer oder zwei Seelen, sondern sein Charakter ist in unzählige Persönlichkeiten gespalten. Um diese Persönlichkeiten in Einklang und Harmonie zu bringen und so das normale Alltagsleben zu ertragen und genießen zu können gibt der Traktrat 2 Lösungsvorschläge. Der Steppenwolf müsste einmal gezwungen sein, sich selbst gegenübergestellt zu werden und so in das Chaos seiner eigenen Seele hineinblicken zu können. Entweder würde der Steppenwolf so zerstört werden, sich also umbringen, oder aber es würde unter dem Licht des Humors zu einer Vernunftehe zwischen dem Wolf und dem Mensch, dem Trieb und dem Geist kommen.
Harry trägt sich nach dem Lesen des Büchleins erneut mit schweren Selbstmordgedanken, die ihm jederzeit die Möglichkeit zur Flucht aus seinem verkorksten Leben bieten und es ihm so erträglicher gestalten. Haller macht noch einen weiteren Versuch, ins normale Leben zurückzufinden. Er nimmt die Einladung eines ehemaligen Freundes, eines Professors an, beleidigt aber ein Goetheabbild seiner Frau und verlässt nach einem daraus resultierenden Streit wütend das Haus des Gelehrten. Nun ist er entgültig verzweifelt und beschließt, durch seinen Freitod aus dem ihm verhassten Leben zu scheiden. Trotz seines festen Entschlusses scheint er sich vor dem Tod und der Heimkehr in seine Wohnung zu fürchten. Es verschlägt ihn in das Wirtshaus zum „Schwarzen Adler“, wo er Hermine, eine junge Prostituierte kennen lernt. Haller ist sofort verzaubert und fasziniert von dem dominanten, selbstbewussten Fräulein, dass ihn und seine Entrüstung über das hässliche Goethebild versteht. Hermine ist seine Anima, der weibliche Teil seiner Persönlichkeit. Sie verabreden sich zum Essen und in den folgenden Tagen wird Hermine zu Harrys Tanz- und Lebenslehrerin. Haller, dem alles Moderne, so auch das Tanzen aufs schärfste zu Wider ist, beginnt unter den Fittichen Hermines aufzublühen. Sie lernt ihm, Gefallen an der normalen, realen Welt zu haben. Dieser neue Horizont eröffnet Haller ein Vergnügen bestehend aus Festen, Ausschweifungen, Drogen und der schönen Prostituierten Maria, einer Freundin Hermines, die diese auf ihn ansetzt und in die er sich verliebt. Er beginnt, die verhasste Welt als solche zu akzeptieren und sieht sie nun aus einem positiven Blickwinkel. Auf einem Maskenball wird Haller durch Drogen in die Welt des „Magischen Theaters“ von Pablo versetzt. Das magische Theater ist eine unreale, zeitlose Welt, in dem Harry der Zugang zu seiner Innenwelt und seiner damit verbundenen Selbsterfahrung geöffnet werden soll. Ziel dieses Spiegelkabinetts ist es, dass Harry seine zahlreichen Persönlichkeitsanteile kennen lernt und begreift, dass ein glückliches Dasein des Menschen auf Humor basiert. Dieser Lösungsvorschlag wurde bereits im Tractat angesprochen.
Als erstes betritt Harry eine Tür mit der Aufschrift „Auf zum fröhlichen Jagen! Hochjagd auf Automobile“. Hinter diesem Eingang stößt Harry auf eine Welt, in der Maschine und Mensch miteinander kämpfen. Autos fahren Fußgänger zusammen und Menschen schießen auf umherkreisende Flugzeuge. Haller trifft seinen Jugendfreund Gustav wieder , mit dem er sich leidenschaftlich auf die Jagd auf Automobile macht. Versteckt in einem Baum erschießen sie begierig und mordeslustig sämtliche Autofahrer. In dieser Phantasievorstellung kann Harry seiner Abneigung gegen die Modernisierung der Welt freien Lauf lassen und Selbstjustiz üben.
Anschließend tritt Harry in einen Raum mit der Anschrift „Anleitung zum Aufbau der Persönlichkeit“. Dort wartet ein Schachspieler auf ihn. Seine Schachfiguren sind allerdings keine gewöhnlichen, sondern Nachbildungen der vielen Persönlichkeitsanteile von Harrys Seele. Der Spieler lässt nun die Männchen miteinander spielen, woraufhin sie eine Variation von Beziehungen eingehen. Einige heiraten, andere kämpfen oder vermehren sich. Der Spieler macht Harry so deutlich, dass er sein eigenes Leben durch geschickte Kombination der Figuren, bzw. der Seelen in völlig unterschiedliche Existenzformen bringen kann. Derjenige, der die Fülle seiner Lebensmöglichkeiten ahnt, ist zu Veränderung und Neuanfang bereit, wenn die Umstände seines Lebens es verlangen.
Hinter der nächsten Fassade, dem „Wunder der Steppenwolfdressur“ baut sich vor Hallers Augen eine Zirkuswelt auf. Ein Mensch führt dem Publikum einen dressierten Wolf vor, der entgegengesetzt seiner wilden Natur mit einem Hasen und einem Lamm friedlich posiert. Danach tauschen Bändiger und Wolf die Rollen. Der Mensch vertritt nun das Ursprüngliche des Wolfes und frisst den Hasen und das Lamm. Diese Szene zeigt die Doppelnatur, in der sich Harry zu befinden glaubt.
Die nächste verlockende Anschrift, „Alle Mädchen sind dein“ führt Haller in eine Welt der Liebe. Hier kann er alle verpassten Chancen seines bisherigen Lebens wahrnehmen. Er liebt Tausende von Mädchen und findet so eine absolute Erfüllung seiner Sinne und seiner sexuellen Triebe. Zuletzt tritt Hermine vor ihm auf, in die er sich schließlich verliebt.
Sogar Mozart, einer der Unsterblichen taucht im „Magischen Theater“ auf.
Nach einem ernüchternden Gespräch mit dem Musiker gelangt Haller zur nächsten Tür mit dem Titel „Wie man durch Liebe tötet“. Als er Pablo und Hermine, vom Liebesspiel erschöpft auf dem Boden liegend erblickt, ersticht er aus Eifersucht Hermine. Haller erkennt, dass Hermine durch den Mord zu den Unsterblichen gelangt ist. Mozart erscheint erneut als Repräsentant für die Unsterblichen und gibt Harry nun zu verstehen, dass sein innigster Wunsch, ebenfalls unsterblich zu werden, nicht erfüllbar ist. Harry hat noch nicht gelernt, über sich selbst zu lachen und so den Alltag des Lebens zu meistern. Mozart klärt Haller über die Differenz von Ideal und Wirklichkeit auf. Er sagt: „Sie sollen leben und sie sollen das Lachen lernen. Sie sollen die verfluchte Radiomusik des Lebens anhören lernen, sollen den Geist hinter ihr verehren, sollen über den Klimbim in ihr lachen lernen. Fertig, mehr wird nicht von ihnen verlangt.“
Haller gelangt nach dieser „Standpauke“ zur letzten Logentür des Theaters,zu „Harrys Hinrichtung“. Hier wird der Steppenwolf in einen Hof geführt und von einigen Richtern aufgrund von Hurmorlosigkeit zu ewigem Leben verurteilt und ausgelacht. Harry hat das magische Theater nicht als Schule des Humors begriffen. Er war bisher in der Annahme, dass er nur durch Leiden und Askese in den Kreis der „Unsterblichen“ aufgenommen und sich so von den normalen Herdenmenschen abheben könnte. Nun hat er entgültig gelernt, dass er das alltägliche Leben nur meistern kann, wenn er sich zum Humor bekennt, Toleranz übt und seine Persönlichkeitsanteile in Einklang miteinander bringt.
Zum Schluss des Romans sagt Harry: „Einmal würde ich das Figurenspiel besser spielen. Einmal würde ich das Lachen lernen. Pablo wartet auf mich. Mozart wartet auf mich.
Intention
Hermann Hesse und Harry Haller scheinen nahezu identische Personen zu sein. Hesse übt durch die Sicht des Steppenwolfs Haller Kritik an der Zeit der 20er Jahre. Die zunehmende Technisierung der Welt war für ihn eine Bedrohung der alten Kunst und Kultur und eine Zerstörung jeglichen Ästethikgefühls. Hesse sagte einmal: „Auf eure Welt anders zu reagieren als durch Krepieren oder durch den Steppenwolf, wäre für mich Verrat an allem, was heilig ist.“ Er kritisiert die moderne Zivilisation, deren auffälligstes Merkmal eine dekadente Lebensweise der Masse war. Der Mensch war nicht mehr edlen Werten zugewandt, sondern durch seine oberflächliche Vergnügungssucht verblendet. Goethe und Mozart hatten keinen Platz in einer solchen industrialisierten Welt, in der Jazzmusik und Tanzbars Einzug genommen hatten. Dieser Normenverfall griff auch auf die Friedens- und Kriegsvorstellungen der Menschen über. Eine allgemeine Kriegstreiberei war die Folge. Die Bürger wurden damals gewissermaßen zum Krieg erzogen, und gegen jegliche pazifistische Einstellungen gehetzt. Hesse warnt im Steppenwolf mehrmals vor einem bevorstehenden erneuten Krieg.
Vor allem aber stellte Hesse mit dem Steppenwolf seine eigene Krankheit und Krisis der damaligen Zeit dar, aber nicht eine, die zum Tode führt, nicht einen Untergang, sondern das Gegenteil: eine Heilung“. Er rettete sich durch die Schaffung eines Kunstwerks aus seiner Unzufriedenheit mit den zeitlichen Umständen und aus der Last seiner familiären Verhältnisse. Seine erste Frau, Maria Bernoulli wurde geisteskrank, woraufhin Hesses Familienleben 1918 zerbrach. Die Identifikation mit der Romanfigur Harry Haller machte es Hesse möglich, seine innere Zerrissenheit bis ins kleinste Detail zu analysieren. Der Steppenwolf war für Hesse eine Katharsis, eine Reinigung und Überwindung seiner utopisch-tragischen Weltsicht. Hesse plagten wie Harry schwere Selbstmordgedanken und das Datum seines 50. Geburtstages sollte wie für Haller ein Freibrief zum Selbstmord sein.
Es war auch das Ziel des Autors, eine Ich-Krise und die Spaltung einer menschlichen Persönlichkeit allgemein verständlich zu machen und zu vermitteln. Seine Krise war die einer ganzen Generation, die zwischen 2 Kriegen und zwischen 2 Welten lebte.
Einflüsse
Der Steppenwolf war sehr stark von der Philosophie Nietzsches geprägt.
Demzufolge gibt es Übermenschen, die Unsterblichen, die sich aus der Masse der Herdenmenschen herausheben. Nietzsche verehrte eine absolutistische Herrschaft und verachtete eine demokratische Gesellschaftsordnung. Er gab die Verantwortung lieber in die Hände eines einzelnen Genies als in die Breite Masse des dümmlichen Volkes. Es finden sich auch viele Ansätze von Nietzsches Kulturpessimismus im Roman wieder. Hesse hat sich intensiv mit den Schriften des Philosophen auseinandergesetzt, die ein Bild der Dekadenz und des Normenverfalls der Menschheit entwerfen.
Auffällig sind auch das Verwenden vieler Grundlagen der Tiefenpsychologie des Psychoanalytikers C. G. Jung. Hesse führte in der Zeit seiner Lebenskrise häufig therapeutische Gespräche mit Doktor J.B. Lang, einem Schüler C. G. Jungs. Die Theorien der beiden Wissenschaftler halten an der Heilung der Psyche durch Symbole im Traum, hier durch die Versetzung in die Phantasiewelt des Magischen Theaters fest. Hier werden die abgespaltenen Persönlichkeitsanteile wieder integriert.
Die Rezeption
Der Steppenwolf rief bei seiner Erscheinung 1927 heftige konträre Reaktionen bei Freunden und Gegnern Hesses hervor. Die Leser seiner früheren, von Romantik und Empfindsamkeit geprägten Werke fühlten sich durch die schroffen Bekenntnisse des Steppenwolfs brüskiert und lehnten die psychoanalytische und schonungslose Darstellung menschlicher Abgründe entrüstet ab. Egon Schwarz sagte damals: „Sein Buch bleibt eine giftige, gefährliche Wirrnis, giftig in seiner ungezügelten Sinnlichkeit, gefährlich in seiner radikalen und ätzenden Verneinung aller Lebenswerte, eine Wirrnis abstruser, schillernder und paradoxer Ideen. Großes stilistisches Können ist hier ziellos und maßlos vergeudet.“
Viele reagierten mit Hohn und Verachtung, viele weil sie Hesses Werk missverstanden. Schriftstellerkollegen wie Thomas Mann dagegen reagierten mit begeisterter Anerkennung. So sagte Thomas Mann: „...ist es nötig zu sagen, dass der Steppenwolf ein Romanwerk ist, das an experimenteller Gewagtheit dem Ulysses, den Faux- Monnayeurs nicht nachsteht? Der Steppenwolf hat mich seit langem zum ersten mal wieder gelehrt, was Lesen heißt.“ In den folgenden Jahren setzte eher ein rückläufiges Interesse am Steppenwolf ein.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Hermann Hesse?
Hermann Hesse war ein deutsch-schweizerischer Schriftsteller, geboren am 2. Juli 1877 in Calw, Württemberg, und gestorben am 9. August 1962 in Lugano. Er gewann 1946 den Nobelpreis für Literatur. Zu seinen bekanntesten Werken zählen "Peter Camenzind", "Unterm Rad", "Demian", "Siddhartha", "Der Steppenwolf" und "Das Glasperlenspiel".
Was ist die Entstehungsgeschichte des Romans "Der Steppenwolf"?
Der Roman entstand aus einer schweren seelischen Krise Hesses. Er begann mit dem Fragment "Aus dem Tagebuch eines Entgleisten" (1922) und begann die Arbeit am "Steppenwolf" im November 1924. Der Roman wurde im Juni 1927 veröffentlicht.
Wer sind die wichtigsten Personen im Roman "Der Steppenwolf"?
- Harry Haller (Steppenwolf): Die Hauptperson, ein sensibler, hochintellektueller Mann, der sich zwischen der menschlichen und der wolfsartigen Seite zerrissen fühlt.
- Hermine: Eine junge Prostituierte, die Harry zurück ins bürgerliche Leben führt.
- Pablo: Ein lebenslustiger Südamerikaner, der Saxophon spielt und das Magische Theater besitzt.
- Maria: Eine Prostituierte und Freundin von Hermine, die Harry in die Welt der Erotik einführt.
Was ist der Inhalt des Romans "Der Steppenwolf"?
Der Roman handelt von Harry Haller, der sich als "Steppenwolf" bezeichnet und an seiner inneren Zerrissenheit leidet. Er verachtet das Bürgertum, fühlt sich aber gleichzeitig von ihm angezogen. Durch die Begegnung mit Hermine und den Besuch des Magischen Theaters lernt er, das Leben anzunehmen und den Humor zu entdecken. Der Roman ist in drei Hauptabschnitte unterteilt: "Vorwort des Herausgebers", "Harry Hallers Aufzeichnungen (Nur für Verrückte)" und die Ereignisse, die Harry durchlebt.
Was ist das "Magische Theater" im Roman?
Das Magische Theater ist eine irreale Welt, in der Harry Zugang zu seiner Innenwelt und Selbsterfahrung erhält. Es ist ein Spiegelkabinett, das ihm hilft, seine Persönlichkeitsanteile kennenzulernen und zu verstehen, dass ein glückliches Dasein auf Humor basiert.
Was ist die Intention des Romans "Der Steppenwolf"?
Hesse kritisiert durch die Figur des Harry Haller die Zeit der 1920er Jahre, insbesondere die zunehmende Technisierung und den Verfall von Werten. Er verarbeitet seine eigene Lebenskrise und die Zerrissenheit seiner Persönlichkeit. Der Roman soll die Ich-Krise und die Spaltung einer menschlichen Persönlichkeit verständlich machen.
Welche Einflüsse prägten den Roman "Der Steppenwolf"?
- Friedrich Nietzsche: Nietzsches Philosophie des Übermenschen und Kulturpessimismus beeinflussten Hesses Darstellung der "Unsterblichen" und die Kritik am Normenverfall der Menschheit.
- Carl Gustav Jung: Die Tiefenpsychologie Jungs, insbesondere die Bedeutung von Symbolen im Traum und die Integration abgespaltener Persönlichkeitsanteile, finden sich im Magischen Theater wieder.
Wie wurde der Roman "Der Steppenwolf" aufgenommen?
Bei seiner Veröffentlichung rief der Roman heftige, konträre Reaktionen hervor. Viele Leser kritisierten die schonungslose Darstellung menschlicher Abgründe. In den 1960er Jahren erfuhr der Roman jedoch ein Revival, besonders durch die Hippie-Bewegung, die sich mit dem einsamen Künstler-Ich identifizieren konnte.
- Quote paper
- Esther Hautmann (Author), 2001, Hesse, Hermann - Der Steppenwolf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103163