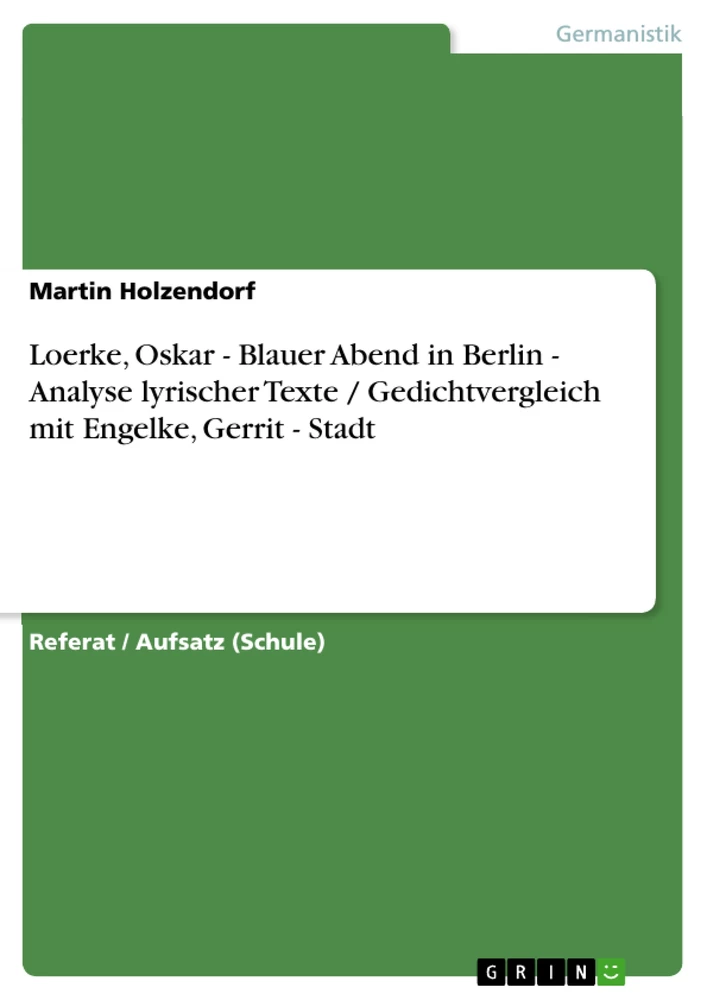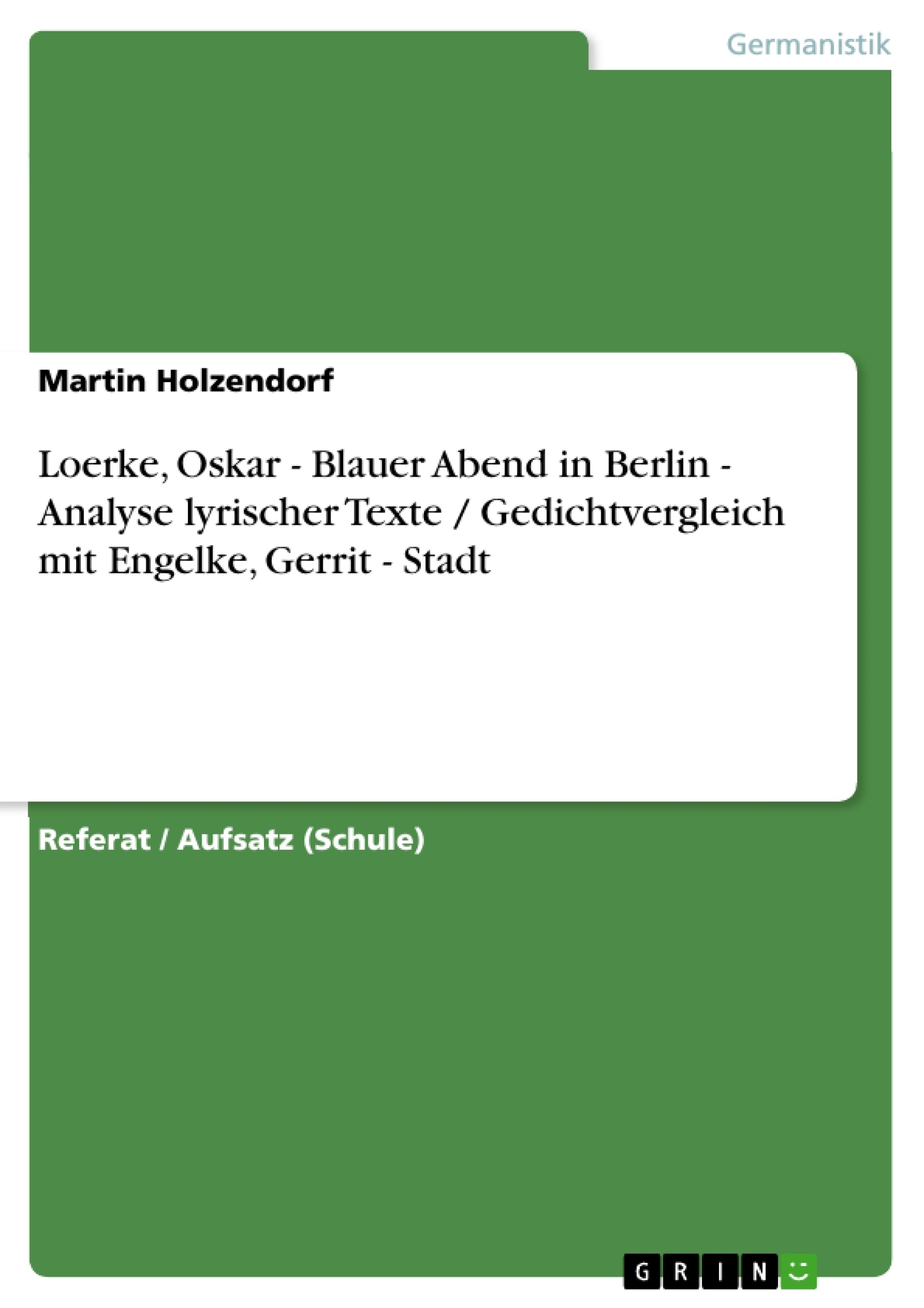Was bedeutet es, in einer Stadt gefangen zu sein, wo der Himmel selbst in steinerne Kanäle gezwängt wird? Diese Frage erkundet die vergleichende Analyse zweier prägnanter Gedichte des frühen 20. Jahrhunderts: Oskar Loerkes „Blauer Abend in Berlin“ und Gerrit Engelkes „Stadt“. Tauchen Sie ein in eine Epoche des Umbruchs, in der die industrielle Revolution das Stadtbild und die menschliche Erfahrung neu formte. Der Vergleich enthüllt, wie Loerke und Engelke, obwohl beide vom Expressionismus geprägt, unterschiedliche Perspektiven auf das Leben in der Großstadt entwerfen. Loerke findet in der Berliner Abenddämmerung noch einen Hauch von Poesie, indem er die Stadt mit einer Wasserlandschaft vergleicht und so eine subtile Schönheit inmitten des Urbanen entdeckt. Engelke hingegen zeichnet ein düsteres Bild der Industrialisierung, in dem das Individuum in einem Labyrinth aus Stein und Stahl verloren geht, ein Mahlstrom der Entfremdung und des Verlusts. Die Analyse beleuchtet die lyrische Stimmung, die formale Struktur und die klanglichen Mittel beider Gedichte, um ihre jeweiligen Aussagen über das Verhältnis von Mensch, Natur und Stadt zu entschlüsseln. Entdecken Sie, wie diese Dichter das Stadtmotiv nutzen, um existentielle Fragen nach Identität, Freiheit und dem Preis des Fortschritts zu stellen. Eine tiefgreifende Untersuchung, die nicht nur die literarischen Feinheiten dieser Werke aufzeigt, sondern auch die zeitlosen Herausforderungen des Lebens in einer zunehmend urbanisierten Welt reflektiert. Dieses Buch bietet eine spannende Reise durch die expressionistische Lyrik und lädt den Leser ein, über die eigene Beziehung zur Stadt und die darin verborgenen Schönheiten und Schrecken nachzudenken. Untersuchen Sie die Verwendung von Metaphern, Vergleichen und Personifikationen, die das Leben in der Stadt sowohl erhellen als auch verdunkeln. Erforschen Sie die subtilen Unterschiede in der Wortwahl und Bildsprache, die Loerkes Werk eine gewisse Hoffnung verleihen, während Engelkes Vision von Resignation und Verzweiflung geprägt ist. Finden Sie heraus, wie beide Dichter, trotz ihrer unterschiedlichen Ansätze, ein kraftvolles Zeugnis für die komplexe und oft widersprüchliche Erfahrung des modernen Stadtlebens ablegen und somit eine Grundlage für die sozialkritische Literatur des 20. Jahrhunderts schufen.
Gliederung des Textvergleiches
A. Einleitung: „Blauer Abend in Berlin“ und „Stadt“- zwei Gedichte, die das Stadtmotiv als Thema haben.
B. Hauptteil :
1 Analyse des Gedichtes „Blauer Abend in Berlin“ nach Inhalt und Form
1.1 Lyrische Stimmung im Gedicht
1.2 Aufbau und Struktur
1.3 Aussagen zum lyrischen Subjekt
1.4 Untersuchung der Klangmittel
1.5 Untersuchung der inhaltlichen Positionen in Verbindung mit der Bildhaftigkeit
2 Analyse des Gedichtes „Stadt“ nach Inhalt und Form
2.1 Lyrische Stimmung im Gedicht
2.2 Aufbau und Struktur des Poems
2.3 Aussagen zum lyrischen Subjekt
2.4 Untersuchung der Klangmittel
2.5 Untersuchung der inhaltlichen Positionen in Verbindung mit der Bildhaftigkeit
3 Vergleich der beiden Gedichte
3.1 Gemeinsamkeiten der Gedichte
3.2 Unterschiede der Gedichte
3.3 Schlussfolgerung
C. Schluss : ,Das Abenteuer Großstadt‘
Die beiden Gedichte „Blauer Abend in Berlin“ von Oskar Loerke und „Stadt“ von Gerrit Engelke behandeln auf verschiedene Art und Weise das Stadtmotiv. Loerke gilt als Wegbereiter der modernen Lyrik. Sein Gedicht „Blauer Abend in Berlin“ entstand im Jahre 1911. Der frühvollendete Expressionist Gerrit Engelke brachte sein Gedicht „Stadt“ im Jahre 1912 hervor.
Das zu vergleichende Gedicht „Blauer Abend in Berlin“ von Oskar Loerke greift das Stadtmotiv auf. In diesem beleuchtet er das Verhältnis zwischen der Stadt und den Menschen, die in ihr Leben. Es kommt zum Ausdruck, dass der Mensch von der Stadt eingenommen wird und dadurch seine eigenen Wurzeln verloren hat. Man könnte es so ausdrücken, dass der Mensch von der Stadt beherrscht wird. Die Stadt zwingt ihm seinen Willen auf. Des Weiteren bestimmt sie sein Lebenstempo und die Richtung, in die er sein Leben zu steuern hat. Man erkennt, dass die Stadt den Menschen völlig vereinnahmt hat. Dieses Verhältnis zwischen Mensch und Stadt wird mittels von Vergleichen zu einer Wasserlandschaft aufgebaut. Dennoch ist keine negative Stimmung in bezug auf die Stadt, wie in anderen expressionistischen Gedichten zu erkennen.
In diesem Gedicht liegt eine Antithetische Bauform vor. Damit diese Behauptung nicht einfach so im Raum stehen bleibt, muss man genauer darauf eingehen. In „Blauer Abend in Berlin“ wird ein Gegensatz zwischen Mensch und Natur aufgebaut. Die Natur wird in Form einer Wasserlandschaft dargestellt, die als Vergleichsbasis zur Stadt genutzt wird. Mit diesem Punkt wird der Gegensatz festgesetzt. Dieser Gegensatz bleibt bis zum Ende des Gedichts bestehen und wird auch nicht aufgehoben. Die Form des Gedichts ist die älteste, strengste lyrische Form, die es gibt. Es handelt sich hierbei um das klassische Sonett und besteht aus insgesamt 14 Verszeilen. So stehen am Anfang zwei Quartette. Den Schlussteil, sprich die letzten zwei Strophen, bilden zwei Terzette. Dies ist, wie schon erwähnt, das klassische Sonett, das häufig von Andreas Gryphius verwendet wurde. In den Quartetten wird der Vergleich zwischen der Stadt und der Wasserlandschaft aufgebaut. Es wird das Aussehen der Stadt beschrieben. In den Terzetten fällt im Schlussteil das Hauptaugenmerk auf die Menschen, die in einer solchen Stadt wohnen. Es lassen sich Rückschlüsse auf ihr Leben ziehen, auf die im weiteren Verlauf der Analyse eingegangen wird. Des Weiteren ist zu erwähnen, dass es nicht große Abweichungen in der Gestaltung der Zeilenlängen gibt. Im gesamten Verlauf des Gedichtes „Blauer Abend in Berlin“ bleibt der Sprecher neutral. Das lyrische Ich gibt sich an keiner Stelle des Poems zu erkennen und nimmt eindeutig eine Beobachterposition ein, aus der die Stadt beschrieben wird. Da das lyrische Ich eine Art Position des Beschreibenden einnimmt, also eine Art Distanz zur Stadt hat, spricht man hierbei von einem lyrischen Subjekt. Es wird an keiner Stelle direkt benannt, sondern es wird nur der Gegensatz zwischen Mensch und Natur aufgebaut. Es beschreibt die Stadt mit Hilfe von Bilder einer Wasserlandschaft und schafft es so einen Eindruck von den Menschen zu vermitteln, die in einer solchen Stadt leben. Um dies zu erreichen ist diese Beobachterposition des lyrischen Subjektes wichtig.
Bei der Betrachtung eines Gedichtes muss man auf die vorhandenen Klangmittel eingehen.
Als erstes ist kurz zu erwähnen, dass in diesem Gedicht männlich stumpfe, weiblich klingende sowie reiche Kadenzen vorhanden sind. Die reichen Kadenzen kommen dabei am häufigsten vor. In „Blauer Abend in Berlin“ liegt ein 5- hebiger Jambus vor. Er wird nicht unterbrochen, sondern zieht sich durch das gesamte Gedicht. Aus diesem Grunde kann man sagen, dass das Gedicht streng metrisch gebunden ist. Weiterhin liegen in diesem Gedicht zwei unterschiedliche Reimarten vor. In den ersten beiden Strophen handelt es sich um den umschließenden Reim der Form abba. In der dritten und vierten Strophe tritt der Schweifreim auf. Er hat die Form cdd. Da Reim und Metrum vorhanden sind, ist es einem auch möglich auf die Gestaltung des Rhythmus einzugehen. Da ein Jambus und verschiedene Endreimarten vorliegen, kann man auf einen fließend strömenden Rhythmus schließen. Eine Wasserlandschaft steht niemals still und es ist immer irge nd etwas in Bewegung. Dazu braucht man sich nur einen Gebirgsbach vorzustellen, der sich seinen Weg ins Tal bahnt.
Oder man nimmt nur einmal die Wellen, die bei Wind auf jedem größeren Gewässer zu finden sind. Man kommt zu dem Schluss, dass die Klangmittel auch die inhaltlichen Aussagen in diesem Gedicht unterstützen und sie eindringlicher machen.
In diesem Gedicht wird sehr viel mit Bildern und Vergleichen gearbeitet. So wird schon in der ersten Verszeile das Bild eines Flusses aufgebaut. Es wird erstmals der Vergleich zwischen der Stadt und der Natur hergestellt, denn „Der Himmel fließt in steinernen Kanälen;“ (Zeile eins). Mit der Periphrase „steinernen Kanälen“ (Zeile eins) werden die Hochhäuser der Stadt umschrieben, zwischen denen sich der Himmel seine n Weg bahnen muss. Auf dieses Beispiel wird auch in den Zeilen zwei bis vier eingegangen. So sind die Straßen die Kanäle, die „vom Himmelblauen“ durchströmt werden. In der vierten Verzeile wird mit Hilfe eines indirekten Vergleiches „Kuppeln gleichen Bojen, Schlote Pfählen“ (Zeile vier) dieses Bild noch einmal konkretisiert. Der Leser gewinnt so eine genaue Vorstellung über den Symbolgehalt des Gedichtes, den er benötigt, um es verstehen zu können. Ein Enjambement befindet sich zwischen der ersten und zweiten Strophe. Es erfolgt kein Stop am Strophenende, denn der Inhalt und der Sprechfluss drängen in die nächste Strophe. In der fünften Verszeile befindet sich eine Alliteration „Schwarze Essendämpfe schwelen“. Mit dem direkten Vergleich in Zeile sechs, dass diese „wie Wasserpflanzen anzuschauen“ sind, beschreibt er wieder das Bild der Stadt. Diese beiden Punkte sind eigentlich kontrastiv gesetzt, denn die Wendung in Zeile fünf ist negativ und die in Zeile sechs ist positiv konnotiert. Durch diese Verbindung erreicht er, dass dies als nicht so schlimm angesehen wird und verleiht somit auch noch Rauch aus Schornsteinen einen schönen Touch. Die Menschen in der Stadt sehnen sich nach der Freiheit und einen unbeschwerten Leben. Diesen Eindruck erwecken die Verzeilen sieben und acht, in denen das Substantiv „Himmel“ (Zeile acht) vorkommt. Dieses Substantiv ist als Symbol für grenzenlose Freiheit, das Paradies und für die unendliche Schönheit der Natur zu betrachten. Die Menschen wollen ausbrechen und sehnen sich nach der Freiheit, denn sie „beginnen sacht vom Himmel zu erzählen,“ (Zeile acht). Sie sind aber zu weit entfernt von dem erlösenden Himmel und bleiben somit in der Stadt ,gefangen‘. In der neunten Verzeile wird eine Synestie verwendet. Gemeint ist die Verbindung von zwei unterschiedlichen Sinneseindrücken. Dies ist die Wortverbindung „blaue Melodien“. „Wie eines Wassers Bodensatz und Tand“ ist ein weiterer Vergleich. Dieser Vergleich wird in der Verbindung der Melodien gebraucht. Die Menschen sind in diesem Gedicht ein Teil des Wassers. Die Melodie „regt [...] des Wassers Wille und Verstand“ (Zeile elf). Die Personifikation drückt aus, dass dadurch der (Stadt-) Mensch auch geleitet wird und fast keinen Einfluss auf den Verlauf seines Lebens in der Stadt hat. Es ist immer das gleiche monotone Spiel für die Menschen in der Stadt, aus dem sie nicht ausbrechen können. Des „Wassers Wille“ (Zeile elf) ist weiterhin eine Alliteration. In der Zeile zwölf wird eine Kette mit den Verben „Dünen, Kommen, Gehen, Gleiten, Zie hen“ aufgebaut. Dies verdeutlicht die Bewegungen, die das Wasser auf Grund der Melodie nur ausführen kann. Da, wie schon beschrieben, der Mensch in diesem Gedicht auch nur ein Teil des Wassers ist, ist so das Tempo und die Richtung seines Lebens schon vorgegeben. Der letzte direkte Vergleich dieses Gedichtes befindet sich in der dreizehnten Verszeile. Demnach seien die Menschen „wie grober bunter Sand“. Sand ist ein Stoff, der aus winzigen kleinen Steinchen besteht. Wenn der Mensch nun wie Sand ist, könnte das bedeuten, dass das einzelne Individuum an Bedeutung verliert und ganz einfach in der Masse untergeht. So werden sie von der „Wellenhand“ (Zeile vierzehn) gesteuert. Dies ist eine Metapher, die noch einmal den Fakt unterstreicht, dass der einzelne Mensch in der Stadt mit dem Strom mit schwimmt und in der Masse untergeht. Auffällig bei der Betrachtung der sprachkünstlerischen Gestaltung des Gedichtes wird eine Verbkette, die sich durch das Gedicht zieht. Es sind die Verben „fließt“ (Zeile eins), „schwelen“ (Zeile fünf), „stauen“ (Zeile sieben), „entwirrt“ (Zeile neun) und die schon erwähnte Verbkette in der Zeile zwölf. Es sind alles Verben der Bewegung. Sie drücken das schnelle Leben in der Stadt aus. In diesem Gedicht ist ein starke Kontrastierung zwischen Natur und Mensch vorhanden, denn es wird ausschließlich nur von der Natur gesprochen. Die Bilder der Natur sind dazu da, damit der Leser sich das Aussehen der Stadt besser vorstellen kann. Wie oben beschrieben, ist in diesem Gedicht eine große Bildhaftigkeit vorhanden.
Das zweite Gedicht „Stadt“ von Gerrit Engelke greift auch das Stadtmotiv auf. In diesem Gedicht wird das hektische und betriebsame Leben in einer Großstadt aufgezeigt und durch das lyrische Subjekt beschrieben. Es wird indirekt gezeigt, wie die Natur immer mehr durch die Stadt vereinnahmt wurde. Dieses Gedicht greift die Industrialisierung auf und zeigt die Stadt in ihrem ganzen negativen Dasein. In seinen Ausführungen beleuchtet das lyrische Subjekt das Leben der Menschen, die in einer solchen Stadt leben und arbeiten müssen. Er zeigt das Aussehen der Stadt und der umliegenden Gegend und verweist auf die Lebensumstände der Menschen in einer solchen Stadt. Des Weiteren sagt es aus, dass das betriebsame und hektische Leben auch nach Verlusten und Rückschlägen weitergehe, als wäre nichts gewesen. Es wird insgesamt ein sehr negatives Bild der Stadt gezeichnet. Durch die Wahl der Industrialisierung und der Menschen in der Stadt wird ein Gegensatz aufgebaut. Dieser Gegensatz zieht sich durch das gesamte Gedicht und wird auch nicht am Ende aufgelöst, sondern bleibt bestehen. Diese Art der Bauform nennt man antithetisch. In der ersten Strophe wird dabei die Industrialisierung und das Aussehen der Stadt beschrieben. In der zweiten Strophe wird auf die Menschen dieser Stadt eingegangen. Die dritte Strophe beschreibt die Menschen bei ihrer Arbeit und zeigt auf, dass es auch in folge der starken Industrialisierung zu Todesfällen kommt. Dennoch wird keine Lösungsmöglichkeit gegeben und so bleibt dieser Gegensatz bestehen. Er wird nicht gelöst. Das Gedicht weist eine regelmäßige Bauform auf. Es besteht aus drei Strophen à acht Verszeilen. Weiterhin fällt einem bei der Betrachtung auf, dass die Verszeilen eine unterschiedliche Länge haben. Wie schon erwähnt handelt es sich in diesem Gedicht um ein lyrisches Subjekt. Es wird an keiner Stelle des Gedichtes direkt erwähnt oder beschrieben. Man kann also davon ausgehen, dass es eine Art Beobachterposition einnimmt, von der aus das lyrische Subjekt das Geschehen neutral betrachtet. So schildert es die Eindrücke von der Stadt, aber bewahrt immer seine Distanz zu den Ereignissen.
Bei der Analyse eines Gedichtes ist es wichtig, auf die vorhandenen Klangmittel einzugehen. In dem Gedicht „Stadt“ sind alle Kadenzarten vorhanden. So findet man männlich stumpfe, weiblich klingende und reiche Kadenzen. Sie kommen in einem relativ ausgewogenen Verhältnis vor, bei dem keine Art sonderlich hervorsticht. In den einzelnen Strophen vollziehen sich weiterhin Wechsel der Endreimarten. Die ersten vier Verszeilen sind nach dem Schema aabb angeordnet, was dem Paarreim entspricht. Danach folgt immer ein Kreuzreim (cdcd). Bei der Betrachtung des Metrums wird es schon schwieriger. Es ist erst einmal festzustellen, dass ein Jambus vorliegt. Bei diesem Jambus treten innerhalb der Strophen immer Wechsel der Hebungen auf. So sind alle Hebungen vom vier bis zum sieben- hebigen Jambus vorhanden. Es ist aber zu erwähnen, dass dieser auftretende Wechsel sich innerhalb aller drei Strophen an denselben Stellen vollzieht. Da Reim und Metrum vorhanden sind, muss es auch einen Rhythmus geben. Aufgrund des Inhaltes und der Metrik ist ein fließend strömender Rhythmus als richtig zu betrachten. Dieser spiegelt die Schnelllebigkeit der Stadt und der Industrialisierung wieder.
Dieses Gedicht ist sprachlich nicht so einfach zugänglich gestaltet, denn es treten an einigen Stellen Chiffre auf. Dennoch kann man einige sprachkünstlerische Mittel finden, mit deren Hilfe man den Inhalt erläutern kann. So beginnt das Gedicht mit der Periphrase „Zehntausend starre Blöcke“ in der Zeile eins. Dies ist eine Umschreibung für die Häuser der Stadt, die gebaut wurden. Mit der Wortwiederholung „Stein auf Stein“ (Zeile zwei) leitet das lyrische Subjekt die Schilderung ein, die beschreibt, wie ein solches Haus errichtet wird. In der dritten Verszeile ist eine Dreifachalliteration „Block an Block zu einem Berg“. Diese gehört noch zur Beschreibung von der Errichtung der Stadt. „Von vielen Furchen tief durchwühlt“ (Zeile sechs) ist der Berg. Mit dieser Metapher könnten die Straßen und Tunnel gemeint sein, die der Mensch künstlich in den Berg gehauen hat. Sie beschreibt das rücksichtslose Vorgehen der Menschen in der Natur. Sie brauchen ihren Lebensraum. Da muss die Natur weichen. Die Stadt wird durch die Metapher in der siebten Zeile als „große[s] Labyrinth“ bezeichnet. Diese Metapher ist Ausdruck für die Unübersichtlichkeit der Stadt. Man kann sich dort nur schwer zu Recht finden und an jeder Ecke lauern Gefahren. In der darauffolgenden Verszeile ist eine weitere Metapher „Dadurch das Schicksal Mensch um Menschen spült“ zu finden. Es kommt zum Ausdruck, dass der einzelne mit seinen Problemen einfach in der Masse untergeht, da zu viele Menschen in dieser Stadt leben. Alles presst sich durch das „große Labyrinth“ (Zeile sieben). Es wird weiterhin gesagt, dass das große Leben fünfhunderttausend im Kreis rolle (Zeile neun). Damit könnte gemeint sein, dass an jedem Tag derselbe Tagesablauf wie am vorangegangen ist. Es wird also somit ein monotones Leben beschrieben. Wieder erfolgt durch das Substantiv „Rinnen“ (Zeile zehn) eine Periphrase für die Straßen einer Stadt, durch die das Leben gepresst wird. Von der Zeile elf bis zur Zeile fünfzehn erfolgt eine Aufzählung der Orte, an denen man Menschen antreffen könnte. Es folgt in der Zeile sechzehn eine Personifikation „Da schäumt des Menschenstrudels wirre Hitze“. Dies erinnert einen an ein schäumendes Bier, das, wenn man zu viel rein gießt, überläuft. Genauso könnte das auch mit der Stadt gemeint sein. Es sind jetzt schon so viele Menschen da und schäumt schon. Wenn jetzt noch mehr dazukommen, könnte es zu einem Kollaps oder einer Katastrophe kommen. Die ersten zwei Verszeilen der zweiten und dritten Strophe sind als Parallelismus zu betrachten. „Und karrt der Tod auch Hundert täglich fort,/ Es braust der Lärm wie sonst an jedem Ort“ (Zeile neunzehn und zwanzig). Diese Personifikation ist durch ihren Wortlaut negativ konnotiert. Es wird damit gezeigt, dass das Schicksal eines einzelnen Menschen nicht zählt, denn er ist nur eine Ziffer. Es interessiert keinen, wie viele in der Stadt umkommen. Das Leben und Treiben in der Stadt nimmt trotz solcher Nachrichten seinen gewohnten Lauf und nichts deutet auf ein schlimmes Ereignis hin. In den letzten Zeilen des Gedichtes wird gezeigt, dass immer mehr Leute in die Stadt kommen und das Leben ungeachtet solcher Verluste weitergeht. Die Stadt kann nicht durch ein paar Tote beeindruckt werden. Auffällig bei der obigen Betrachtung wurden die häufig verwendeten Metaphern und Personifikationen. Sie lassen die Sprache des Gedichtes ausgeschmückter erscheinen. Des Weiteren bildet jede Strophe eine in sich geschlossene Einheit. Es ist halt der starke Gegensatz, der zwischen Mensch und Industrialisierung aufgezeigt wird.
Beide Gedichte behandeln in ihrem Inhalt das Aussehen der Stadt. Loerke und Engelke wählten das Stadtmotiv, mit dem sie sich auseinander setzen. Beide kommen zu dem Schluss, dass das Individuum in der Stadt nicht zählt. Man geht einfach in der Masse unter und findet keinen Weg sich zu entfalten. In der Stadt ist alles viel zu schnelllebig und man muss aufpassen, wo man bleibt. Der Weg ist für jeden schon vorgefertigt und man hat denselben Trott Tag ein und Tag aus. Des Weiteren sind beide Gedichte zu Ze iten des Expressionismus entstanden. Ihre Erscheinungsdaten liegen nur ein Jahr auseinander. In dieser Phase der Geschichte liefen gerade die Kriegsvorbereitungen für den bald ausbrechenden 1. Weltkrieg. Deshalb ist es auch möglich, dass beide in ihren Gedichten von Schornsteinen und Industrie sprechen. Loerke lässt diesen Punkt nur einmal hervortreten und zwar als er von Schornsteinen sprach, die schwelten. Er konnte dem noch was gutes abgewinnen. Engelke beleuchtet diesen Aspekt in seinem gesamten Gedicht und findet dies einfach abstoßend. Trotzdem könnte es etwas mit dem Krieg zu tun haben. Weiterhin auffällig ist, dass in beiden Gedichten kein lyrisches Ich vorhanden ist. Es ist in beiden Fällen ein lyrisches Subjekt, das die Ereignisse aus einer Art Beobachterposition schildert. So ist es möglich, dass sich der Leser ein eigenes Bild anhand der Beschreibungen machen kann. Des Weiteren ist hervorstechend, dass beide Gedichte über eine Metrik verfügen, d.h., beide verfügen über einen eindeutigen Rhythmus, einen Jambus und über einen Endreim. Was jedoch nach dem Punkt des lyrischen Subjektes am augenfälligsten ist, ist die Bauform. Beide Gedichte weisen eine Antithetische Bauform auf. Es wird somit in beiden Gedichten ein Gegensatz aufgebaut ( siehe Punkt 1.2 und 2.2), der nicht gelöst wird, sondern bestehen bleibt. Dies sind die Gemeinsamkeiten die am auffälligsten waren und auch von Wichtigkeit sind. Nach der Betrachtung der Gemeinsamkeiten ist es jetzt erforderlich auf die Unterschiede einzugehen. Beide Dichter behandeln zwar dasselbe Motiv, aber gehen in der Gestaltung und Interpretation unterschiedlich vor. Loerke versucht in seinem Gedicht einen Vergleich zwischen Stadt und Natur (Wasserlandschaft) aufzubauen. Dies soll dem Leser bei seinen Vorstellungen unterstützen. Mit Hilfe dieses Vergleiches gelingt es Loerke der Stadt auch positive Seiten abzugewinnen. Er ist insgesamt nicht so negativ der Stadt gegenüber eingestellt. Dies kommt bei Engelke ganz anders herüber. Er baut in seinem Gedicht den Gegensatz zwischen Mensch und Industrialisierung auf. Ihm ist die Stadt viel zu schnell, zu dreckig, zu hektisch. Einfach gesagt, er empfindet das Stadtleben nicht als schön und möchte einfach nicht da sein. Zwar war es Loerke auch zu schnell, aber er empfand dies nicht als so sonderlich störend wie Engelke. Des Weiteren sind Unterschiede in der Wortwahl erkennbar. Loerke gestaltet sein Gedicht „Blauer Abend in Berlin“ einfach bildhafter. Man hat die Möglichkeit seiner Phantasie freien Lauf zu lassen. Dies unterstützt der Vergleich der Stadt mit der Wasserlandschaft natürlich ungemein. Bei Engelke dagegen wirkt alles irgendwie schon vorgefertigt, wie halt Produkte aus einer Fabrik sind. Man bekommt ein Bild vorgesetzt, was man nicht ein wenig verschieben kann. Dies könnte durch die häufige Verwendung von Substantiven der Fall sein. Denn damit hat man schon eine konkrete Vorstellung im Kopf, die sich nicht mehr drehen und wenden lässt. Einer der wichtigsten Punkte bei der Betrachtung der Unterschiede ist, wie die Dichter es versuchen, Auswege aus der Stadt zu zeigen. Engelke sieht im Tod den einzigen Ausweg aus der Stadt. Man ist so in diesem Kreislauf des Stadtlebens gefangen, dass er nur noch im Tod einen Ausweg sieht. Eine andere Möglichkeit zeigt er nicht auf. Den Ausweg mit dem Tod spricht er aber nur indirekt an. Loerke hingegen geht nicht so weit. Er gibt den Menschen eine gewisse Hoffnung, aus der Stadt zu entfliehen. Dies zeigt die Verwendung des Symbols des Himmels. Denn seine Stadtmenschen „beginnen sacht vom Himmel zu erzählen“ (Zeile acht). Der Himmel ist ein Symbol unendlicher Freiheit und wenn sie davon erzählen, haben sie dies ja noch nicht aufgegeben. Also besteht für sie noch eine winzige Chance, der Stadt zu entkommen. Man kommt zu dem Schluss, dass beide Gedichte, so unterschiedlich sie auch sein mögen, mindestens einen Hauptpunkt gemeinsam haben und das ist das Stadtmotiv. Dieses verbindet die beiden Gedichte. Es wird auffällig, dass die Expressionisten ein schlechtes Bild von der Stadt haben. Die Stadt wird als Qual und als Bedrohung für den Menschen dargestellt. So leidet der Mensch in der Großstadt und kommt nicht zur Ruhe. Der Mensch befindet sich immer in der Opferrolle. Man kann jetzt nur mutmaßen, warum dies so ist. Vielleicht liegt es daran, dass ihnen der Trubel und die Hektik zu fremd waren. Loerke und Engelke schaffen es in ihren Gedichten, ein genaues Bild der Stadt zu zeichnen und geben ihre Empfindungen wieder. Dies ist gut so, denn so schafften sie es, ihre Eindrücke und Gefühle zu verarbeiten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textvergleichs?
Der Textvergleich behandelt das Thema der Stadt, insbesondere in den Gedichten "Blauer Abend in Berlin" von Oskar Loerke und "Stadt" von Gerrit Engelke.
Wie wird das Gedicht "Blauer Abend in Berlin" analysiert?
Das Gedicht wird in Bezug auf Inhalt, Form, lyrische Stimmung, Aufbau, Struktur, Aussagen zum lyrischen Subjekt, Klangmittel und inhaltliche Positionen in Verbindung mit der Bildhaftigkeit analysiert.
Wie wird das Gedicht "Stadt" analysiert?
Ähnlich wie "Blauer Abend in Berlin" wird auch dieses Gedicht in Bezug auf Inhalt, Form, lyrische Stimmung, Aufbau, Struktur, Aussagen zum lyrischen Subjekt, Klangmittel und inhaltliche Positionen in Verbindung mit der Bildhaftigkeit analysiert.
Welche Gemeinsamkeiten werden zwischen den beiden Gedichten festgestellt?
Beide Gedichte behandeln das Stadtmotiv, zeigen, dass das Individuum in der Stadt nicht zählt, entstanden zur Zeit des Expressionismus und verfügen über Metrik und eine antithetische Bauform.
Welche Unterschiede werden zwischen den beiden Gedichten festgestellt?
Loerke vergleicht Stadt und Natur und findet positive Aspekte der Stadt, während Engelke den Gegensatz zwischen Mensch und Industrialisierung aufbaut und die Stadt negativ darstellt. Außerdem ist Loerkes Sprache bildhafter, während Engelkes Sprache konkreter wirkt. Loerke sieht eine Hoffnung auf Entkommen aus der Stadt, während Engelke den Tod als einzigen Ausweg darstellt.
Was wird über Oskar Loerke gesagt?
Loerke gilt als Wegbereiter der modernen Lyrik und sein Gedicht "Blauer Abend in Berlin" entstand im Jahre 1911.
Was wird über Gerrit Engelke gesagt?
Engelke war ein frühvollendeter Expressionist und brachte sein Gedicht "Stadt" im Jahre 1912 hervor.
Was ist die antithetische Bauform in den Gedichten?
Es wird ein Gegensatz aufgebaut, der nicht aufgelöst wird, sondern bestehen bleibt. In "Blauer Abend in Berlin" ist es der Gegensatz zwischen Mensch und Natur, und in "Stadt" der Gegensatz zwischen Mensch und Industrialisierung.
Welche Rolle spielt das lyrische Subjekt in den Gedichten?
In beiden Gedichten ist kein lyrisches Ich vorhanden, sondern ein lyrisches Subjekt, das die Ereignisse aus einer Beobachterposition schildert.
Welche Klangmittel werden in den Gedichten untersucht?
Es werden Kadenzen, Jambus, Reimarten und Rhythmus untersucht, um die Wirkung der Gedichte zu analysieren.
Welche sprachkünstlerischen Mittel werden in den Gedichten analysiert?
Es werden Periphrasen, Wortwiederholungen, Alliterationen, Metaphern, Personifikationen und Synästhesien untersucht, um den Inhalt und die Bedeutung der Gedichte zu erläutern.
Was ist die Schlussfolgerung des Textvergleichs?
Die Gedichte zeigen ein schlechtes Bild der Stadt als Qual und Bedrohung für den Menschen. Der Mensch leidet in der Großstadt und kommt nicht zur Ruhe. Die Stadt wird als zu schnelllebig und hektisch empfunden.
Was ist die persönliche Meinung des Autors am Ende des Textes?
Die Meinung des Autors, obwohl er ein Kleinstadtjunge ist, ist, dass eine Großstadt, obwohl hektisch, trotzdem interessant ist, weil immer etwas los ist und bietet viele Freizeitmöglichkeiten und viele nette und interessante Leute kennenzulernen.
- Quote paper
- Martin Holzendorf (Author), 2001, Loerke, Oskar - Blauer Abend in Berlin - Analyse lyrischer Texte / Gedichtvergleich mit Engelke, Gerrit - Stadt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103158