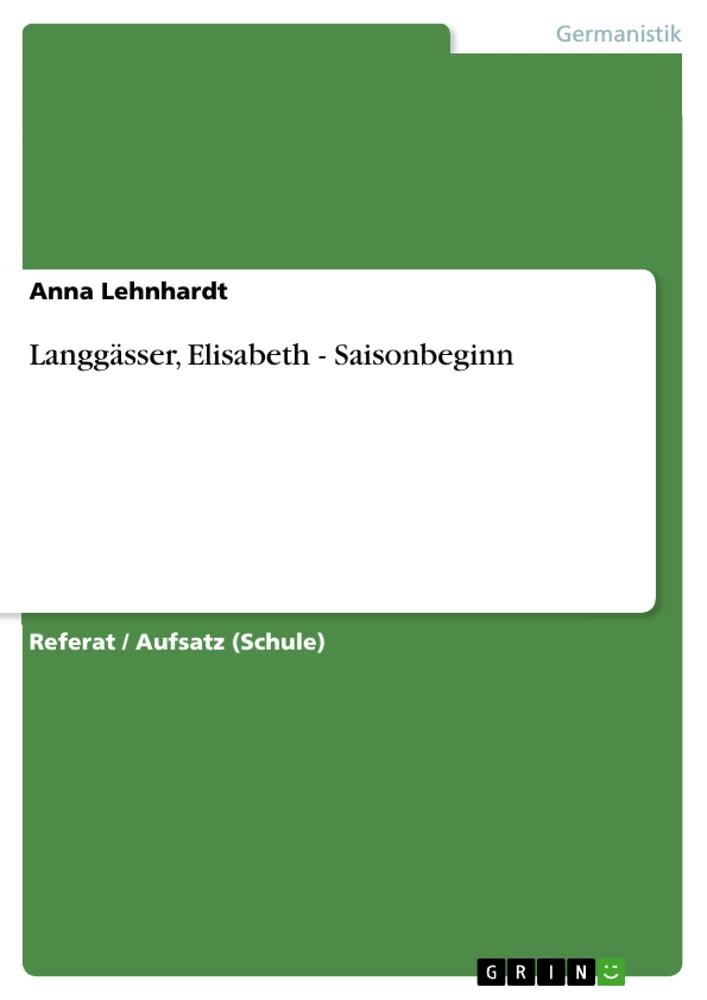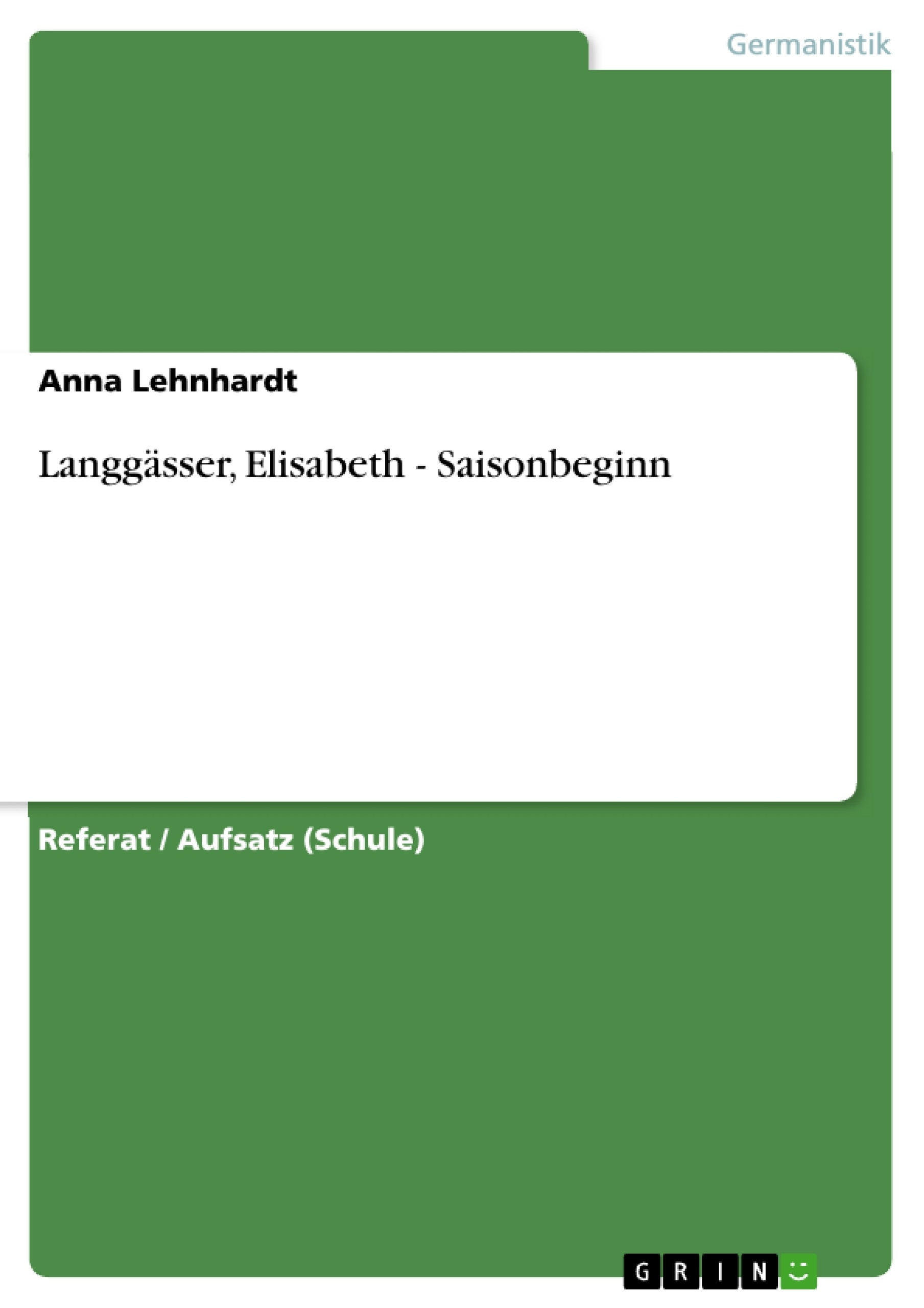Eine trügerische Idylle verbirgt erschreckende Abgründe: In Elisabeth Langgässers meisterhafter Kurzgeschichte "Saisonbeginn" wird der Leser in ein beschauliches Feriendorf entführt, das sich inmitten der Wirren der Kriegszeit auf den bevorstehenden Sommer vorbereitet. Doch hinter der Fassade malerischer Natur und emsiger Betriebsamkeit lauert eine beunruhigende Spannung. Arbeiter sind damit beschäftigt, ein Schild aufzustellen, dessen Bedeutung erst am Ende enthüllt wird. Langgässer verwebt auf subtile Weise die äußere Friedfertigkeit der Landschaft mit den brodelnden Vorurteilen und der latenten Feindseligkeit, die unter der Oberfläche schwelen. Die Reaktionen der Dorfbewohner sind vielschichtig: Neugier, Ablehnung, Gleichgültigkeit – ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Zerrissenheit jener Zeit. Die Geschichte entfaltet eine beklemmende Atmosphäre, indem sie die Diskrepanz zwischen dem scheinbar unberührten Urlaubsort und der unheilvollen Ideologie, die sich immer weiter ausbreitet, thematisiert. Die präzise Sprache und die eindringlichen Naturbeschreibungen verstärken die bedrohliche Grundstimmung und lassen den Leser bis zum Schluss im Ungewissen. "Saisonbeginn" ist nicht nur ein literarisches Werk von hoher Qualität, sondern auch eine Mahnung, die uns dazu auffordert, die Anfänge von Ausgrenzung und Hass nicht zu übersehen und ihnen entschieden entgegenzutreten. Ein wichtiges Werk über Verblendung, Verantwortung und die Gefahren des Wegschauens, das gerade in unserer heutigen Zeit von erschreckender Aktualität ist. Die Kurzgeschichte regt dazu an, über die Mechanismen von Diskriminierung und die Rolle des Einzelnen in einer Gesellschaft, die von Vorurteilen geprägt ist, nachzudenken. Langgässer gelingt es auf beeindruckende Weise, die komplexe Gemengelage aus Tradition, Ideologie und persönlicher Verantwortung in einer kleinen, scheinbar unbedeutenden Begebenheit zu verdichten. Ein Muss für jeden, der sich mit den dunklen Kapiteln der deutschen Geschichte auseinandersetzen und die Anfänge des Bösen verstehen will.
Elisabeth Langgässer: Saisonbeginn
Die Kurzgeschichte „Saisonbeginn“ von Elisabeth Langgässer beschreibt einen Ferienort in der Kriegszeit in der Vorbereitungsphase für die Sommersaison. Es wird die Arbeit einiger Arbeiter beschrieben, die einen geeigneten Ort suchen, um ein Schild auszustellen.
Der Text ist in vier Abschnitte geteilt, von denen der erste eine Art Einleitung in das Geschehen darstellt und eine genaue Beschreibung des Ortes und der Umgebung beinhaltet.
Der darauf folgende zweite Abschnitt beschreibt die Vorgehensweise und das Verhalten der Arbeiter, die das Schild an einem möglichst guten Ort aufstellen wollen. Es wird ebenso eine kurze Wertung der Meinung bezüglich Jesus wiedergegeben, die die Arbeiter haben (vgl. Z.24)
Im nächsten Absatz werden die Reaktionen von Passanten geschildert, die dem Tun der Arbeiter zusehen oder es im Vorbeigehen bemerken. Diese Reaktionen sind zum Teil positiv („Schulkinder machten sich gegenseitig die Ehre streitig, dabei zu helfen“, Z.64), aber auch teilweise eher kritisch („einige lachten, andere schüttelten nur den Kopf“, Z.73). Das Verhalten der Arbeiter wird durch die Reaktionen zwar nicht beeinflusst, er zeigt sich jedoch, daß das Aufstellen des Schildes nicht allen recht ist. Es wagt nur niemand, in das Geschehen einzugreifen oder seine Meinung zu äußern („die Mehrzahl war gleichgültig“, Z.75). Der letzte Absatz beschreibt das Verlassen der Arbeiter des Aufstellungsortes, wobei diese noch einmal „befriedigt zu dem Schild (aufblickten)“ (Z.90) und erklärt die Verunsicherung einiger Passanten, da erst hier und im letzten Satz die Aufschrift des Schildes erwähnt wird.
Die Spannungskurve der Geschichte zieht sich also über den gesamten Text hin und wird erst im letzten Satz durch die Nennung der Aufschrift des Schildes gelöst.
Die Autorin steigt mit einer sehr genauen Beschreibung der Natur, die den Handlungsort umgibt, in die Geschichte ein. Dem Leser wird eine friedliche und sehr idyllische Gegend irgendwo in den Bergen geschildert. Diese wird auch als „glücklich“ beschrieben („Trollblumen [...] platzten vor Glück“, Z.9). Auch die Ortschaft an sich wird als „wie neu“ bezeichnet. Jeder hat sich darauf vorbereitet, daß bald die Saison beginnen wird („ein Atemzug noch“, Z.13). Der Ort hat sich sozusagen für diejenigen Touristen herausgeputzt, die sich einen Urlaub leisten können. Die Besonderheit, sich zu dieser Zeit einen Urlaub leisten zu können, ergibt sich aus den politischen Umständen in der Handlungszeit. Da die Geschichte wohl zu Zeiten des zweiten Weltkrieges spielt, worauf auch die Wirkungszeit und die Lebensumstände der Autorin hinweisen, ist es etwas besonders, in so einen friedlichen Ort gehen und dort Urlaub machen zu können. Da es sich bei den Touristen daher wahrscheinlich um finanziell gut situierte Personen handelt, bemühen sich die Menschen in dem Ort, sich von ihrer besten Seite zu zeigen.
Auch die Abneigung gegenüber Juden weist auf die Handlungszeit während oder vor dem zweiten Weltkrieg hin.
Eine Diskrepanz ergibt sich in der Geschichte durch das Aufstellen des Schildes mit der judenfeindlichen Aufschrift in direkter Nähe einer Jesusstatue. Während die Statue daraus hinweist, daß es sich bei der Gemeinde wohl um einen christlichen Ort handelt. Im Widerspruch dazu steht das Schild, das zentraler Gegenstand der Geschichte ist. Zwar wird am Anfang des Textes die Auffassung der Arbeiter in Bezug auf Jesus geschildert (vgl. Z.24), jedoch gibt dies wohl nicht die Ansichten des gesamten Ortes wieder. Darauf weisen z.B. die Nonnen hin, „welche die Blumenvase zu Füßen des Kreuzes aufs Neue füllten“ (Z.69). Diese hätten einer Aufstellung des Schildes wohl nie zugestimmt. In direktem Gegensatz zur Schildaufschrift steht auch die Inschrift der Jesusstatue, die darauf hinweist, daß Jesus Jude war („J.N.R.J.“, Z.23). So ergibt sich für den Leser die Frage, wer nun eigentlich der Auftraggeber für die Aufstellung dieses Schildes war, das den ganzen Ort repräsentiert. Aus den Reaktionen der Passanten ergibt sich keine klare Meinung über die Aufstellung, da sie „gleichgültig reagieren“.
Die Überschrift des Textes, „Saisonbeginn“, steht in Bezug zur Handlung. Die Handlung beruht sogar sozusagen auf der Aussage der Überschrift, denn auf Grund des Saisonbeginns versucht der Ferienort, sich auf den Ansturm der Besucher vorzubereiten. Die Häuser werden neu gestrichen (vgl. Z.11ff) und auch sonst wurde alles für die Touristen hergerichtet, die sich zu Kriegszeiten einen Urlaub leisten konnten und diesen fernab der vom Krieg gezeichneten Gegenden in Frieden verbringen wollten.
Aus diesen Umständen ergibt sich auch die Motivation der Arbeiter, etwas für die Verschönerung ihres Heimatortes beizutragen und einen besonders guten Ort für das Schild zu finden. Sie wollen, daß das Schild schon vor dem eigentlichen Eintreffen im Ort etwas signalisiert, was auf die Einstellung in diesem Ort hinweisen soll. Die Aufgabe, einen guten Ort zu finden, gelöst zu haben und so etwas für das Image ihres Ortes getan zu haben, was auch ihrer eigenen Gesinnung entspricht, befriedigt die Arbeiter (vgl. Z.91).
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Elisabeth Langgässers Kurzgeschichte „Saisonbeginn“?
Die Kurzgeschichte beschreibt einen Ferienort in der Kriegszeit, der sich auf die Sommersaison vorbereitet. Der Fokus liegt auf einigen Arbeitern, die einen geeigneten Platz für ein Schild suchen.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text ist in vier Abschnitte unterteilt: eine Einleitung mit Ortsbeschreibung, die Vorgehensweise der Arbeiter, die Reaktionen von Passanten und das Verlassen des Ortes durch die Arbeiter.
Was wird über die Arbeiter und ihre Meinung gesagt?
Der Text beschreibt die Bemühungen der Arbeiter, das Schild an einem guten Ort aufzustellen und gibt eine kurze Wertung ihrer Meinung bezüglich Jesus wieder.
Wie reagieren die Passanten auf das Aufstellen des Schildes?
Die Reaktionen sind gemischt. Einige sind positiv, andere kritisch oder gleichgültig. Niemand greift jedoch ein oder äußert offen seine Meinung.
Wann wird die Aufschrift des Schildes erwähnt?
Die Aufschrift wird erst am Ende des Textes genannt, was bei einigen Passanten Verunsicherung auslöst.
Welche Bedeutung hat die Naturbeschreibung am Anfang der Geschichte?
Die Naturbeschreibung vermittelt ein friedliches und idyllisches Bild, das im Kontrast zu den politischen Umständen der Zeit steht.
Welche Hinweise gibt es auf die Handlungszeit während des Zweiten Weltkriegs?
Die Abneigung gegenüber Juden und die Tatsache, dass sich nur wenige einen Urlaub leisten können, deuten auf die Zeit des Zweiten Weltkriegs hin.
Welche Diskrepanz ergibt sich im Text?
Eine Diskrepanz ergibt sich durch das Aufstellen des judenfeindlichen Schildes in der Nähe einer Jesusstatue, was Fragen nach dem Auftraggeber und der Meinung der Gemeinde aufwirft.
Welche Bedeutung hat der Titel „Saisonbeginn“ für die Handlung?
Der Titel steht in direktem Bezug zur Handlung, da sich der Ferienort aufgrund des bevorstehenden Saisonbeginns vorbereitet und verschönert.
Was ist die Motivation der Arbeiter?
Die Arbeiter wollen zur Verschönerung ihres Heimatortes beitragen und einen guten Ort für das Schild finden, um eine bestimmte Einstellung zu signalisieren, was ihnen Befriedigung verschafft.
Wie ist die Situation im Hinblick auf die Gegenwart zu bewerten?
Eine solche Situation wäre heute für die meisten undenkbar, da viel Wert auf Akzeptanz gelegt wird. Dennoch ist es wichtig, wachsam zu sein und Diskriminierung entgegenzutreten.
- Quote paper
- Anna Lehnhardt (Author), 2001, Langgässer, Elisabeth - Saisonbeginn, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103156