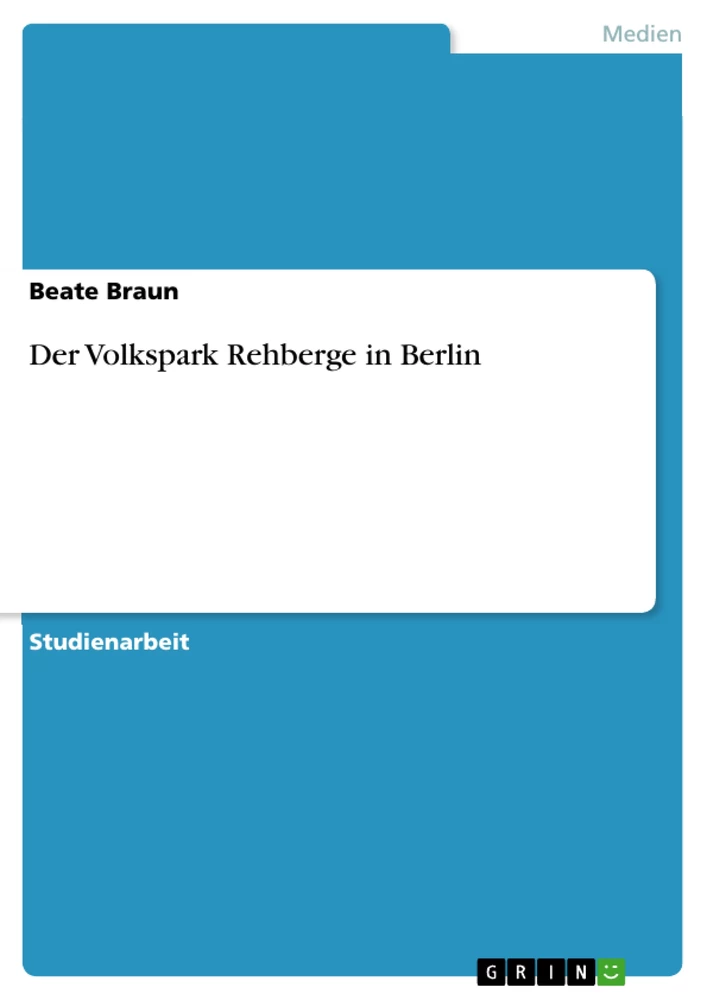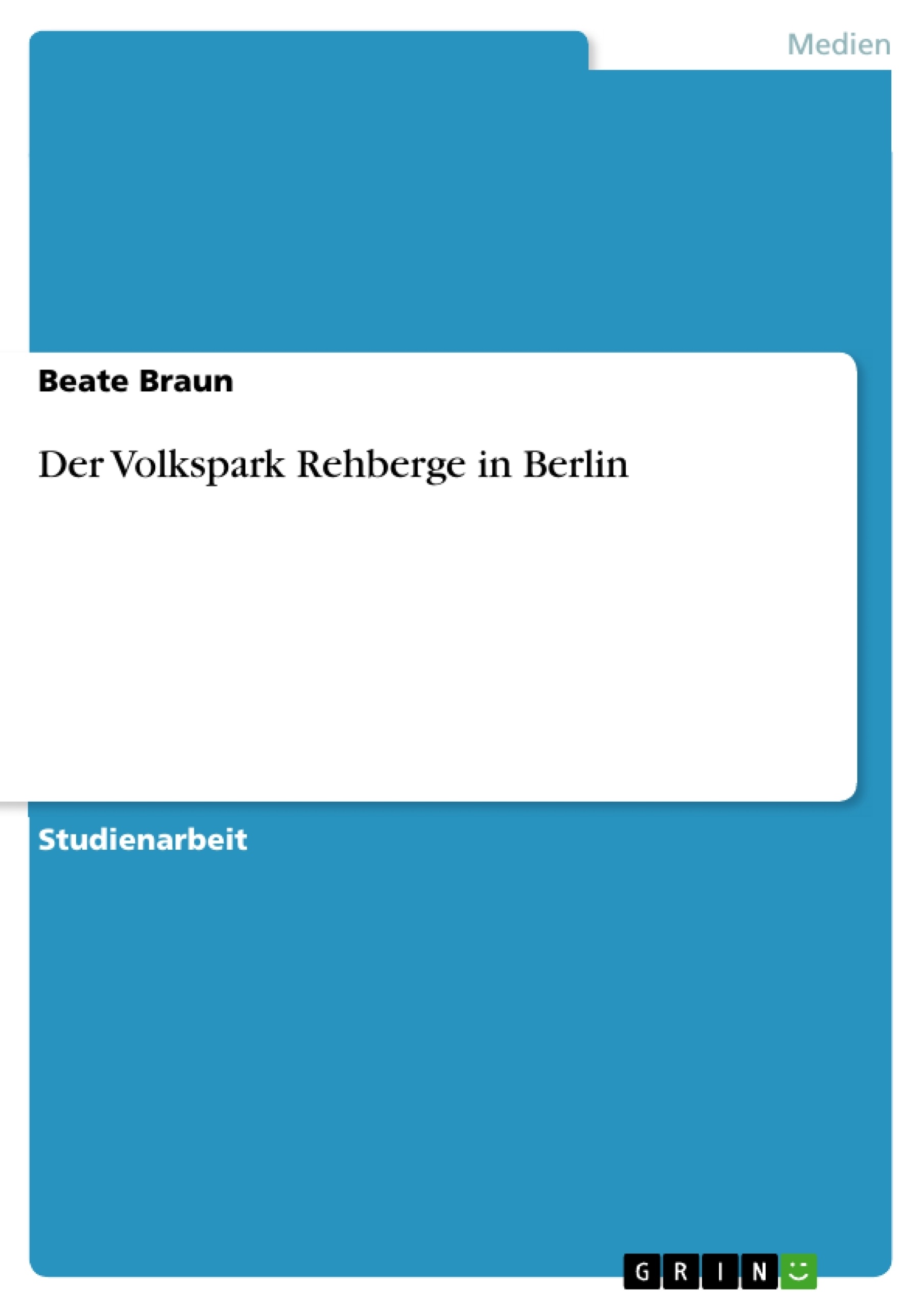1.0 Der Volkspark Rehberge in Berlin (1926 - 29)
1.1 naturräumliche Gegebenheiten
Auf dem Gelände des heutigen Volksparks Rehberge erstreckten sich
ursprünglich ausgedehnte Forstgebiete. Sie bestanden zum überwiegenden Teil aus Traubeneichen- und märkischen Kieferwaldungen.
Der vorhandene Plötzensee wurde bereits im Mittelalter vom Nonnenkloster zu Spandau zur Fischerei genutzt. 1817 wurde der See von der Stadt Berlin erworben und in den folgenden Jahren verpachtet. Der Boden der Rehberge bestand zum größten Teil aus Flugsanden. Bis 1918 wurden einige Bereiche militärisch genutzt, es bestanden dort mehrere Schießstände und am Plötzensee ein Militärbad. Um den Möwensee gab es eine kleingärtnerisch genutzte Sumpflandschaft und während der Kriegs- und Nachkriegsjahre dienten die Kleingartenlauben teilweise auch als Wohnstätten.
Im Notwinter 1918/19 wurde von der Bevölkerung fast das gesamte Areal
abgeholzt, um die Wohnungen heizen zu können. So entstand ein
riesiges Dünen- und Wüstengebiet. Der durch den Wind transportierte
Sand wurde für die Bevölkerung der angrenzenden Siedlungen zu einer
gesundheitsgefährdenden Plage. Deshalb und auch aufgrund des hohen
Freiflächendefizits plante das Bezirksamt Wedding 1922 anstelle der
Wüstenlandschaft ein großes Erholungsgebiet.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Der Volkspark Rehberge in Berlin (1926 - 29)
- 1.1 naturräumliche Gegebenheiten
- 1.2 Planungen
- 1.3 Ausführung und Ablauf der Arbeiten
- 1.4 Parkelemente und Parkkonzeption
- 1.5 Analyse
- 1.5.1 Topographie
- 1.5.2 Wege, Erschließung
- 1.5.3 Wiesenflächen
- 1.6 Veränderungen des Parks seit der Eröffnung bis heute
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung des Volksparks Rehberge in Berlin. Er beleuchtet die naturräumlichen Gegebenheiten des Geländes, die Planungen und die Ausführung der Arbeiten, die Parkkonzeption und die wichtigsten Parkelemente sowie die Veränderungen des Parks seit seiner Eröffnung bis heute.
- Die naturräumlichen Gegebenheiten des Geländes, auf dem der Volkspark Rehberge entstand
- Die Planungen und die Ausführung der Arbeiten am Volkspark Rehberge
- Die wichtigsten Parkelemente und die Parkkonzeption
- Die Analyse des Parks, insbesondere seiner Topographie, Wege und Wiesenflächen
- Die Veränderungen des Parks seit der Eröffnung bis heute
Zusammenfassung der Kapitel
1.0 Der Volkspark Rehberge in Berlin (1926 - 29)
Dieses Kapitel beschreibt die naturräumlichen Gegebenheiten des Geländes, auf dem der Volkspark Rehberge entstand. Es geht auf die ursprünglichen Forstgebiete, den Plötzensee und die militärische Nutzung des Geländes ein. Außerdem wird die Abholzung des Areals im Notwinter 1918/19 und die daraus resultierende Sandplage beschrieben.
1.1 naturräumliche Gegebenheiten
Dieses Kapitel beschreibt die ursprünglichen Forstgebiete, den Plötzensee und die militärische Nutzung des Geländes. Außerdem wird die Abholzung des Areals im Notwinter 1918/19 und die daraus resultierende Sandplage beschrieben.
1.2 Planungen
Dieses Kapitel beschreibt die ersten Planentwürfe von Gartendirektor Albert Brodersen aus dem Jahr 1922 und die Entstehung des „Goetheparks". Es geht auf den behelfsmäßigen Ausbau des Wassersportplatzes Plötzensee und den Beginn der Anlage eines Uferweges um den See im Herbst 1925 ein.
1.3 Ausführung und Ablauf der Arbeiten
Dieses Kapitel beschreibt die eigentlichen Erdarbeiten für den Volkspark Rehberge, die im Februar 1926 begannen. Es geht auf die Einweihung des Parks im Juni 1929 und die weiteren Arbeiten, die mit Hilfe von Wohlfahrtserwerbslosen durchgeführt wurden, ein. Außerdem werden die Schwierigkeiten bei der Urbarmachung und Befestigung der Sanddünen beschrieben.
1.4 Parkelemente und Parkkonzeption
Dieses Kapitel beschreibt den zentralen Bereich der Parkanlage mit der Übungswiese, den Tennisplätzen, der Kampfbahn und dem Tanzring. Es geht auf das Planschbecken, die Rodelbahnen und die Liegewiesen ein. Außerdem werden die verschiedenen Nutzungs-möglichkeiten des Parks und die Gestaltungselemente beschrieben.
1.5 Analyse
1.5.1 Topographie
Dieses Kapitel beschreibt das natürliche Relief des Parks durch die ehemaligen Sanddünen. Es geht auf die höchste Erhebung des Parks, den Leutnantsberg, und den Rodelberg ein.
1.5.2 Wege, Erschließung
Dieses Kapitel beschreibt die Erschließung des Parks durch die umliegenden Straßen und die Wege innerhalb des Parks. Es geht auf das „natürliche Wegenetz" ein, das sich an die Geländemodulation und die Sport- und Spielplätze anpasst.
1.5.3 Wiesenflächen
Dieses Kapitel beschreibt die Übungswiese als zentralen Bereich der Parkanlage und die daran angelagerten Sporteinrichtungen. Es geht auf die weiteren Rasenflächen, wie die Schulspielplätze, die Rodelbahnen und die Bürgerwiese, ein.
Schlüsselwörter
Volkspark Rehberge, Berlin, naturräumliche Gegebenheiten, Planungen, Ausführung, Parkkonzeption, Parkelemente, Analyse, Topographie, Wege, Erschließung, Wiesenflächen, Veränderungen, Geschichte, Freiraumgestaltung.
- Quote paper
- Beate Braun (Author), 2001, Der Volkspark Rehberge in Berlin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1030