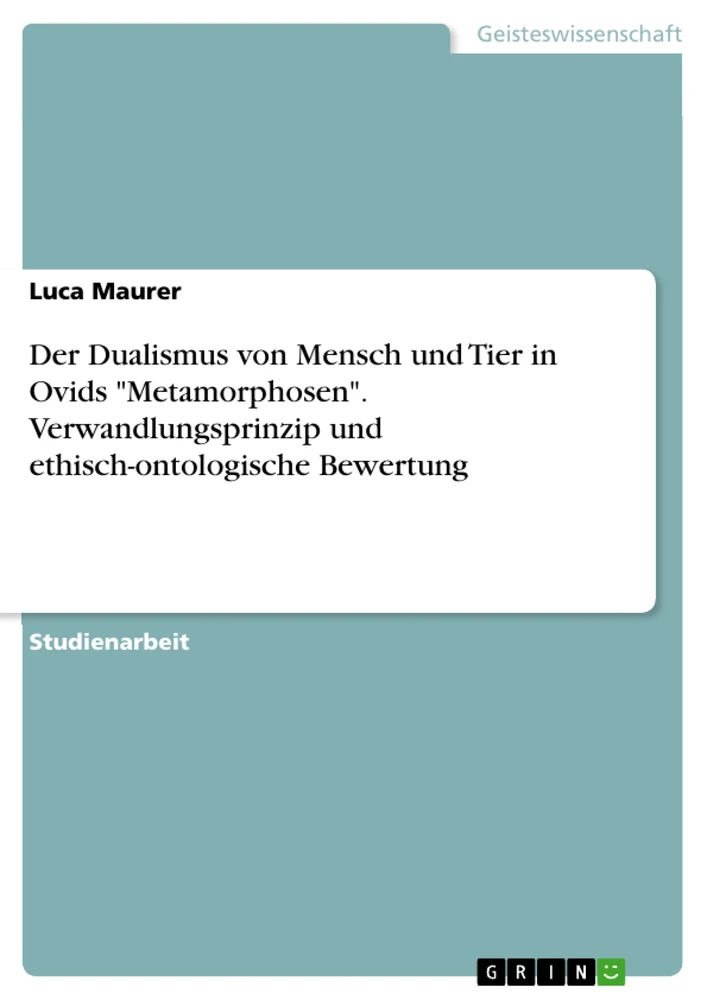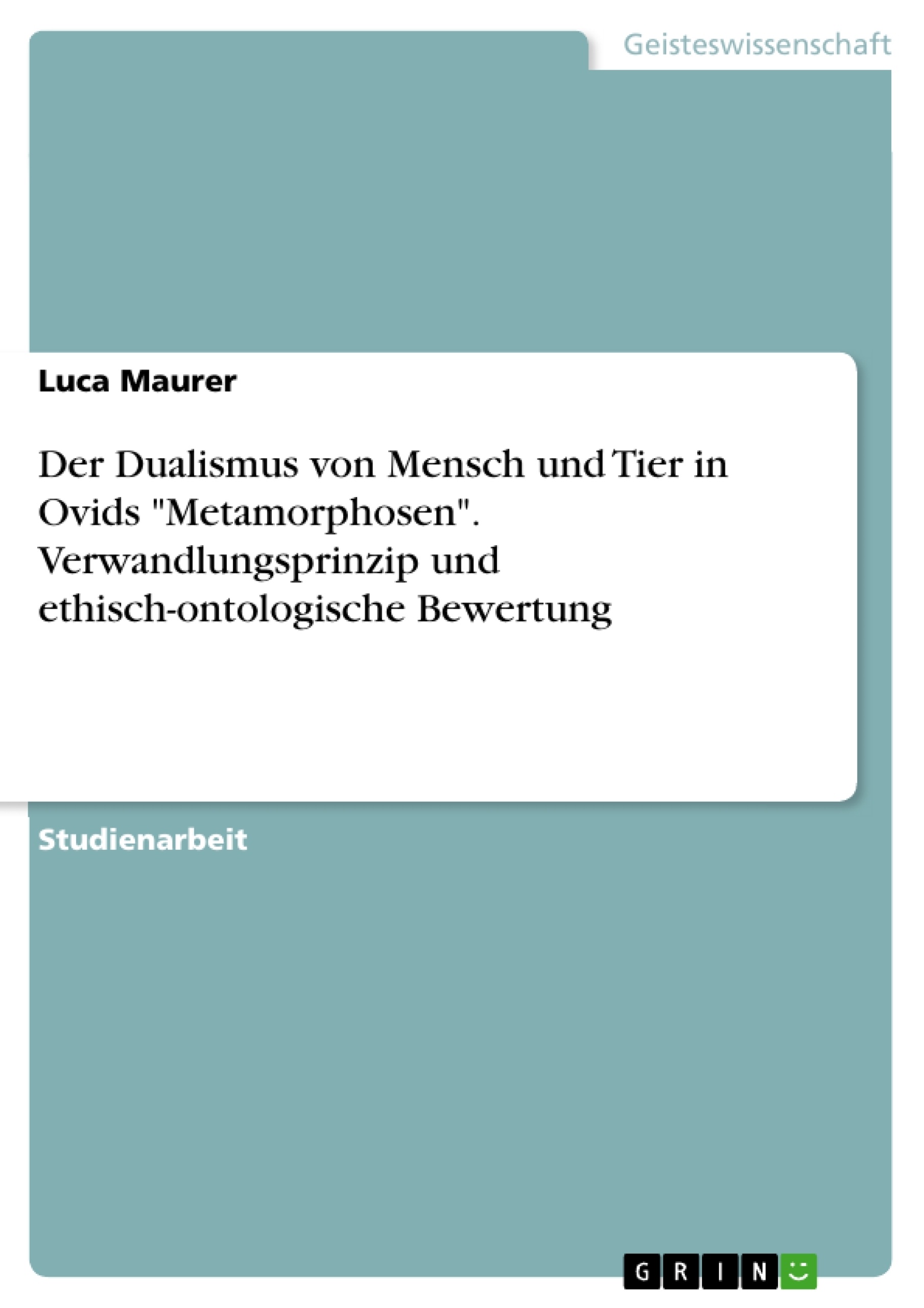Den Schwerpunkt der Ausarbeitung sollen ausgewählte Episoden aus den "Metamorphosen" des Ovid darstellen. Ziel dabei ist nicht nur die ethisch-ontologische Bewertung der einzelnen Tierdarstellungen in ihrem Gegensatz zur Konzeption des Menschen und des daraus erwachsenden Dualismus der beiden Existenzkreise, sondern auch die Erklärung des Verwandlungsprinzips selbst und wie es in seiner philosophischen und mythologischen Tradition bei Ovid Einzug erhält.
Grundlage der Betrachtungen bildet das kosmogonische Gerüst der Verwandlungsgeschichten, das vor allem vor dem Hintergrund des platonischen Timaios zu lesen ist. Das Konzept der Metamorphose steht dabei am Anfang der Argumentation und stößt im Zuge des Schöpfungsmythos erstmalig auf die ontologische Differenzierung von Mensch und Tier, indem der Mensch als prävalentes Schöpfungsideal und Geistwesen dem Bild des wilden Tieres als Triebwesen gegenübergestellt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ovids Metamorphosen – Kosmogonische Vorannahmen
- Verwandlung als Ursprungsprinzip des Kosmos
- Die Entstehung von Mensch und Tier
- Metamorphose der Schuld
- Die Verwandlung des Lycaon
- Die Verwandlung der lykischen Bauern
- Tierwerdung als ethische Degradation
- Abschließendes Urteil und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht ausgewählte Episoden aus Ovids Metamorphosen, um die ethisch-ontologische Bewertung der Tierdarstellungen im Gegensatz zur Konzeption des Menschen und den daraus resultierenden Dualismus zu analysieren. Ein weiterer Fokus liegt auf der Erklärung des Verwandlungsprinzips selbst und seiner philosophischen und mythologischen Tradition bei Ovid. Die Arbeit beleuchtet auch Ovids Bezug zur platonischen Kosmogonie und die Darstellung der Metamorphose als Ursprungsprinzip des Kosmos.
- Der Mensch-Tier-Dualismus in Ovids Metamorphosen
- Die Metamorphose als Ursprungsprinzip des Kosmos
- Ethische Aspekte der Tierwerdung als Strafe
- Ovids Rezeption von Platon und Hesiod
- Die Rolle der Verwandlungsmythen in der antiken Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert den historischen Wandel der Betrachtung von Tieren in der Philosophie, vom Objekt zum Subjekt. Sie hebt die Bedeutung des Motivs der Metamorphose und der Tierwerdung als Strafe hervor und positioniert Ovids Metamorphosen als zentralen Text für die Untersuchung des Mensch-Tier-Verhältnisses in der Antike. Die Arbeit fokussiert die ethisch-ontologische Bewertung der Tierdarstellungen und die Erklärung des Verwandlungsprinzips im Werk.
2. Ovids Metamorphosen – Kosmogonische Vorannahmen: Dieses Kapitel untersucht den kosmogonischen Rahmen der Metamorphosen. Es analysiert die Darstellung des Verwandlungsprinzips als Ursprung des Kosmos und zeigt, wie Ovid Platons und Hesiods Kosmogonien rezipiert und miteinander verbindet. Der Fokus liegt auf der Vorstellung des Chaos als Ausgangspunkt und seiner Transformation in einen geordneten Kosmos durch eine schöpferische Kraft. Die unterschiedlichen Ansätze von Platon und Hesiod bezüglich der Schöpfung werden verglichen und in Bezug zu Ovids Werk gesetzt.
3. Metamorphose der Schuld: Dieses Kapitel analysiert die Metamorphose als Strafe und untersucht verschiedene Beispiele aus Ovids Metamorphosen, wie die Verwandlung des Lycaon und der lykischen Bauern. Es untersucht die Tierwerdung als ethische Degradation und beleuchtet die moralischen Implikationen der Verwandlungen. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Schuld und ihrer Konsequenzen in Form von Verwandlungen in Tiere, und wie diese Verwandlungen die Beziehung zwischen Mensch und Tier widerspiegeln.
Schlüsselwörter
Ovid, Metamorphosen, Mensch-Tier-Verhältnis, Metamorphose, Tierwerdung, Kosmogonie, Platon, Hesiod, ethische Degradation, Dualismus, antike Mythologie, Schuld, Strafe.
Häufig gestellte Fragen zu: Ovids Metamorphosen - Eine Analyse der Mensch-Tier-Beziehung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert ausgewählte Episoden aus Ovids Metamorphosen. Im Mittelpunkt steht die Untersuchung der ethisch-ontologischen Bewertung von Tierdarstellungen im Vergleich zur Konzeption des Menschen und des daraus resultierenden Dualismus. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Verwandlungsprinzip selbst und seiner philosophischen und mythologischen Tradition bei Ovid, insbesondere im Hinblick auf den Bezug zu Platon und Hesiod.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Mensch-Tier-Dualismus in Ovids Metamorphosen, die Metamorphose als Ursprungsprinzip des Kosmos, ethische Aspekte der Tierwerdung als Strafe, Ovids Rezeption von Platon und Hesiod sowie die Rolle der Verwandlungsmythen in der antiken Kultur. Konkret werden die kosmogonischen Vorannahmen bei Ovid untersucht und die Metamorphose als Strafe anhand von Beispielen wie der Verwandlung des Lycaon und der lykischen Bauern analysiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die den historischen Wandel der Betrachtung von Tieren in der Philosophie skizziert und die Bedeutung des Motivs der Metamorphose und der Tierwerdung als Strafe hervorhebt. Es folgen Kapitel zu Ovids kosmogonischen Vorannahmen, in denen die Rezeption von Platon und Hesiod untersucht wird, und zur Metamorphose der Schuld, in der die Tierwerdung als ethische Degradation analysiert wird. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Ovid, Metamorphosen, Mensch-Tier-Verhältnis, Metamorphose, Tierwerdung, Kosmogonie, Platon, Hesiod, ethische Degradation, Dualismus, antike Mythologie, Schuld und Strafe.
Welche Quellen werden herangezogen?
Die Arbeit bezieht sich explizit auf die Werke Ovids (Metamorphosen), Platons und Hesiods. Die genaue Quellenangabe ist im Haupttext zu finden. Die Arbeit analysiert Ovids Rezeption der philosophischen und mythologischen Traditionen in Bezug auf die Kosmogonie und die Metamorphose.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine literaturwissenschaftliche Methode, die ausgewählte Episoden aus Ovids Metamorphosen analysiert und im Kontext der antiken Philosophie und Mythologie interpretiert. Es wird eine vergleichende Analyse von Ovids Werk mit den Ansätzen Platons und Hesiods durchgeführt.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich für die antike Literatur, Philosophie und Mythologie interessieren und sich mit der Frage des Mensch-Tier-Verhältnisses in der Antike auseinandersetzen möchten. Sie ist insbesondere für Studierende der klassischen Philologie und verwandter Fächer relevant.
Welches ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist im Volltext der Arbeit enthalten. Diese Zusammenfassung enthält nur einen Überblick.) Die Arbeit zieht Schlüsse aus der Analyse der ausgewählten Episoden aus Ovids Metamorphosen bezüglich der ethisch-ontologischen Bewertung von Tierdarstellungen und der Bedeutung des Verwandlungsprinzips.
- Quote paper
- Luca Maurer (Author), 2020, Der Dualismus von Mensch und Tier in Ovids "Metamorphosen". Verwandlungsprinzip und ethisch-ontologische Bewertung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1030359