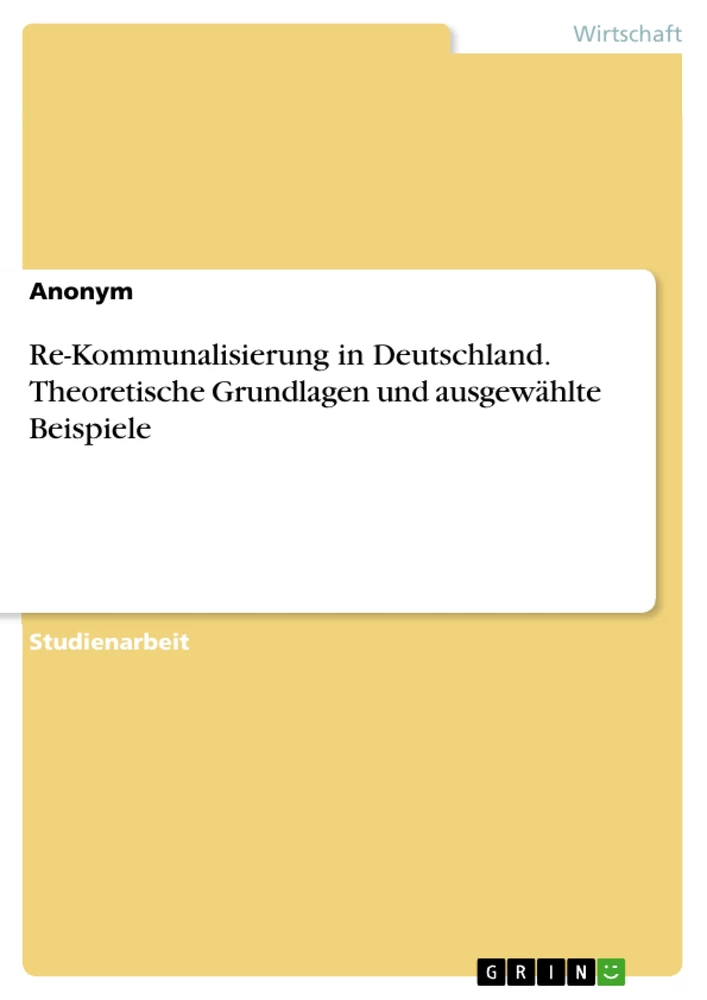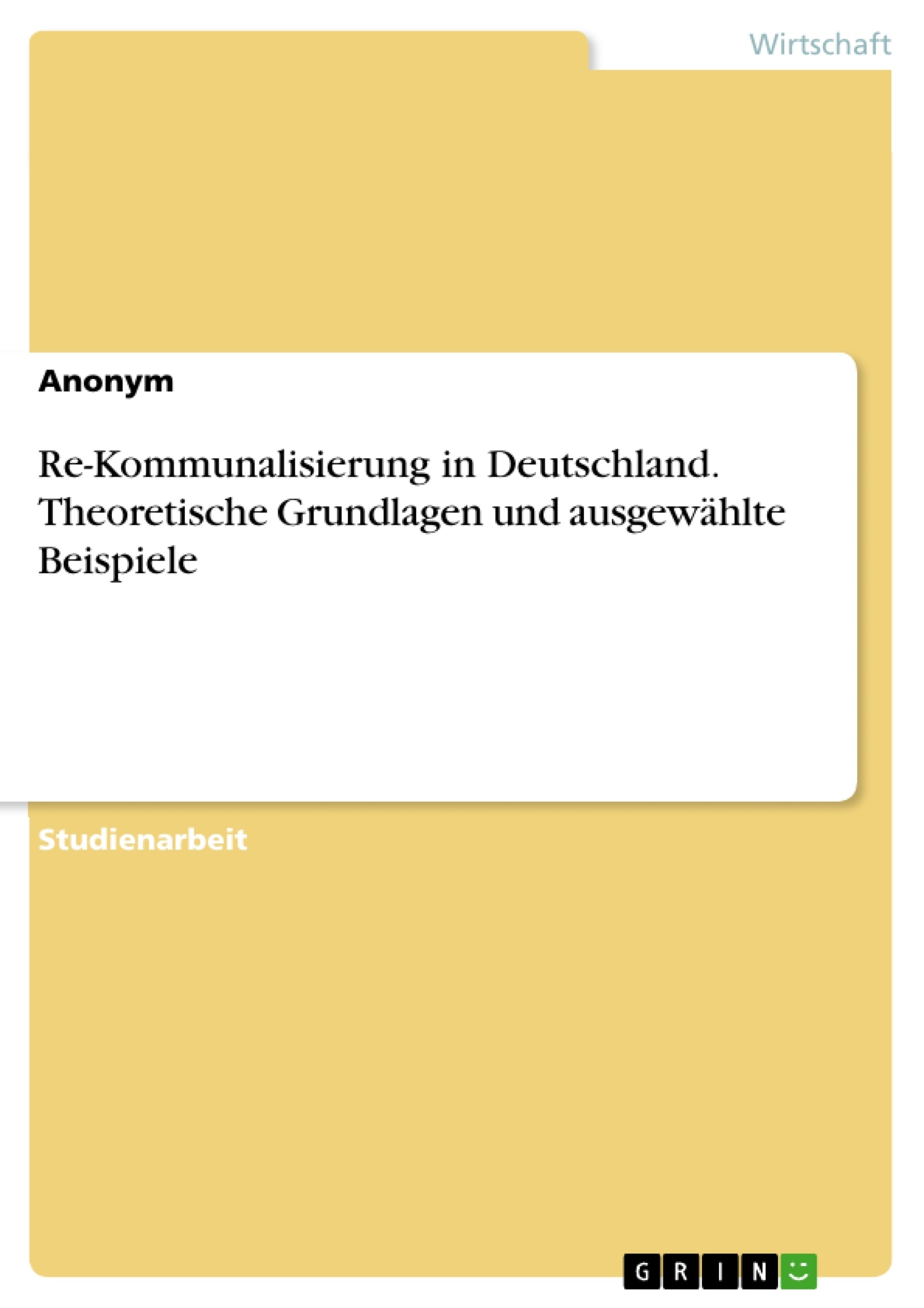Seit ungefähr einer Dekade ist verstärkt eine Rücknahme der öffentlichen Leistungen in den Aufgaben- und Verantwortungsbereich von Kommunen und Öffentlicher Hand zu beobachten. Inzwischen wird die Re-Kommunalisierung auch als Megatrend sowie als Gegenbewegung zur Privatisierungswelle bezeichnet.
Im Fokus dieser Arbeit steht daher die Frage nach den Ursachen der Re-Kommunalisierung und der aktuellen Bedeutung dieses Phänomens in Deutschland. Die Zielstellung liegt daher in der Untersuchung von Ursachen für die Re-Kommunalisierung und der Beantwortung der Frage nach der heutigen Rolle dieses Phänomens in Deutschland.
Um diese Zielstellung erreichen zu können, gliedert sich die Arbeit in vier Kapitel. Das erste Kapitel enthält die Problemstellung, Formulierung der Zielstellung und Beschreibung der Struktur der Arbeit in einem kurzen Abriss. Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen vorgestellt. Zunächst wird die Re-Kommunalisierung begrifflich hergeleitet und definiert. Anschließend folgen Ausführungen zum Status quo der Re-Kommunalisierung in Deutschland sowie zu Ursachen und Zielen der Re-Kommunalisierung. Im dritten Kapitel werden drei ausgewählte Beispiele vorgestellt, welche aufzeigen, wie Re-Kommunalisierung in der Praxis ablaufen kann. Diese Beispiele fließen außerdem in die anschließende Beurteilung der derzeitigen Gesamtbedeutung der Re-Kommunalisierung für Deutschland ein. Mit einem Fazit im vierten Kapitel endet diese Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen zur Re-Kommunalisierung
- Begriffliche Bestimmung der Re-Kommunalisierung
- Status quo der Re-Kommunalisierung in Deutschland
- Ursachen und Ziele der Re-Kommunalisierung
- Ausgewählte Beispiele der Re-Kommunalisierung
- Beispiel 1: Rekommunalisierung der Wasserversorgung in Potsdam 2000
- Beispiel 2: Bürgerentscheid zum Rückkauf des Stromnetzes in Hamburg 2013
- Beispiel 3: Rekommunalisierung der Energieversorgung in Dresden
- Gesamtbedeutung der Re-Kommunalisierung in Deutschland
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Re-Kommunalisierung in Deutschland. Sie untersucht die Ursachen dieses Trends und analysiert seine aktuelle Bedeutung für die Bundesrepublik. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, warum es zu einer Rücknahme von privatisierten Leistungen in den Aufgabenbereich von Kommunen und öffentlicher Hand kommt und welche Auswirkungen dies hat.
- Begriffliche Klärung und Definition des Begriffs Re-Kommunalisierung
- Analyse des Status quo der Re-Kommunalisierung in Deutschland
- Identifizierung der Ursachen und Ziele von Re-Kommunalisierungsprozessen
- Vorstellung von Beispielen für Re-Kommunalisierung in der Praxis
- Bewertung der Gesamtbedeutung der Re-Kommunalisierung für Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Re-Kommunalisierung vor und führt in die Problemstellung ein. Sie erläutert die Zielsetzung der Arbeit und beschreibt die Struktur der folgenden Kapitel. Kapitel zwei beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Re-Kommunalisierung. Es befasst sich mit der begrifflichen Bestimmung und erläutert die Entwicklung der Re-Kommunalisierung in Deutschland. Zudem werden die Ursachen und Ziele des Phänomens behandelt. In Kapitel drei werden drei ausgewählte Beispiele für Re-Kommunalisierungsprozesse vorgestellt, die den praktischen Ablauf der Re-Kommunalisierung verdeutlichen. Diese Beispiele dienen außerdem der Analyse der Bedeutung der Re-Kommunalisierung für Deutschland.
Schlüsselwörter
Re-Kommunalisierung, Daseinsvorsorge, Privatisierung, Public Private Partnership (PPP), kommunale Daseinsvorsorge, Rücknahme der Privatisierung, kommunale Selbstverwaltung, Bürgerbeteiligung, lokale Steuerung.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2020, Re-Kommunalisierung in Deutschland. Theoretische Grundlagen und ausgewählte Beispiele, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1030290