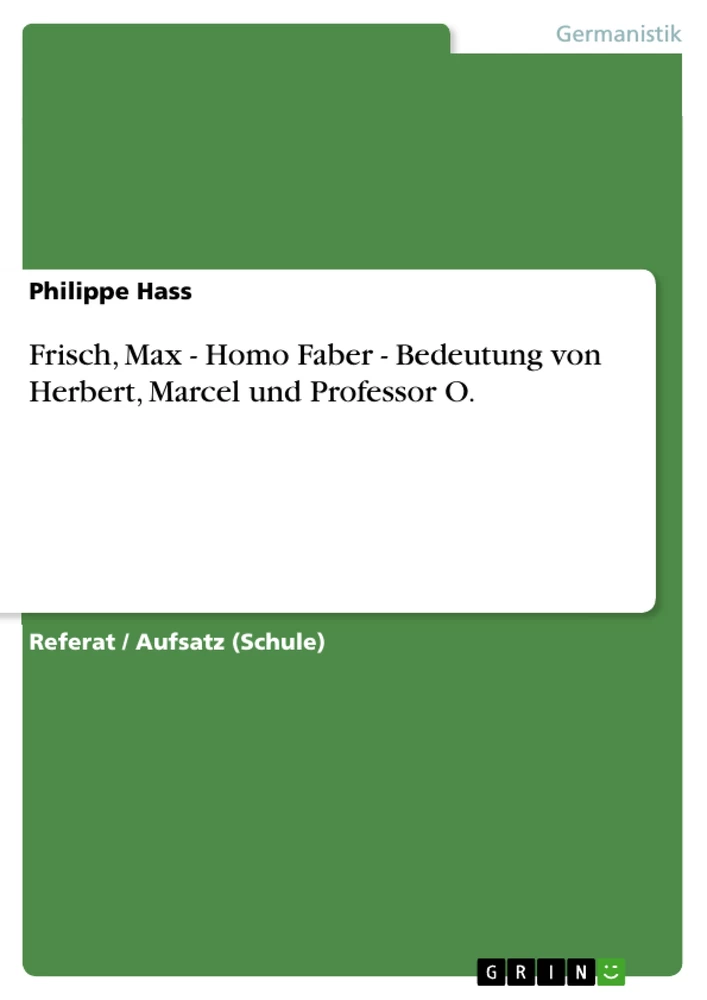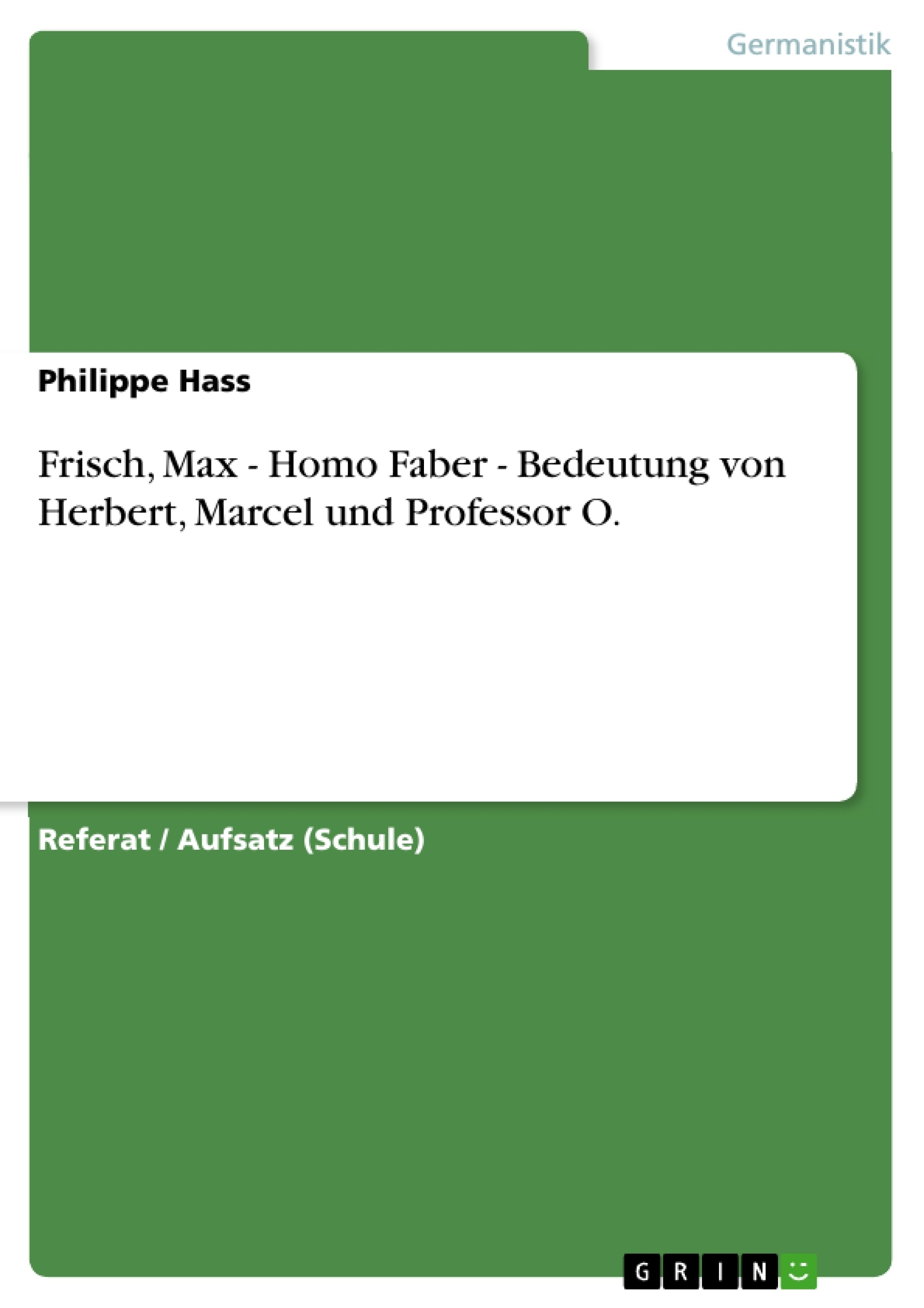Was, wenn das Schicksal in den unwahrscheinlichsten Begegnungen lauert? Max Frischs "Homo Faber" ist mehr als nur die Geschichte eines Ingenieurs; es ist eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit der Entfremdung des modernen Menschen von der Natur, von seinen Gefühlen und von sich selbst. Walter Faber, ein Mann der Zahlen und Fakten, dessen Leben von Technik und Effizienz bestimmt wird, sieht sich plötzlich mit einer Reihe von Ereignissen konfrontiert, die seine rationale Welt ins Wanken bringen. Eine unerwartete Notlandung in der guatemaltekischen Wüste führt ihn zu Herbert Hencke, einem Mann, der ihn auf eine schicksalhafte Reise zu seiner Vergangenheit und zu lange verdrängten Emotionen zwingt. Dort trifft er auf Marcel, einen unkonventionellen Künstler, der Fabers materialistische Weltanschauung in Frage stellt. Gleichzeitig konfrontiert ihn die Erinnerung an Professor O., sein einstiges Vorbild, mit der eigenen Sterblichkeit und der Sinnlosigkeit eines Lebens ohne Tiefe. Durch diese Begegnungen und die tragische Beziehung zu seiner Tochter Sabeth, die er unwissentlich eingeht, wird Faber gezwungen, seine starren Überzeugungen zu hinterfragen und sich der Komplexität des Lebens zu öffnen. Doch kann er die zerstörerischen Konsequenzen seiner Vergangenheit und die Tragödie seiner Gegenwart überwinden? "Homo Faber" ist ein Roman über Schuld, Sühne und die Suche nach Identität in einer zunehmend technisierten Welt. Eine Geschichte, die den Leser bis zur letzten Seite fesselt und zum Nachdenken über die essenziellen Fragen des menschlichen Daseins anregt. Die Themen umfassen Identitätskrise, die Entfremdung des modernen Menschen, die Konfrontation von Technik und Natur, Schuld und Verantwortung, sowie die Auseinandersetzung mit dem Tod. Frischs Werk ist ein Klassiker der Nachkriegsliteratur, der nichts von seiner Relevanz verloren hat und auch heute noch Leser weltweit in seinen Bann zieht. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Zufälle, tragischer Verstrickungen und der unaufhaltsamen Macht des Schicksals. Eine tiefgründige Erzählung über die menschliche Existenz und die Suche nach Sinn in einer von Technologie geprägten Gesellschaft. Lassen Sie sich von Frischs meisterhafter Sprache und der komplexen Charakterzeichnung Walter Fabers in eine Welt entführen, in der das Unerwartete zur bestimmenden Kraft wird. Erleben Sie eine Reise durch innere Konflikte, schicksalhafte Begegnungen und die Erkenntnis, dass das Leben mehr zu bieten hat als nur rationale Erklärungen. "Homo Faber" ist ein zeitloses Meisterwerk, das den Leser nachhaltig berührt und zum Nachdenken über die großen Fragen des Lebens anregt.
Thema :
In Max Frischs Roman „Homo faber“ treten neben den Hauptfigu- ren Walter Faber, Hanna und Sabeth auch einige Nebenfiguren auf. Setzen sie sich mit der Bedeutung von drei dieser Nebenfiguren für Thematik und gegebenenfalls den äußeren Handlungsausgang aus- einander.
Im Verlauf des Romans „Homo faber“ von Max Frisch haben einige Figuren und Ereignisse einen mehr oder weniger starken Einfluss auf Walter Fabers Denk- und Handlungsweise. Diese Einflüsse machen aus dem kühlen Ingenieur einen gefühlsbetonteren Menschen. In der folgenden Erörterung wird die Be- deutung der drei Nebenfiguren Herbert Hencke, Marcel und Professor O. für den Protagonisten Walter Faber untersucht. Um die Zusammenhänge klarer darzustellen folgt vorher noch ein kurzer Aufriss der Handlung des Romans. In dem Roman geht es um einen Schweizer Ingenieur namens Walter Faber, der in den Jahren 1933-35 Assistent an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich ist. Seine „halbjüdische“ Geliebte Hanna Landsberg of- fenbart ihm vor einer längeren geschäftlichen Reise, dass sie ein Kind von ihm erwartet. Da sie sich weigert zu heiraten, entscheiden sie sich für eine Abtrei- bung. Fabers Freund Joachim Hencke, der Arzt ist, soll diese durchführen. Hanna entscheidet sich anders, bringt das Kind zur Welt und heiratet Joachim. Von beidem weiß Faber, der sich in Bagdad aufhält, aber nichts. Nach dieser und einer weiteren geschiedenen Ehe, und diversen Reisen durch Europa landet Hanna in Griechenland.
Walter Faber, der seit 1946 als Ingenieur für die UNESCO arbeitet und in New York wohnt, lernt auf einem Flug Joachims Bruder, Herbert Hencke, der auf dem Weg zur Tabakplantage seines Bruders ist, kennen. Bei einer Notlandung ein der Wüste erfährt Faber von Herbert mehr über Hanna und Joachim und ihr Kind. Faber entschließt sich kurzzeitig ihn nach Guatemala zu begleiten. Dort treffen sie den Hobbyarchäologen Marcel, der ihnen hilft zur Plantage zu kommen. An der Plantage angekommen finden sie Joachim, der sich selbst er- hängt hat. Herbert bleibt auf der Plantage zurück. Walter Faber fährt zurück nach New York wo er zusammen mit seiner Geliebten, Ivy, ein Mannequin, lebt. Von dort aus fährt er mit dem Schiff nach Frankreich zu einer Konferenz. Auf dieser Reise lernt er, unwissend, dass es seine Tochter ist, Sabeth Piper, eine Studentin kennen. Zwischen ihnen baut sich eine Liebesbeziehung auf. Sie ist unterwegs zu ihrer Mutter nach Griechenland. In Paris sucht er sie wieder auf, und beschließt mit ihr zu fahren. Auf der Reise erfährt er, dass Sabeth Hannas Tochter ist, denkt aber es müsse Joachims Kind sein. Als Sabeth von einer Schlange gebissen wird und anschließend eine Böschung hinunterfällt, bringt Faber Sabeth nach Athen in ein Krankenhaus. Dort trifft er wieder auf Hanna, die ihm bestätigt, dass Sabeth seine Tochter ist. Sie befürchtet, dass sich eine sexuelle Beziehung zwischen den beiden gebildet hat, welche es tat- sächlich gegeben hat. Nach kurzer Zeit stirbt Sabeth im Krankenhaus aufgrund einer nicht diagnostizierten Schädelfraktur. Faber fliegt geschäftlich wieder nach Südamerika, wo er Herbert auf der Plantage besucht. Nach einem kurzen Aufenthalt in Kuba fliegt er wieder nach Europa. Als seine, wahrscheinlich durch Magenkrebs verursachten, Magenschmerzen zu stark werden, unterzieht er sich in Athen einer Operation, die er nicht überlebt. So weit zur Geschichte des Romans, jetzt sollten die Nebenfiguren mal genauer unter die Lupe ge- nommen werden.
Herbert Hencke ist ein etwa 30-jähriger Düsseldorfer, den Faber auf dem Flug nach Mexiko kennenlernt. Faber nimmt ihn, obwohl er gut 20 Jahre älter ist, merkwürdigerweise nicht als „so jung“ wahr (S. 8, o). Herbert ist im Auftrag der Hencke-Bosch AG unterwegs um die Tabakplantage, die sein Bruder Joa- chim Hencke leitet, zu begutachten. Während des Fluges fühlt sich Faber von Herbert genervt (vgl. S. 8 ff.), da dieser monologartig auf Faber einredet, ob- wohl von Seiten des Schweizers weder „Bedürfnis nach Bekanntschaft“ (S. 8, o) noch Interesse an Konversation besteht. Mit seinem nicht abreißenden Willen Kontakt zu Faber aufzunehmen ist Herbert eine Art Personifikation des „unentrinnbaren Schicksals“(3., vgl. S. 61, u), das ihn zu seinem Jugendfreund, seiner Tochter und schließlich noch zu seiner ehemaligen Geliebten führt. All diese Zufälle stehen in krassem Widerspruch zu Fabers Glauben an Wahr- scheinlichkeitsrechnungen und Statistiken (S. 22, m). Walter Faber versucht vergeblich diese Verkörperung des Schicksals abzuschütteln, er hatte sogar vor absichtlich den Weiterflug des Flugzeuges nach einem Zwischenstop zu ver- passen. Erst beim stummen Schachspielen nach einer Notlandung in der Wüste fängt er an Herbert sympathisch zu finden. Dort erfährt Faber, dass sein Ju- gendfreund Joachim Herberts Bruder ist, und, dass dieser Hanna geheiratet hat. Herbert hat einige Ähnlichkeiten mit Faber, da auch er über eine starre und vorurteilbeladene Denkweise verfügt. Das kommt vor allem dadurch zum Aus- druck, wenn er meint, „er kenne den Iwan, der nur durch Waffen zu belehren sei“ (S. 9, u). Des weiteren war er „mit seinem Urteil schon fix und fertig“ (S. 9, m), nach welchem er die Amerikaner als kulturlos bezeichnet, noch bevor er die USA zum ersten mal betreten hatte.
Herbert ist die Verkörperung des typischen Nachkriegsdeutschen, der zwar nach außen hin sich für den europäischen Zusammenhalt einsetzt, aber gleic h- zeitig noch nicht ganz ‘entnazifiziert‘ ist, da einige der damals gebräuchlichen Ausdrücke, wie „Herrenmensch“, „Untermensch“ (S. 9, u) und „Halbjüdin“ (S. 28, u), noch fest in seiner Sprache verankert sind. Auch die Tatsachen, dass er von seinen Kriegserlebnissen berichtet, als wäre es eine Urlaubsreise gewesen (vgl. S. 32, u), und das Benutzen alter volksverhetzender Naziparolen nach welchen Russen nur auf Waffengewalt reagierten (vgl. S. 9, u), sind frappant. Fragwürdig ist, ob Herbert, als er vom „guten Hitler“ (S. 9, u) spricht, diese Bezeichnung ernst meint, oder ob sie unpassende Ironie ist. Herberts verach- tendes Verhältnis zu anderen Völkern ist auch bemerkbar durch seine äußerst abfällige Bemerkung „aber Asiaten bleiben Asiaten“, und seine häufig benutzte Bezeichnung für den Russen „Iwan“ (S. 9, u).
Damit teilt er das gleiche Verhältnis, das Faber zu den Frauen, und den Deut- schen hat, die er nicht mag (vgl. S. 10, o). Walter Faber scheinen diese Ähn- lichkeit aufzufallen, da er träumt, er sei „mit dem Düsseldorfer verheiratet“ (S. 16, o).Dies erscheint ihm im Traum wie eine absolute Terrorvision, da in die- sem Traum viele Urängste Fabers vorkommen, wie zum Beispiel die ausgefal- lenen Zähne, das Chaos eines Casinos in Las Vegas und die Tatsache nackt zu sein (vgl. S. 15 f.).
Eine weitere Gemeinsamkeit der beiden ist, dass sie beide im Laufe der Zeit sich von der Zivilisation abwenden. Als Herbert mit Faber zur Plantage seines Bruders fährt, bleibt er allein zurück. Seine Entscheidung für ein Leben mit In- dioarbeitern, deren Sprache er nicht einmal versteht (vgl. S. 54, u), und ohne Zivilisation kommt sehr schnell und entschlossen, und obwohl Faber versucht ihn umzustimmen, bleibt er stur (vgl. S. 55, u). Herbert scheint dem Dschungel genauso verfallen zu sein, wie Faber der Technik (2., vgl. S. 67, u). Anfangs ekelte Herbert sich vor dem Dschungel, genau so wie Faber. Sie können den plötzlichen Wechsel zwischen ihrer zivilisierten, durchorganisierten Welt und dem Chaos des Dschungels schwer vertragen. Ihnen missfällt hier ihre Ohn- macht gegenüber der Natur. Als sie Zopilote verscheuchen wollen, schaffen sie es weder mit Steinen noch mit Technik, zum Beispiel die Hupe des Jeeps. Bei Herbert äußert sich das vor allem bei seinem großen Ekel vor den Zopiloten, die als Aasfresser für den Tod stehen könnten, der in einem Wutanfall endet (S. 53, u). Um so verwunderlicher, dass Herbert plötzlich alleine auf der Pla n- tage zurückbleiben will, was auch Faber nicht verstehen kann. Er scheint im Düsseldorfer eine Art Freund gefunden zu haben, da er ihn nicht gerne dort al- lein lässt, und ihn später sogar noch einmal besucht. Dort ist Herbert sehr glücklich ohne Zivilisation und Technik, er benutzt nicht einmal seinen Jeep (vgl. S. 167, o).
Marcel, ein junger Berufsmusiker französischer Abstammung aus Boston, den Faber und Herbert im Dschungel in Guatemala kennenlernen, ist schon von Anfang an mehr mit der Natur verbunden. Dies merkt man daran, dass Marcel eine anstrengende Fahrt durch den Dschungel überhaupt nichts ausmacht, im Gegensatz zu Walter Faber und Herbert. Während der ganzen Zeit pfeift er ein französisches Kinderlied, weshalb Faber ihn als kindisch und etwas daneben betrachtet. Daher meinte er, Marcel „pfiff [...] wie ein Bub und freute sich wie auf einer Schulreise“ (S. 49, m). Interessanterweise handelt dieses Kinderlied davon wie eine verhungernde Schiffsbesatzung einen Schiffsjungen verspeist. Marcel interessiert sich sehr für die Kultur der Maya, und untersucht in seinen Ferien Tempel in Guatemala. Er und Faber können der Lebensweise des je- weils anderen nichts abgewinnen, verachten sie sogar. Walter Faber nimmt Künstler überhaupt nicht ernst, „manchmal ging er [...] [ihm] auf die Nerven wie alle Künstler“ (S. 39, u), und tut Marcels Meinung als „Künstlerquatsch“ (S.50, m) ab. Im Gegensatz dazu paust Marcel, um Kopien herzustellen, die Reliefs eines Tempels einzeln ab, anstatt sie zu fotografieren, „sonst wären sie sofort tot“ (S. 42, o). Faber nennt ihn daher spöttisch „unser Ruinenfreund“ o- der „unser Pauspapierkünstler“ (S. 43 f.), denn er kann die Begeisterung an der Kultur der Maya nicht nachvollziehen, sie sei zu „primitiv“ (S. 44, o). Doch gerade dies fasziniert Marcel, „der die Maya liebt, gerade weil sie keinerlei Technik hatten“ (S. 44, o). Ironischerweise hat aber gerade Marcel den Ausflug zur Plantage ermöglicht, da er durch ein gutes Verhältnis zu einem Ortsansäs- sigen einen Jeep ausleihen konnte. Noch dazu hat er als Erster die Plantage entdeckt. Faber fühlt sich aber dennoch angegriffen, als Marcel seine Tätigkeit bei der UNESCO folgendermaßen beschreibt: „der Techniker als letzte Ausgab des weißen Missionars, Industrialisierung als letztes Evangelium einer sterben- den Rasse, Lebensstandard als Ersatz für Lebenssinn“ (S. 50, u). Später aller- dings auf Cuba schließt er sich der Meinung Marcels an und kritisiert sehr stark den ‘American Way of Life‘, der viel zu künstlich und oberflächlich ist (vgl. S. 175, m). Marcel hat schließlich doch bewirkt, dass Faber sich etwas geändert hat, und sich Gedanken über andere Lebensweisen macht, zum Beispiel, wie die Maya, ohne Technik (vgl. S.44, m).
Die Begeisterung für so eine techniklose Welt kann Walter Fabers Lehrer, Pro- fessor für Elektrodynamik an der eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich, Professor O, nicht teilen. Er gehört zur selben Art von Menschen wie Faber, die einen unerschütterlichen Glauben in die Technik haben. Professor O. ist für Faber „immer eine Art Vorbild gewesen“ (S.103, m), aber als er sieht, wie der Professor älter wird und sich dem Tod wird Faber nachdenklich. Das O. steht für den griechischen Buchstaben Omega, der der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet ist, und Symbol für das Ende und den Tod. Faber sieht den Verfall des Professors und weiß, dass ihn das selbe Schicksal erwartet. A- ber gerade diesen Gedanken versucht er zu verdrängen, und will sich selbst ‘beweisen‘, wie jung und vital er noch ist. Daher empfindet er Herbert als nicht „so jung“ (S. 9, o), obwohl Faber sehr viel älter ist. Auch seine Beziehungen zu viel jüngeren Frauen, wie Ivy und Sabeth, machen dies deutlich.
Faber kann den Verfall des Professors schwer vertagen. Als er ihn bei einer Konferenz wieder sieht, beschreibt er ihn wie einen Toten (vgl. .S. 102 f.) und war sich sicher, dass er gestorben ist (vgl. S 102, u). Eine auf das Treffen fol- gende Einladung des Professor zu einem Aperitif nimmt er nicht an, der Kon- takt mit ihm scheint Faber zu stören. Das ist darauf zurück zu führen, dass Fa- ber schon seit einiger Zeit stärker werdende Magenbeschwerden hat, die in ihm eine Angst vor einem Tumor hervorrufen. Bei einem letzten Treffen mit Pro- fessor O. in Zürich, merkt Faber, wie vergänglich alles ist, da seine Tochter vor kurzem gestorben ist, Professor O. bald sterben wird und das von ihm „gehass- te“ (S. 184, m), Café Odeon wird bald abgerissen (S. 194, m). Nun erkennt auch Faber, dass seine Zeit begrenzt ist, und will nur noch einmal zurück nach Athen zu Hanna. Auf der Reise kündigt er seinen Beruf. Walter Faber verspürt nun ein starkes Bedürfnis nach Natur, und beschreibt die Schönheit dieser (vgl. S. 195 f.). Sein „Wunsch, die Erde zu greifen“ (S. 195, m) wird nicht mehr in Erfüllung gehen.
Dieses letzte Treffen mit Professor O. in Zürich hat Walter Faber die Augen geöffnet, und ihm gezeigt, wie viel er verpasst hat, aufgrund seiner übertriebenen Liebe zur Technik und nicht zur Kunst und zur Natur. Es war der etzte Ruck, der ihn zu der ‘richtigen‘ Lebensweise geführt hat. Es war das letzte Glied in einer Reihe von Ereignissen, von den Figuren Herbert, Marcel und Professor O. ausgehend, die Faber nachhaltig verändert haben.
Quellen
Primärliteratur:
Max Frisch, „Homo faber - Ein Bericht“, Suhrkamp Verlag, 1977
Sekundärliteratur:
1. Edgar Neis, „Homo faber, Bausteine Deutsch“, C. Bange Verlag, 1984
2. Reinhard Kästler, „Königs Erläuterungen und Material“, C. Bange Verlag, 1987
3. Hildegard Hain, „Lektüre - Durchblick“, Mentor Verlag, 1995
Häufig gestellte Fragen zu "Homo Faber"
Worum geht es in dem Roman "Homo Faber" von Max Frisch?
Der Roman handelt von Walter Faber, einem UNESCO-Ingenieur, der ein rationales, technokratisches Weltbild hat. Er erlebt eine Reihe von Zufällen und Begegnungen, die ihn zwingen, seine Weltanschauung zu hinterfragen. Dazu gehören die Begegnung mit Herbert Hencke, der ihm von seiner Jugendliebe Hanna und deren Ehe mit seinem Freund Joachim erzählt, die Beziehung zu Sabeth, von der er später erfährt, dass sie seine Tochter ist, und die Begegnung mit dem Hobbyarchäologen Marcel.
Welche Rolle spielen die Nebenfiguren im Roman "Homo Faber"?
Die Nebenfiguren haben einen bedeutenden Einfluss auf Walter Fabers Entwicklung. Herbert Hencke verkörpert das Schicksal und konfrontiert Faber mit seiner Vergangenheit. Marcel kritisiert Fabers technokratische Denkweise und den "American Way of Life". Professor O., Fabers ehemaliger Lehrer, symbolisiert das Alter und den Tod und zwingt Faber, sich seiner eigenen Vergänglichkeit bewusst zu werden.
Wer ist Herbert Hencke und welche Bedeutung hat er für Walter Faber?
Herbert Hencke ist der Bruder von Joachims, der mit Hanna verheiratet war, Fabers Jugendliebe. Er lernt Faber auf einem Flug kennen und erzählt ihm von Hanna und Joachim. Herbert verkörpert das Schicksal und konfrontiert Faber mit seiner Vergangenheit. Er hat eine starre Denkweise, die der von Faber ähnelt. Im Laufe der Geschichte wendet er sich von der Zivilisation ab und bleibt auf der Plantage seines Bruders zurück.
Wer ist Marcel und welche Rolle spielt er im Roman?
Marcel ist ein junger Hobbyarchäologe, den Faber und Herbert im Dschungel von Guatemala treffen. Er interessiert sich für die Kultur der Maya und kritisiert Fabers technokratische Denkweise. Marcel ermöglicht den Ausflug zur Plantage und konfrontiert Faber mit der Frage nach dem Lebenssinn.
Wer ist Professor O. und warum ist er wichtig für Walter Faber?
Professor O. war Fabers Lehrer an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Er verkörpert das Alter und den Tod und zwingt Faber, sich seiner eigenen Vergänglichkeit bewusst zu werden. Die Begegnung mit Professor O. öffnet Faber die Augen für die Dinge, die er aufgrund seiner übertriebenen Liebe zur Technik verpasst hat.
Wie verändert sich Walter Faber im Laufe des Romans?
Zu Beginn des Romans ist Walter Faber ein rationaler, technokratischer Mensch, der wenig Wert auf Gefühle und Beziehungen legt. Durch die Begegnungen mit den Nebenfiguren und die tragischen Ereignisse, die er erlebt, wird er nachdenklicher und hinterfragt seine Weltanschauung. Er entwickelt ein stärkeres Bedürfnis nach Natur und menschlicher Nähe.
Was sind die Hauptthemen des Romans "Homo Faber"?
Die Hauptthemen des Romans sind die Auseinandersetzung zwischen Technik und Natur, die Frage nach dem Schicksal und der Zufall, die Suche nach Identität und Sinn im Leben sowie die Beziehung zwischen Vergangenheit und Gegenwart.
Welche literarischen Quellen werden im Text erwähnt?
Als Primärliteratur wird "Homo faber - Ein Bericht" von Max Frisch genannt. Als Sekundärliteratur werden genannt: 1. Edgar Neis, „Homo faber, Bausteine Deutsch“, C. Bange Verlag, 1984; 2. Reinhard Kästler, „Königs Erläuterungen und Material“, C. Bange Verlag, 1987; 3. Hildegard Hain, „Lektüre - Durchblick“, Mentor Verlag, 1995; 4. Elisabeth Durm, „Interpretationshilfe Deutsch“, Stark Verlag, 1999.
- Quote paper
- Philippe Hass (Author), 2001, Frisch, Max - Homo Faber - Bedeutung von Herbert, Marcel und Professor O., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103013