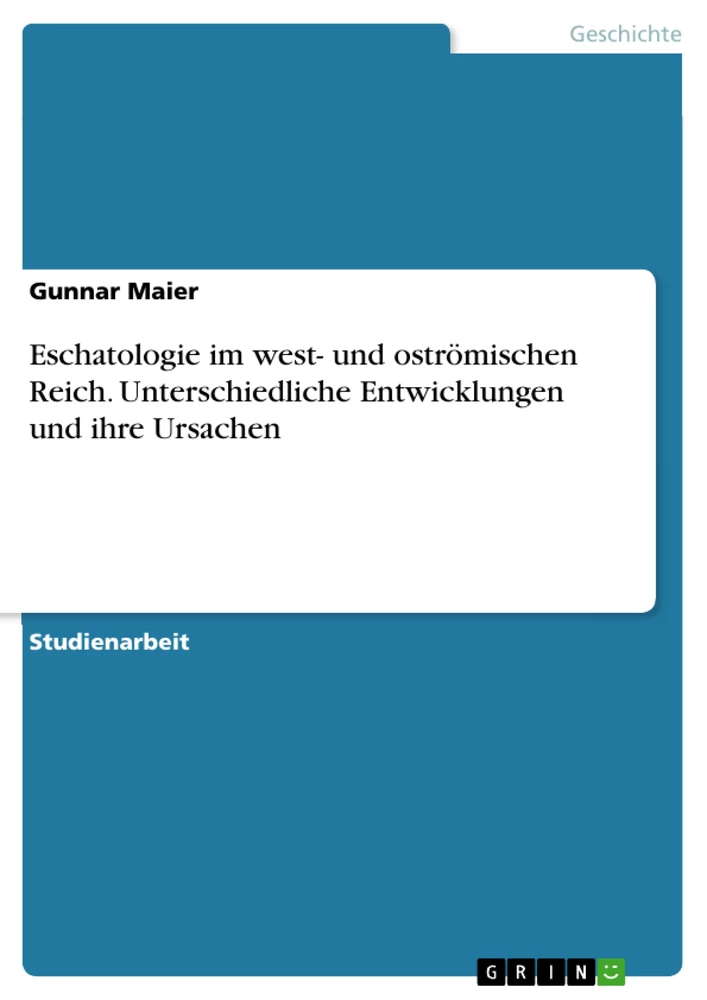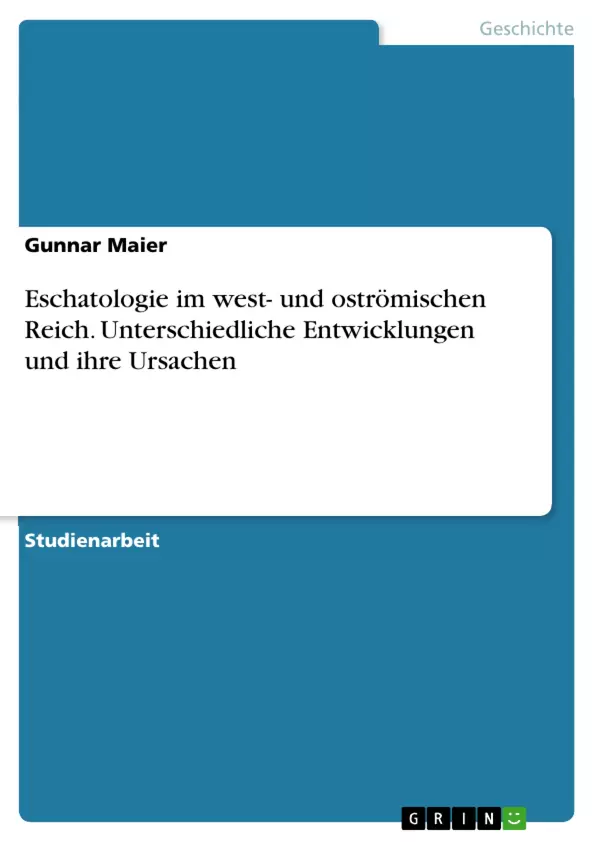Im Verlauf dieser Arbeit werden die Ursachen für das Zustandekommen eigener Vorstellungen zum christlichen Weltuntergangsdenken in der frühen orthodoxen Kirche als zentrales Element der byzantinischen Gesellschaft untersucht und die Gründe für die unterschiedlichen Weltuntergangsszenarien herausgearbeitet.
Betrachtet man die christlichen Kirchengemeinden des frühen Mittelalters, also die römisch-katholische und die griechisch-orthodoxe, so lassen sich verbindende Elemente, etwa in der Unterteilung der Weltzeit in 6 Zeitalter von je 1000 Jahren und in dem Denken, dass nicht christliche Gebiete als Reich des Antichristen durch die Macht Roms im Gleichgewicht gehalten werden, noch klar erschließen.
Der erste wesentliche Schritt zur Auseinanderentwicklung beider Richtungen wird aber klar in den Zeitraum von 425-600 n.Chr. eingeordnet, welcher als Entstehungszeitraum des griechisch-orthodoxen Glaubens als eigene religiöse Gruppierung gilt. Gerade in diesem Zeitraum sind für Osteuropa bzw. Gebiete des späteren byzantinischen Reiches akute Weltuntergangsängste in breiteren Schichten der Bevölkerung, etwa durch gleichzeitige, militärische Bedrohungen aus dem Balkanraum und dem arabischen Raum, klar ersichtlich. In westeuropäischen, christlichen Gebieten sind derartige Ängste zu dieser Zeit aber fast gar nicht ersichtlich.
Ab diesem Zeitraum werden zudem nicht-orthodoxe Regionen, also auch römisch-katholische Gebiete, verstärkt in das Reich des Antichristen eingeordnet. Des Weiteren bildete sich vermehrt ein eigenes Weltuntergangsdenken heraus, nach dem sich das byzantinische Reich bereits als idealtypische Staatsform im Sinne des nachapokalyptischen Gottesreiches begriff und damit vor allem auf den Erhalt seiner bestehenden Einheit gegen äußere Bedrohungsfaktoren abzielte. Eine Abgrenzung vom antiken Römerreich mit Rom als Zentrum ist damit deutlich erkennbar.
Inhaltsverzeichnis
- I. Die Einführung des Christentums als Staatsreligion im römischen Reich
- a) Die Einführung des Christentums durch Kaiser Konstantin
- b) Die Bedeutung des Christentums als Herrschaftsinstrument
- II. Unmittelbare Folgen der Teilung des römischen Reiches in West- und Ostrom
- a) Unterschiedliche Voraussetzungen von Ost und Westrom
- b) Erste eigene Entwicklungen des oströmischen Reiches
- III. Der Untergang des weströmischen Reiches
- a) Die Entwicklung des weströmischen Reiches bis zur Eroberung Roms 410 n.Chr.
- b) Die Wahrnehmung der Eroberung Roms 410 n. Chr.
- IV. Eschatologie in der römischen Geschichtsschreibung des 5. und 6. Jahrhunderts
- a) Die Wahrnehmung von Zeit und Geschichte nach Vorstellung des frühen Christentums
- b) Christlich-eschatologisches Denken in der späten römischen Geschichtsschreibung
- aa) Grundsätzliche Charakteristiken der christlichen Geschichtsschreibung im späten römischen Reich
- bb) Weitergehende Gedanken zur Berechnung der Weltzeit
- cc) Bedeutung eschatologischer Vorstellungen in der römischen Geschichtsschreibung für die Gebiete des oströmischen und des weströmischen Reiches
- V. Gesamtergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung unterschiedlicher Vorstellungen vom christlichen Weltuntergangsdenken in der frühen orthodoxen Kirche und im byzantinischen Reich. Das zentrale Ziel ist die Analyse der Ursachen für diese divergierenden Eschatologien und die Herausarbeitung der Gründe für die unterschiedlichen Weltuntergangsszenarien in Ost und West.
- Einführung des Christentums als Staatsreligion und dessen Auswirkungen auf Ost und West
- Die Teilung des römischen Reiches und die daraus resultierenden unterschiedlichen Entwicklungen
- Der Untergang des weströmischen Reiches und dessen Wahrnehmung
- Eschatologische Vorstellungen in der römischen Geschichtsschreibung des 5. und 6. Jahrhunderts
- Vergleichende Analyse der eschatologischen Entwicklungen in Ost- und Weströmischen Reich
Zusammenfassung der Kapitel
I. Die Einführung des Christentums als Staatsreligion im römischen Reich: Dieses Kapitel beleuchtet die komplexen Umstände der zunehmenden Bedeutung des christlichen Glaubens im römischen Staat. Es untersucht die Rolle Kaiser Konstantins bei der Anerkennung des Christentums, insbesondere im Kontext der Schlacht an der Milvischen Brücke. Die Analyse konzentriert sich auf die schwer rekonstruierbaren Motivationen Konstantins und die sich daraus ergebenden Folgen für die Christen, inklusive der staatlichen Förderung des Christentums unter Konstantin und Licinius. Die Entwicklung hin zu einer staatstragenden Rolle des Christentums wird im Kontext des Konzils von Nikäa 325 n. Chr. eingeordnet.
II. Unmittelbare Folgen der Teilung des römischen Reiches in West- und Ostrom: Dieses Kapitel befasst sich mit den unterschiedlichen Voraussetzungen in Ost- und Westrom nach der Reichsteilung und den daraus resultierenden eigenen Entwicklungen im oströmischen Reich. Es werden die spezifischen Faktoren analysiert, die zu unterschiedlichen Entwicklungspfaden führten und den Grundstein für die späteren Divergenzen in der Eschatologie legten.
III. Der Untergang des weströmischen Reiches: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der Entwicklung des weströmischen Reiches bis zur Eroberung Roms im Jahr 410 n. Chr. Es wird die politische, soziale und kulturelle Situation analysiert, die zu diesem Ereignis führte. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die detaillierte Betrachtung der unterschiedlichen Wahrnehmungen der Eroberung Roms in den verschiedenen gesellschaftlichen Schichten und deren Auswirkungen auf die Entwicklung der Eschatologie im Westen.
IV. Eschatologie in der römischen Geschichtsschreibung des 5. und 6. Jahrhunderts: Dieses Kapitel analysiert die eschatologischen Vorstellungen in der römischen Geschichtsschreibung des 5. und 6. Jahrhunderts. Es untersucht die Wahrnehmung von Zeit und Geschichte im frühen Christentum und die Entwicklung des christlich-eschatologischen Denkens in der späten römischen Geschichtsschreibung. Die Analyse konzentriert sich auf die Charakteristiken der christlichen Geschichtsschreibung, die Gedanken zur Berechnung der Weltzeit und die Bedeutung eschatologischer Vorstellungen für die Gebiete des oströmischen und des weströmischen Reiches. Die Kapitel untersucht, wie unterschiedliche Interpretationen biblischer Texte zu verschiedenen Vorstellungen über das Ende der Welt und die Rolle des römischen Reiches führten.
Schlüsselwörter
Christentum, Staatsreligion, Römisches Reich, Ostrom, Westrom, Reichsteilung, Untergang Westroms, Eschatologie, Weltuntergang, Byzanz, Geschichtsschreibung, christlich-eschatologisches Denken, Zeitrechnung, Antichrist.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Untersuchung der Entstehung unterschiedlicher Vorstellungen vom christlichen Weltuntergangsdenken
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehung unterschiedlicher Vorstellungen vom christlichen Weltuntergangsdenken (Eschatologie) in der frühen orthodoxen Kirche und im byzantinischen Reich. Das zentrale Ziel ist die Analyse der Ursachen für diese divergierenden Eschatologien und die Herausarbeitung der Gründe für die unterschiedlichen Weltuntergangsszenarien in Ost und West.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Einführung des Christentums als Staatsreligion, die Folgen der Teilung des römischen Reiches, den Untergang des weströmischen Reiches und dessen Wahrnehmung, sowie die eschatologischen Vorstellungen in der römischen Geschichtsschreibung des 5. und 6. Jahrhunderts. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich der eschatologischen Entwicklungen in Ost- und Weströmischen Reich.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Kapitel I behandelt die Einführung des Christentums als Staatsreligion; Kapitel II die unmittelbaren Folgen der Reichsteilung; Kapitel III den Untergang des weströmischen Reiches; Kapitel IV die Eschatologie in der römischen Geschichtsschreibung des 5. und 6. Jahrhunderts; und Kapitel V fasst die Ergebnisse zusammen.
Was wird in Kapitel I behandelt?
Kapitel I beleuchtet die komplexen Umstände der zunehmenden Bedeutung des christlichen Glaubens im römischen Staat, die Rolle Kaiser Konstantins, die Motivationen Konstantins und die Folgen für die Christen, sowie die staatliche Förderung des Christentums und das Konzil von Nikäa 325 n. Chr.
Was wird in Kapitel II behandelt?
Kapitel II befasst sich mit den unterschiedlichen Voraussetzungen in Ost- und Westrom nach der Reichsteilung und den daraus resultierenden eigenen Entwicklungen im oströmischen Reich. Analysiert werden die Faktoren, die zu unterschiedlichen Entwicklungspfaden führten und den Grundstein für spätere Divergenzen in der Eschatologie legten.
Was wird in Kapitel III behandelt?
Kapitel III konzentriert sich auf die Entwicklung des weströmischen Reiches bis zur Eroberung Roms 410 n. Chr. Es analysiert die politische, soziale und kulturelle Situation, die zu diesem Ereignis führte, und die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Eroberung Roms in den verschiedenen gesellschaftlichen Schichten.
Was wird in Kapitel IV behandelt?
Kapitel IV analysiert die eschatologischen Vorstellungen in der römischen Geschichtsschreibung des 5. und 6. Jahrhunderts. Es untersucht die Wahrnehmung von Zeit und Geschichte im frühen Christentum, die Entwicklung des christlich-eschatologischen Denkens, die Charakteristiken der christlichen Geschichtsschreibung, Gedanken zur Berechnung der Weltzeit und die Bedeutung eschatologischer Vorstellungen für Ost- und Weströmisches Reich. Es wird untersucht, wie unterschiedliche Interpretationen biblischer Texte zu verschiedenen Vorstellungen über das Ende der Welt und die Rolle des römischen Reiches führten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Christentum, Staatsreligion, Römisches Reich, Ostrom, Westrom, Reichsteilung, Untergang Westroms, Eschatologie, Weltuntergang, Byzanz, Geschichtsschreibung, christlich-eschatologisches Denken, Zeitrechnung, Antichrist.
- Citation du texte
- Gunnar Maier (Auteur), 2012, Eschatologie im west- und oströmischen Reich. Unterschiedliche Entwicklungen und ihre Ursachen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1029954