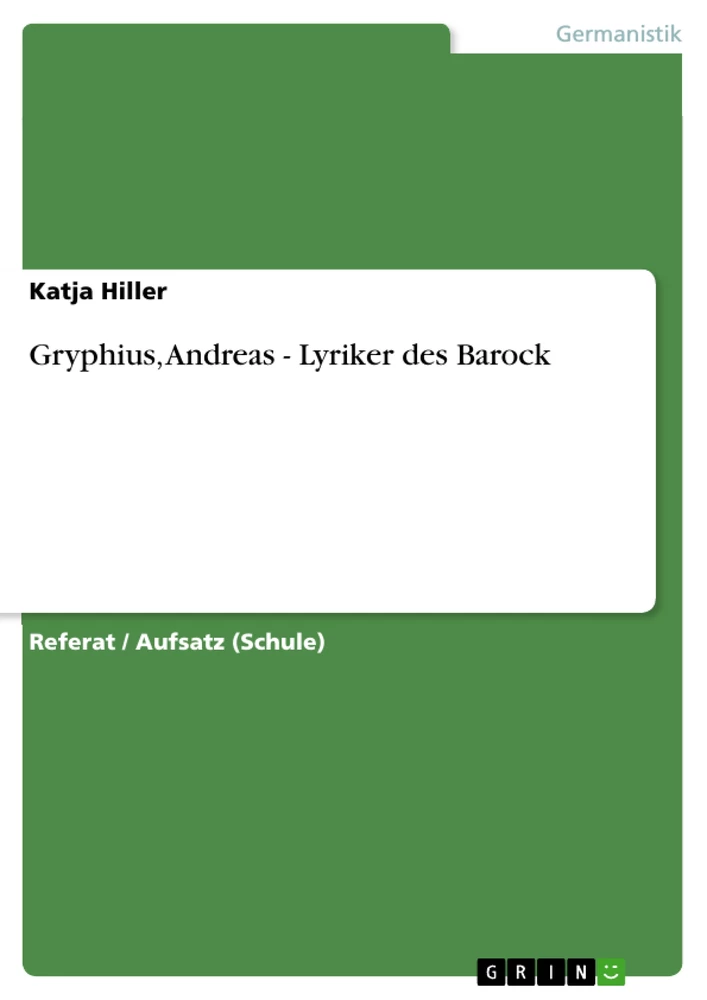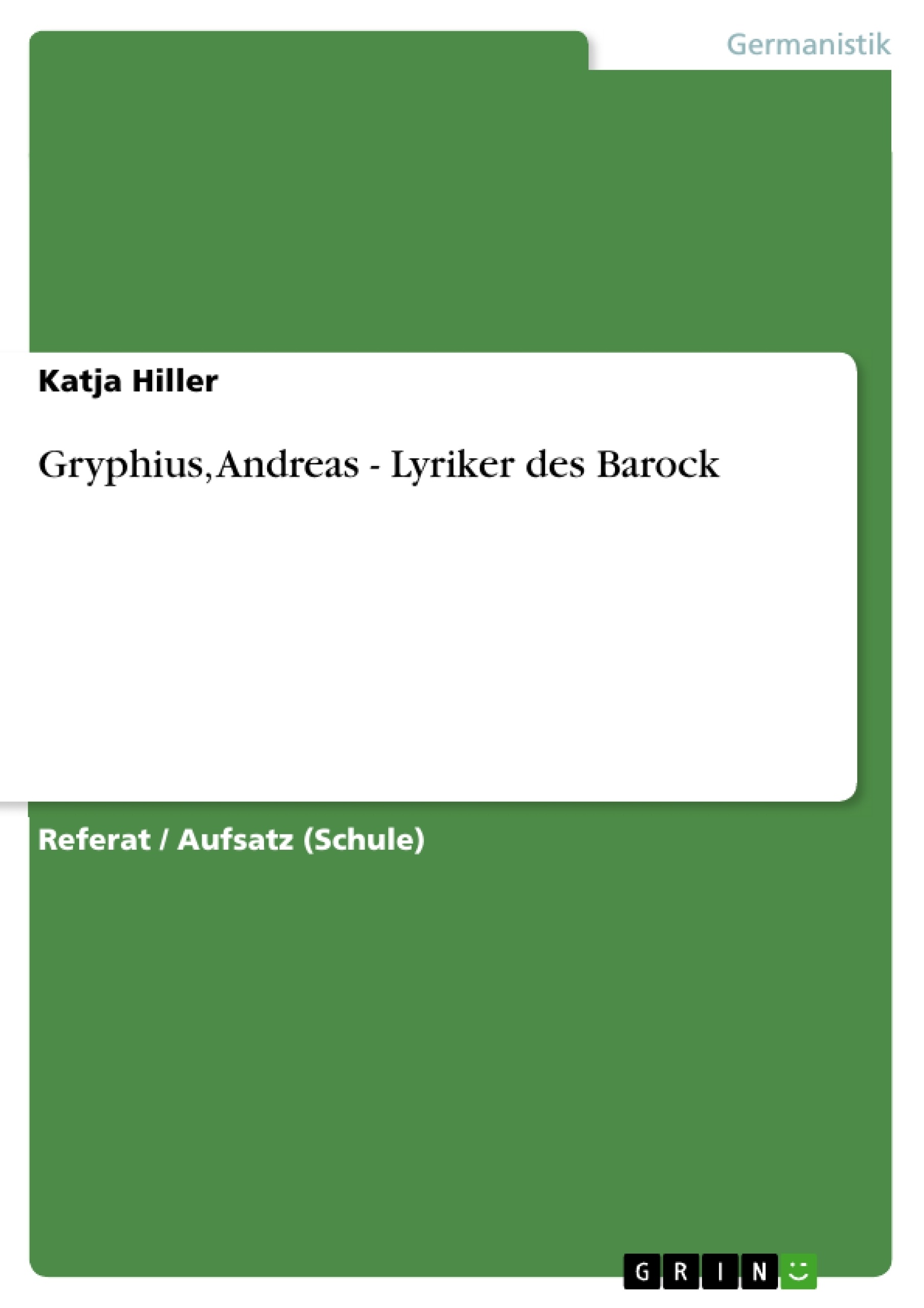Barock (1600 - 1720)
a) Allgemeines
- portugiesisch; pérola barroca = unregelmäßige Perle (Übertreibung, Prunk) · Ende 18. Jh. Verwendung als Epochenbegriff
- Adjektiv „barock“ im 18. und 19. Jahrhundert Geschmacksbegriff mit meist abwertender Bedeutung (bizarr, grotesk, schwülstig)
- 20. Jh. Verwendung in der Literatur
- Barock bezeichnet einerseits einen charakterisierten Stil (durch Merkmale gekennzeichnet)
- andererseits die Epoche zwischen Reformationszeit bzw. Renaissance und Aufklärung
b) das Weltbild des Barocks
- Schmuck, Üppigkeit, Bewegtheit der Formen
- zerrissenes Lebensgefühl, Widerstreit zwischen Ewigkeit und Vergänglichkeit, Todesangst (z.T. religiös bedingt, z.T. durch Dreißigjährigen Krieg) und Lebenshunger, pessimistisch- hoffend
- Höfe der absolutistischen Fürsten als kulturelle Mittelpunkte, Bildung von Sprachgesellschaften ( gebildete Adlige und bürgerliche Gelehrte schlossen sich zusammen )
c) historischer Hintergrund
- Reformation, Glaubensspaltung (Gegenreformation), Absolutismus, Dreißigjähriger Krieg (1618 - 48), den nur ein Drittel der deutschen Bevölkerung überlebte, moralischer und kultureller Verfall, Machtkämpfe der Fürsten, Kriegsverfallenheit und Friedenssehnsucht · historischen Umbruchssituation (Zerfall des Reiches, eine höchst widerspruchsvolle religiöse, philosophische und wissenschaftliche Entwicklung )
d) literarische Formen
- Jesuitendrama (Dramendichtung von Angehörigen des Jesuitenordens) · Tragödie, Komödie, Roman, erzählende Dichtung
- Schäferdichtung (Schaffung einer paradiesischen Hirtenwelt)
e) Vertreter Andreas Gryphius
Martin Opitz
Andreas Gryphius
- Verfasser von Dramen, Trauer- und Lustspielen, großer Lyriker · geprägt von tiefem Pessimismus
- am 2. Oktober 1616 als Andreas Greif in Glogau, Schlesien, geboren
- ab 1638 Studium in Leiden (Sprachstudium), später dort akademischer Lehrer
- von 1644 ausgedehnte Reisen nach Frankreich, Italien und Straßburg , kehrte 1647 nach Schlesien zurück
- 1650 Titel: Syndikus der Stände des Fürstentums Glogau
- durch Erfahrung des 30-jährigen Krieges Stimmung des beständigen Memento mori
("Gedenken des Todes!") - schwere Kindheit
- in seinen Stücken Niederschlag seiner leidgeprüften Zeit · großer Teil seiner Lyrik religiösen Charakters · starb am 16. Juli 1664 in Glogau.
Werke u.a.:
1639 Son- und Feyrtags-Sonnete 1650 Teutsche Reim-Gedichte
1657 Cardenio und Celinde 1657 Catharina von Georgien
Inhalt des Textes:
- Dreißigjährigen Krieg (1618-1648)
- Folgen , verheerende Auswirkung des Krieges · Leid, Schmerz und Kummer der Menschen
- durch Metapher ,,Thränen des Vaterlandes" wird dem Leser ein Bild von einem weinenden Land vermittelt
- erkennt schon an Überschrift zeitliche Einordnung
Formale Auffälligkeiten des Textes:
- hielt sich an "Regeln" und "Gesetze" , strenge Form von Dichtungen
- besitzt strengen äußeren Aufbau
- nicht alltägliche Sprache - damalige Zeit - Schrägstriche statt Kommas oder Sprechpausen
- Sonett ( übersetzt Klanggedicht )
- in allen 4 Strophen eine Steigerung zum jeweiligen nächsten = Finalstruktur ( Merkmal für Sonett in Barockzeit )
- Grundform eines Sonettes:
- zwei Quartette (Vierzeiler) mit je einem umschließenden Reim
- zwei Terzetten (Dreizeiler) mit einem Schweifreim
- durchgehend findet man Jambus
- erstes Quartett (Z. 1 - 4) Reimschemaabba
- allgemein der Krieg mit Elementen beschrieben
- schon in erster Zeile stellt er fest, dass sie alle ,,...nunmehr gantz / ja mehr denn gantz
verheeret !" (Z.:1) seien
- Wiederholung des Wortes ,,gantz" (Z.:1) steigert Eindringlichkeit der Aussage
- Krieg, der die mit ,,...Schweiß / Fleiß..."(Z.:4) hart erarbeiteten ,,...Vorr[ä]th[e]..." (Z.:4) und
Errungenschaften armer Bauern oder des Adels zerstört
- zweite Quartett (Z. 5 - 8) Reimschemaabba
- erweitert Gedanken
- beschreibt Folgen des Krieges für Menschen in Stadt und Umgebung
- zeigt, wie sich Umfeld verändert und Leben härter wird
- bildliche Beschreibung in den Zeilen fünf und sechs - so leichter nachvollziehen
- achte Zeile - Klimax (Höhepunkt) ,,...Feuer / Pest und Tod..."
- das Bild ,,...die Kirch ist umgekehret."(Z.:5) bedeutet Glaubenswandel der Kirche
- im ersten Terzett (Z.: 9 - 11) werden die Aussagen des zweiten Quartettes gesteigert
- Bild von Schlachtfeld vermittelt
- man denkt es sei nicht mehr zu übertreffen
- zweite Terzett (Z.12-14)
- wird ausgesagt, dass Abkehr vom christlichen Glauben an Gott viel schlimmer (Z.:13
,,...grimmer...") ,,...als der Tod"(Z.:12), ,,...die Pest [...] [,]Glutt und Hungersnoth"(Z.:13) sei
- Vergleich zwischen 1. und 2. Zeile
- man denkt bei erster Zeile ,,Wir sind doch nunmehr gantz / ja mehr denn gantz verheeret!" es
sei der Fakt, den Gedicht beschreibt (als einzige mit Ausrufezeichen)
- Aussage wird unerwartet in letzter Zeile übertroffen = eigentliches Anliegen des Dichters
- andere Teile des Werkes waren Mittel zum Zweck um Bedeutung des darzustellenden
Problems zu verdeutlichen, um zu zeigen wie ernst es ihm ist
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Barock (1600 - 1720)?
Das Barock war eine Epoche zwischen ca. 1600 und 1720. Der Begriff stammt vom portugiesischen Wort "pérola barroca" (unregelmäßige Perle) und wurde im 18. Jahrhundert als Epochenbegriff verwendet. Im 18. und 19. Jahrhundert hatte das Adjektiv "barock" oft eine abwertende Bedeutung (bizarr, grotesk, schwülstig), während es im 20. Jahrhundert in der Literatur neutraler verwendet wurde. Das Barock bezeichnet einerseits einen charakteristischen Stil und andererseits die Epoche zwischen Reformation/Renaissance und Aufklärung.
Welches Weltbild prägte das Barock?
Das Barock war geprägt von Schmuck, Üppigkeit und bewegten Formen. Es herrschte ein zerrissenes Lebensgefühl, ein Widerstreit zwischen Ewigkeit und Vergänglichkeit, Todesangst (teilweise religiös bedingt, teilweise durch den Dreißigjährigen Krieg) und Lebenshunger, sowie eine pessimistisch-hoffende Haltung. Die Höfe der absolutistischen Fürsten waren kulturelle Mittelpunkte, und es bildeten sich Sprachgesellschaften.
Was war der historische Hintergrund des Barock?
Der historische Hintergrund umfasste die Reformation, Glaubensspaltung (Gegenreformation), Absolutismus, den Dreißigjährigen Krieg (1618 - 48), der nur von einem Drittel der deutschen Bevölkerung überlebt wurde, moralischer und kultureller Verfall, Machtkämpfe der Fürsten, Kriegsverfallenheit und Friedenssehnsucht. Es war eine historische Umbruchssituation mit dem Zerfall des Reiches und einer widersprüchlichen religiösen, philosophischen und wissenschaftlichen Entwicklung.
Welche literarischen Formen waren im Barock verbreitet?
Zu den literarischen Formen gehörten das Jesuitendrama, Tragödie, Komödie, Roman und erzählende Dichtung. Die Schäferdichtung schuf eine paradiesische Hirtenwelt.
Wer waren wichtige Vertreter des Barock?
Wichtige Vertreter waren Andreas Gryphius und Martin Opitz.
Wer war Andreas Gryphius?
Andreas Gryphius (1616-1664) war ein Verfasser von Dramen, Trauer- und Lustspielen sowie ein großer Lyriker. Er war geprägt von tiefem Pessimismus. Er studierte ab 1638 in Leiden und reiste ab 1644 nach Frankreich, Italien und Straßburg. Ab 1650 war er Syndikus der Stände des Fürstentums Glogau. Seine Werke sind durch die Erfahrung des Dreißigjährigen Krieges und das Memento mori geprägt.
Was ist der Inhalt des Textes "Tränen des Vaterlandes" von Andreas Gryphius?
Der Text thematisiert den Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) und dessen verheerende Auswirkungen, das Leid, den Schmerz und den Kummer der Menschen. Die Metapher "Thränen des Vaterlandes" vermittelt ein Bild von einem weinenden Land.
Welche formalen Auffälligkeiten weist der Text "Tränen des Vaterlandes" auf?
Der Text hält sich an strenge Regeln und Gesetze, die für Dichtungen im Barock galten. Er besitzt einen strengen äußeren Aufbau und verwendet eine nicht alltägliche Sprache. Es handelt sich um ein Sonett mit einem strengen Reimschema. Durchgehend findet man Jambus.
Wie ist die Struktur des Sonetts "Tränen des Vaterlandes"?
Das Sonett besteht aus zwei Quartetten (Vierzeiler) mit je einem umschließenden Reim (abba) und zwei Terzetten (Dreizeiler) mit einem Schweifreim.
Was beschreibt das erste Quartett des Sonetts?
Das erste Quartett (Z. 1-4) beschreibt die Zerstörung des Landes durch den Krieg. Es wird festgestellt, dass alles "nunmehr gantz / ja mehr denn gantz verheeret!" (Z.:1) sei. Die Wiederholung des Wortes "gantz" (Z.:1) steigert die Eindringlichkeit der Aussage. Der Krieg zerstört die "Vorr[ä]th[e]" (Z.:4), die durch "Schweiß / Fleiß" (Z.:4) hart erarbeitet wurden.
Was beschreibt das zweite Quartett des Sonetts?
Das zweite Quartett (Z. 5-8) erweitert die Gedanken und beschreibt die Folgen des Krieges für die Menschen in Stadt und Umgebung. Es zeigt, wie sich das Umfeld verändert und das Leben härter wird. Die achte Zeile enthält eine Klimax (Höhepunkt) mit "Feuer / Pest und Tod...". Das Bild "die Kirch ist umgekehret." (Z.:5) bedeutet den Glaubenswandel der Kirche.
Was beschreiben die Terzetten des Sonetts?
Im ersten Terzett (Z. 9-11) werden die Aussagen des zweiten Quartettes gesteigert. Es wird ein Bild von einem Schlachtfeld vermittelt. Das zweite Terzett (Z.12-14) sagt aus, dass die Abkehr vom christlichen Glauben an Gott viel schlimmer ("...grimmer...") (Z.:13) sei als der Tod (Z.:12), die Pest und Hungersnot (Z.:13).
Was ist die Kernaussage des Sonetts "Tränen des Vaterlandes"?
Die Aussage in der letzten Zeile, dass die Abkehr von Gott schlimmer ist als die direkten Folgen des Krieges, übertrifft unerwartet die Aussage der ersten Zeile. Dies ist das eigentliche Anliegen des Dichters. Die anderen Teile des Werkes dienen dazu, die Bedeutung des Problems zu verdeutlichen.
- Quote paper
- Katja Hiller (Author), 2001, Gryphius, Andreas - Lyriker des Barock, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102989