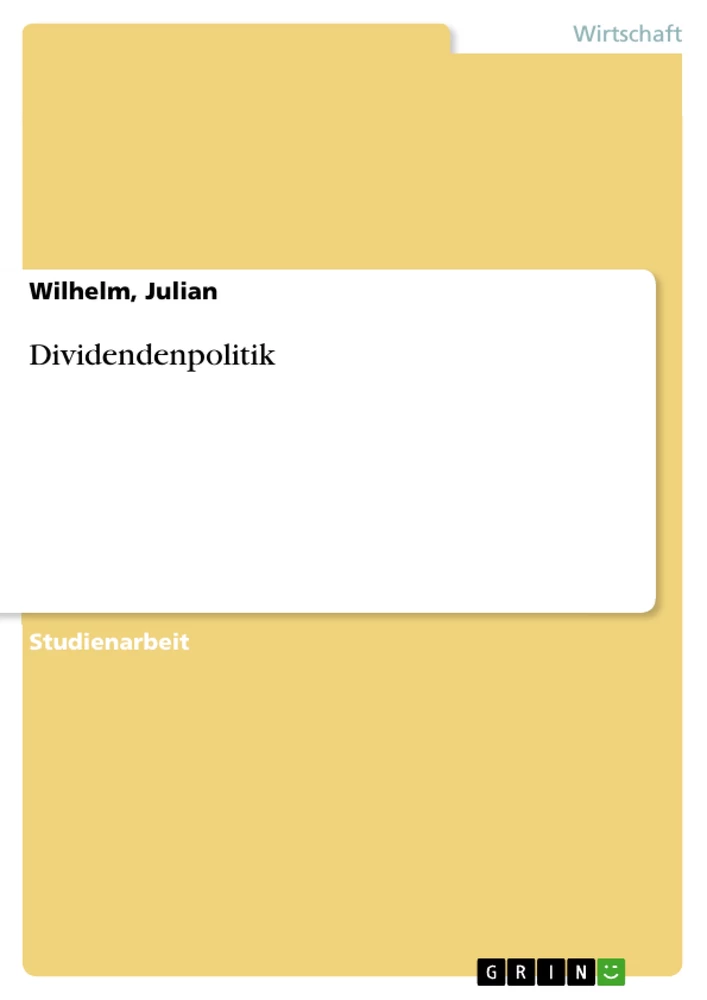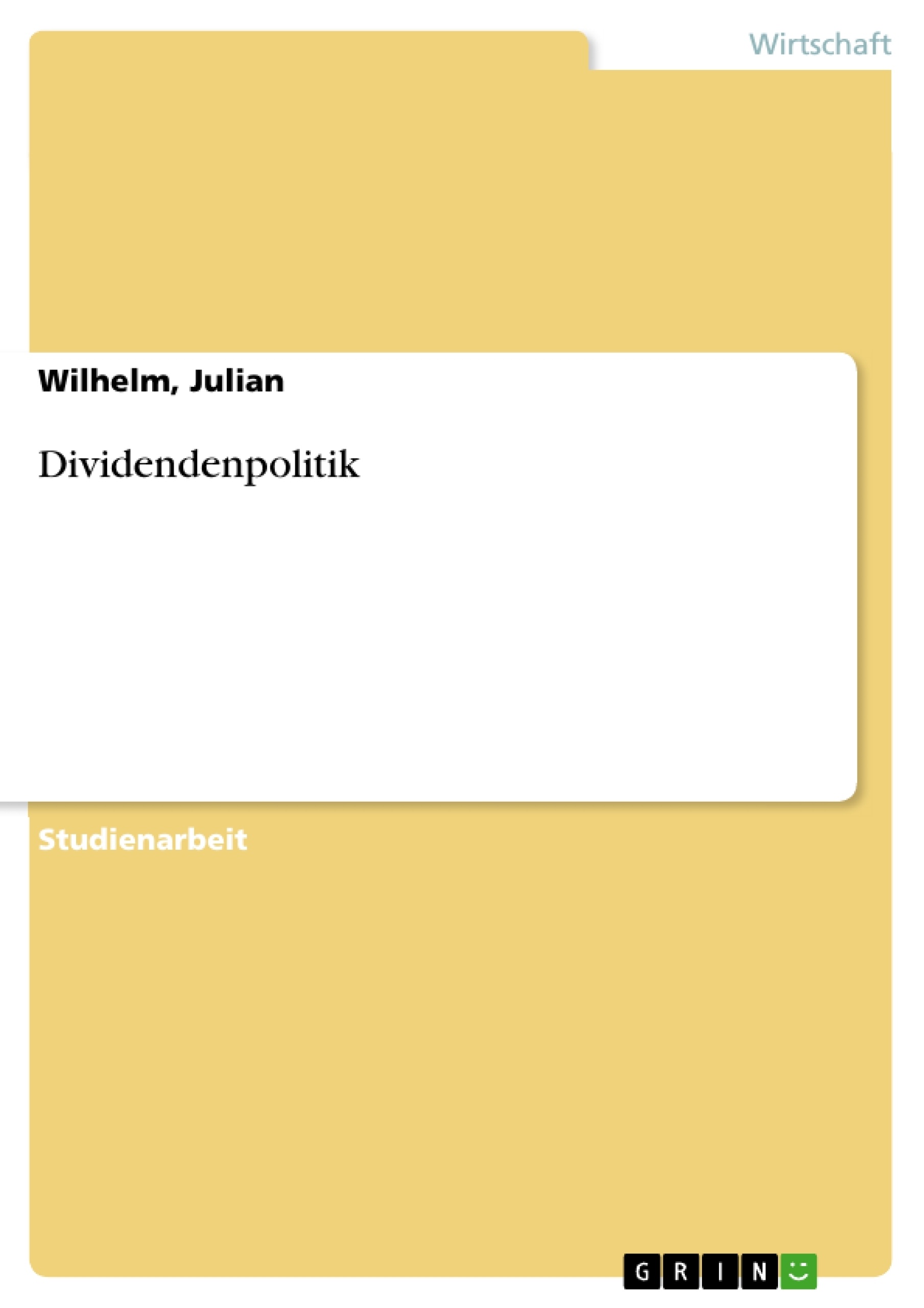Sind Sie bereit, das komplexe Universum der Dividendenpolitik zu entschlüsseln und die Strategien zu meistern, die über den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens entscheiden können? Dieses Buch führt Sie auf eine faszinierende Reise durch die Welt der Gewinnausschüttungen, von den grundlegenden Begriffen bis hin zu den raffinierten Strategien, die von Top-Managern angewendet werden. Tauchen Sie ein in die verschiedenen Formen der Gewinnausschüttung, von der traditionellen Bardividende bis hin zu innovativen Modellen wie Aktionärsoptionen und Cash-oder-Titel-Optionen (COTO), und verstehen Sie die feinen Unterschiede, die den entscheidenden Wettbewerbsvorteil bringen können. Erfahren Sie, wie rechtliche Rahmenbedingungen, insbesondere das Schweizer Obligationenrecht, die Dividendenpolitik beeinflussen und welche kreativen Spielräume Unternehmen bei der Gestaltung ihrer Ausschüttungspolitik haben. Entdecken Sie die Kontroverse um die Dividendenpolitik und die unterschiedlichen Standpunkte, ob Dividendenzahlungen den Unternehmenswert steigern, senken oder unberührt lassen. Analysieren Sie dividendenpolitische Strategien, von der optimalen Pay-Out-Ratio bis zur Dividendenstabilität und -flexibilität, und lernen Sie, die ideale Strategie für Ihr Unternehmen zu entwickeln. Abschliessend widmen wir uns der Selbstfinanzierung, einer essenziellen Strategie zur Kapitalbeschaffung durch Gewinnverzicht, und beleuchten die Gründe und Formen dieser wirkungsvollen Methode. Dieses Buch ist Ihr unverzichtbarer Leitfaden für eine fundierte Dividendenpolitik, die Aktionäre zufriedenstellt, die Liquidität sichert und den langfristigen Unternehmenserfolg fördert. Es bietet wertvolle Einblicke für Finanzexperten, Investoren und alle, die die zentrale Rolle der Dividendenpolitik in der Unternehmensführung verstehen wollen. Lassen Sie sich diese einzigartige Gelegenheit nicht entgehen, Ihr Wissen zu erweitern und Ihre strategischen Entscheidungen auf eine solide Basis zu stellen. Werden Sie zum Experten für Dividendenpolitik und sichern Sie sich Ihren Wettbewerbsvorteil!
Dividendenpolitik
Einleitung
Die Dividendenpolitik ist heute ein zentraler Bestandteil der Unternehmungspolitik, mit der sich die Geschäftsleitung zu befassen hat. Vorbei sind die Jahre, als der Aktionär noch als dumm und frech gegolten hatte, weil er erstens sein Geld in fremde Hände gab und zweitens auch noch eine Dividende verlangte. In der heutigen Zeit muss sich das Management im Zusammenhang mit der Gewinnausschüttung intensiv mit den verschiedensten Fragen auseinandersetzen, um die unterschiedlichen Aktionärsgruppen zufriedenzustellen. Ziel der vorliegenden Semesterarbeit ist es, diese Fragen zu erörtern. Wir befassen uns dabei mit Ansätzen zur Lösung dieser Probleme, wie sie in der Literatur vorgestellt werden.
Der Aufbau der Arbeit sieht folgendermassen aus: Nach der Grundlegung, wo der Begriff und die Bedeutung der Dividendenpolitik erläutert werden, stehen im zweiten Kapitel die verschiedenen möglichen Formen der Gewinnausschüttung im Mittel- punkt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den für die Schweiz wichtigsten rechtlichen Schranken, welche die Geschäftsleitung bei ihren Entscheidungen hinsichtlich der Dividendenpolitik unbedingt zu beachten hat. Da sich das Gesagte in dieser Arbeit auf Gesellschaften des privaten Rechts bezieht, bildet das Obligationenrecht den für diesen Abschnitt relevanten Gesetzestext.
Die Frage, ob Dividendenzahlungen das Aktionärsvermögen verringern, vergrössern oder nicht tangieren, steht im anschliessenden vierten Kapitel im Vordergrund. Man spricht dabei von der Kontroverse der Dividendenpolitik.
Welche dividendenpolitische Strategie für eine Unternehmung optimal ist, bildet den Gegenstand des fünften Kapitels. Bei dieser Strategiefestlegung muss das Management der Unternehmung zwei grundsätzliche Entscheidungen fällen. Die Ausschüttungsrate als Verhältnis des ausbezahlten Gewinnes zum Gesamtertrag und die zeitliche Verteilung der Ausschüttungen über mehrere Geschäftsjahre hinweg müssen bestimmt werden.
Im sechsten und letzten Kapitel schliesslich wollen wir unser Augenmerk noch auf die Selbstfinanzierung richten, worunter man die Kapitalbeschaffung durch Verzicht auf Gewinnausschüttung versteht.
Wir sind uns durchaus bewusst, dass es noch weitere Fragestellungen im Zusam- menhang mit der Dividendenpolitik einer Unternehmung gibt, die zu behandeln eben- falls interessant wären. Da es aber im Umfang einer Semesterarbeit nicht gelingt, auf alle Aspekte eines Themas einzutreten, haben wir uns auf die, unserer Meinung nach, wichtigsten Punkte im Zusammenhang mit der Dividendenpolitik einer Unternehmung konzentriert.
© by Clemens Hochreuter + Julien Wilhelm Herbst/Winter 1998
Semesterarbeit: Dvidendenpolitik
1. Grundlegung der Dividendenpolitik
1.1 Begriff der Dividendenpolitik
Für die erwirtschafteten Gewinne einer Aktiengesellschaft gibt es grundsätzlich zwei Verwendungsmöglichkeiten: Entweder sie werden im eigenen Unternehmen für Selbstfinanzierungszwecke1 zurückbehalten, oder sie werden als Entschädigung für die Überlassung von Risikokapital an die Aktionäre ausgeschüttet.2 In der modernen Aktiengesellschaft ist die Festlegung der Dividende, welche an die Aktionäre ausge- schüttet werden soll, zu einer bewussten Massnahme der Unternehmungspolitik ge- worden. Man spricht daher von der Dividendenpolitik, welche häufig mit weiteren Finanzierungs-und Investitionsentscheidungen verflochten ist. Die Dividendenpolitik hat die Aufgabe, unter Berücksichtigung situationsspezifischer Determinanten, sowohl die Höhe und die Form der Ausschüttung als auch die zeitliche Verteilung bzw. die Kontinuität des als Dividenden auszuschüttenden Gewinnanteiles festzuset- zen. Die verteilten Mittel stammen dabei aus dem Jahresgewinn des Rechnungs- jahres, aber auch aus Gewinnvorträgen früherer Jahre, welche den offenen Reser- ven gutgeschrieben worden sind oder allenfalls auch in Form stiller Reserven zurück- gestellt worden sind.3
Des weiteren ist nicht zu vergessen, dass die Dividendenpolitik ebenfalls Ankündigungsentscheide umfasst, welche auch einen bedeutenden Einfluss auf die Aktienkursbildung einer Unternehmung haben können.
1.2 Bedeutung der Dividendenpolitik
Über die Bedeutung der Dividendenpolitik finden sich in der Literatur verschiedene Auffassungen. Während Weber4 das Thema Dividendenpolitik als das ‘Königsprob- lem’ der AG bezeichnete, da ihm sowohl seitens der Anleger als auch der Geschäfts- leitungen seit jeher viel Beachtung zugekommen ist, weisen beispielsweise Brea- ley/Myers5 darauf hin, dass es wichtig sei, die Dividendenpolitik von den übrigen Finanzentscheiden zu isolieren. Häufig ergäben sich die Dividendenzahlungen ein- fach als Nebenprodukte der zuvor vorgenommenen Investitions-und Finanzierungs- entscheide.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist die Bedeutung der Dividendenpolitik klar. Die Dividendenzahlung stellt wie jede Gewinnausschüttung eine Verringerung der flüssi- gen Mittel dar, sofern, was in der Schweiz die Regel ist, die Ausschüttung in Form ei- ner Bardividende geschieht. Je mehr aber eine Gesellschaft von ihren Gewinnen auszahlt, desto geringer sind die für weitere Investitionen zur Verfügung stehenden selbsterarbeiteten Mittel. Eine umsichtige Finanzpolitik muss folglich darauf achten, dass durch die Dividendenzahlungen die Liquidität der Gesellschaft nicht übermässig verschlechtert wird.
Sowohl in der breiten Öffentlichkeit als auch bei den Investoren werden die Dividenden häufig als Massstab für die Ertragslage und als Hinweis auf die zukünf- tige Entwicklung einer Unternehmung betrachtet. Auf diese sehr interessante Tatsa- che, dass somit die Dividendenpolitik einen unmittelbaren Einfluss auf das Verhalten der Anleger hat, wird später noch näher eingegangen. Dennoch ist es betriebswirt- schaftlich äusserst fragwürdig, Gewinnausschüttungen vorzunehmen, welche nur mittels Aufnahme von Fremdkapital oder durch Auflösung von stillen oder offenen Reserven finanziert werden können.
Nachdem die Generalversammlung einer Aktiengesellschaft den Beschluss über die Dividendenverteilung gefällt hat, verwandeln sich Teile des erarbeiteten Eigenkapitals in Fremdkapital. Diese Schuld der Unternehmung gegenüber ihren Aktionären wird sofort fällig. In welchen Formen diese beschlossene Ausschüttung erfolgen kann, ist Gegenstand des nächsten Kapitels.
2. Formen der Gewinnausschüttung
Die Ausschüttung kann grundsätzlich entweder offen in Form einer Bar-, Stock Natu- raldividende, etc. oder verdeckt in Form von übersetzten Salären und Honoraren, Kauf- und Tauschgeschäften oder Darlehen und ähnlichen Geschäften erfolgen. Eine verdeckte Gewinnausschüttung ist eine geldwerte Leistung, die eine Unternehmung ihren Aktionären ohne entsprechende Gegenleistung zukommen lässt, jedoch unbe- teiligten Dritten unter gleichen Umständen nicht erbringen würde. In der Schweiz werden die Gewinnanteile jährlich an die Aktionäre ausgeschüttet, wohingegen in den USA die vierteljährliche Verteilung die Regel ist. Auch Unternehmungen, die mo- natliche oder halbjährliche Ausschüttungen vornehmen, sind dort bekannt. Die üb- lichsten offenen Formen der Gewinnausschüttungen werden nachfolgend dargelegt.
2.1 Bardividende
Die Bardividende ist in der Schweiz die weitaus gebräuchlichste Form der Gewinn- verwendung. Über 99% der offenen Gewinnausschüttungen kotierter schweizeri- scher Aktiengesellschaften erfolgen mittels Bardividende.6 Die vom Verwaltungsrat der Gesellschaft beantragte Dividende ist, wie schon erwähnt, unmittelbar nach Ab- schluss der Generalversammlung fällig, sofern diese nichts anderes entscheidet. Zwar ist de jure nach Obligationenrecht (Art. 698 OR) die Generalversammlung für die Beschlussfassung über die Festsetzung der Dividende zuständig und des öfteren wird der Antrag vom Verwaltungsrat an der Generalversammlung von einzelnen Ak- tionären tatsächlich auch kritisiert und eine andere, meist höhere, Dividende vorge- schlagen. Trotzdem folgt die Generalversammlung am Ende bei der Abstimmung über die Dividende praktisch immer dem Vorschlag des Verwaltungsrates. Es kommt aber vereinzelt vor, dass der Verwaltungsrat selber seinen Dividendenantrag vor der Generalversammlung revidiert.7 Als Alternative zur Barausschüttung kann der Ge- winn, der den Investoren zusteht, auch dadurch abgegolten werden, dass eine Sach- wertdividende ausgeschüttet wird. Hierbei kommen Stock- und Naturaldividenden in Betracht.
2.2 Stockdividende
Stockdividenden, auch Wertpapierdividenden oder Gratisaktien genannt, sind Aktien oder Partizipationsscheine, welche im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln durch Umwandlung von frei verfügbaren Reserven in Aktien- oder Partizipationskapital geschaffen und an die bisherigen Aktionäre im Verhältnis zum bisherigen Aktienbesitz verteilt werden.8 Dabei spricht man von periodischen Stockdividenden, wenn die Wertpapiere aufgrund der laufenden Gewinne gewährt werden. Ausserordentliche oder aperiodische Stockdividenden stammen dagegen aus Rücklagen, die sich über mehrere Jahre hinweg angesammelt haben.9
Mit der Ausgabe solcher Gratisaktien erhalten die Investoren einen Reingewinnanteil, den sie bei Bedarf an der Börse liquidieren können, ohne dabei die flüssigen Mittel der Gesellschaft zu beanspruchen.
Diese Form der Gewinnausschüttung ist vor allem in den USA bekannt und kommt in der Schweiz nur selten zur Anwendung, da der Nennwert der ausgegebenen Gratis- aktien der Einkommenssteuer unterliegt. Erfahrungsgemäss wird deshalb eine Kapi- talerhöhung zu pari mit entsprechenden Bezugsrechte n für die bisherigen Aktionäre vorgezogen.
Eine besondere Form der Wertpapierdividende ist die Portefeuilleausschüttung. Dabei werden Wertpapiere einer anderen Gesellschaft, welche sich im Besitz der Unternehmung befinden, verteilt.
2.3 Naturaldividende
Unter einer Naturaldividende wird eine Gewinnausschüttung in Form von Produkten oder Dienstleistungen der Unternehmung verstanden. Eine praktische Bedeutung hat die Naturaldividende in der Schweiz besonders bei Transportunternehmungen, wel- che ihren Aktionären Transportfreikarten oder Fahrvergünstigungen zukommen lassen. So offerierte etwa die Balair ihren Aktionären bisher alle Jahre einen Urlaubs- flug zu besonders günstigen Konditionen. Die Naturaldividende wäre durchaus auch für Gesellschaften anderer Branchen empfehlenswert. So hat die britische Gesell- schaft Dundee Crematorium ihren Aktionären sogar einmal das Angebot einer ver- günstigten Kremation gemacht. Es muss nicht weitergeführt werden, dass die An- teilseigner auch auf eine andere Ausschüttungsform ihrer Gewinnanteile bestehen konnten...
2.4 Alternativdividenden
Bei einer Alternativdividende wird den Aktionären das Wahlrecht eingeräumt, sich zwschen dem Bezug einer Bar- oder einer Stockdividende zu entscheiden. In den USA ist diese Ausschüttungsform verbreitet, in der Schweiz hat sie infolge steuerlicher Nachteile eine sehr geringe Bedeutung. Die Ausschüttung in dieser Form empfiehlt sich deshalb nur für Gesellschaften, die ihre liquiden Mittel nicht allzu stark beanspruchen wollen, oder für Unternehmungen, welche über grössere Bestände an eigenen Aktien verfügen, die sie im Publikum plazieren möchten.10
2.5 Innovative Ausschüttungsmodelle
Das Dilemma von Publikumsaktiengesellschaften, verschiedenen Gruppen von Ak- tionären mit differierenden Vorzügen bezüglich der Gewinnausschüttung gegenüber- zustehen, hat in der Unternehmenswelt zum Aufkommen innovativer Ausschüttungs- modelle geführt. Nachstehend werden vier solche Modelle vorgestellt, die als Ergänzung oder Alternative zur gebräuchlichsten Form der Bardividende in Frage kommen.
2.5.1 Aktionärsoptionen
Die Ausgabe von unentgeltlichen Optionen an die bisherigen Aktionäre bietet der Unternehmung eine weitere Möglichkeit, den Aktionären eine Bareinnahme zu ver- schaffen, ohne dabei die eigenen flüssigen Mittel zu belasten. Die Aktionärsoptionen beinhalten dabei das Recht, Aktien oder Partizipationsscheine der Unternehmung während einer bestimmten Periode zu einem im voraus festgesetzten Preis, dem Ausübungspreis der Option, zu beziehen. In der Regel werden solche Optionsrechte, deren Laufzeiten üblicherweise zwischen 6 und 9 Monaten liegen, mit der Ausgabe einer Optionsanleihe verbunden.
Weil die an der Börse gehandelten Optionen einen zeitbedingten Marktwert aufweisen, auch wenn der Ausübungspreis zum Ausgabezeitpunkt über dem aktuellen Börsenkurs liegt und die Option damit keinen inneren Wert hat, erhalten die Aktionäre ein verwertbares Vermögensrecht.
Der Aktionär kann je nach Vorzug durch den Verkauf der Option über die Börse ein zusätzliches Bareinkommen realisieren, ohne dass der Unternehmung flüssige Mittel entzogen werden, oder natürlich auch die Aktie beziehen. In der Regel ist der Kurswert der Optionen bescheiden und der Verkauf über die Börse lohnt sich für Kleinanleger, die ein paar wenige Aktien halten, wegen der hohen Börsenspesen kaum. Die Gesellschaft kann deshalb ihren Anteilseignern eine Barabgeltung in der Höhe des mutmasslichen Kurswertes der Option anbieten.11
Anzufügen wäre noch, dass eine Aktionärsoption formal einem Bezugsrecht mit einer ähnlich langen Laufzeit gleichgestellt werden kann.
2.5.2 Cash-oder-Titel-Optionen (COTO)
Die Cash-or-Title-Option, kurz COTO, ist eine von der BZ Bank lancierte Weiterentwicklung des Landis & Gyr-Dividendensystems. Die Landis & Gyr AG hat zwischen 1956 und 1990 eine kleine Bardividende mit einer Kapitalerhöhung verknüpft, bei der die Aktionäre die neuen Aktien zu pari beziehen konnten, was im Endeffekt einer Gewinnausschüttung gleichkam.
Dieses erstmals im Jahre 1990 in der Schweiz von 6 Firmen eingesetzte Finanzinstrument wird als selbständiges Wertpapier für eine bestimmte Zeit an der Börse gehandelt. Durch die COTO erhält der Aktionär drei Wahlmöglichkeiten:
1. Er kann gegen eine bestimmte Anzahl COT-Optionen eine meist zum Nominalwert verkaufte Aktie beziehen. Der Zeitpunkt des Bezugs kann vom Inhaber der COTO wie bei einer Option amerikanischen Stils während der Laufzeit frei gewählt werden und nach dem Bezug bietet sich dem Aktionär die Möglichkeit, den Titel über die Börse weiter zu verkaufen.
2. Er kann direkt die COTO über die Börse weiterverkaufen oder
3. die COTO gegen eine Barentschädigung an die Gesellschaft zurückgeben
Am Ende der Lauffrist der Option, die zwischen 6 und 8 Monaten liegt, bleiben dem Letztbesitzer der Option nur noch zwei Wahlmöglichkeiten. Er kann die Barentschädigung von der Gesellschaft fordern oder die Aktie beziehen.
Aufgrund eines Gutachtens des Bundesamtes für Justiz betrachtet die Eidgenössische Steuerverwaltung die COTO im Umfang der Barabgeltung jedoch als steuerpflichtiges Einkommen. Daher sind COT-Optionen für die Aktionäre uninteressant und werden wohl in der beschriebenen Form ohne Bedeutung bleiben.12
2.5.3 Teilrückzahlung des Eigenkapitals durch Nennwertreduktion
Weil das COTO-Modell aus Sicht der Aktionäre und der Unternehmung steuerlich nicht mehr attraktiv war, hat die Ems Chemie Holding, für welche die BZ Bank 1990 das COTO-Modell erstmals entwarf, im Jahre 1992 beschlossen, die Bardividende durch eine Herabsetzung des Aktienkapitals mit gleichzeitiger Rückzahlung von 40% der Aktiennennwerte vorzunehmen. Attraktiv an dieser Form der Gewinnausschüt- tung ist, dass Rückzahlungen des einbezahlten Eigenkapitals nicht als steuerpflichti- ger Vermögensertrag gelten und deshalb auch keine Verrechnungssteuer zu entrich- ten ist. Die legale Steuereinsparung fällt im Vergleich zu einer Dividendenauszahlung im gleichen Umfang besonders für Grossaktionäre ins Gewicht.13
Bei dieser Art der Gewinnausschüttung ist zu beachten, dass die Vorschriften des Obligationenrechtsüber die Kapitalherabsetzung (Art. 732-734 OR) und dabei insbe- sondere die Vorlage eines besonderen Revisionsberichtes (Art. 732 Abs. 2 OR) und des Schuldenrufes an die Gläubiger (Art. 733 OR) zur Anwendung gelangen.14 Überdies müssen auch hier die grundsätzlichen Bestimmungen zum Aktienkapital eingehalten werden.
2.5.4 Rückkauf eigener Aktien
Die letzte Form der Gewinnausschüttung, die in diesem zweiten Kapitel behandelt wird, betrifft den Rückkauf eigener Aktien. Finanzwirtschaftlich handelt es sich hier nämlich um eine Ausschüttung von Mitteln, die sich von einer Bardividende nur dadurch unterscheidet, dass diese nur an gewisse Aktionäre, nämlich an jene, die ihre Aktien verkaufen wollen, vorgenommen wird.15
Auch bei dieser Form beschränkt eine rechtliche Restriktion (Art. 659 OR) den Handlungsspielraum einer Aktiengesellschaft. Der Rückkauf eigener Aktien kommt als dividendenpolitische Massnahme für Publikumsgesellschaften nur in Betracht, solange der gesamte Nennwert dieser Aktien 10 Prozent des Aktienkapitals nicht übersteigt.
3. Rechtliche Aspekte der Dividendenpolitik
In diesem dritten Kapitel geht es nicht darum, die rechtlichen Überlegungen, die sich schon weiter vorne zu den einzelnen Formen der Gewinnausschüttungen aufgedrängt haben, zu wiederholen. Dieses Kapitel soll nur noch diesen Aspekten Platz bieten, die aus rechtlicher Sicht eine zentrale Bedeutung für die Dividendenpolitik in der Schweiz haben oder die bis jetzt noch nicht angesprochen wurden.
Aufgrund seiner Einlage bzw. Einlageverpflichtung wird der Aktionär nach Art. 661 OR am Vermögen der Gesellschaft anteilsmässig beteiligt. Aus dieser Beteiligung ergeben sich für den Aktionär verschiedene Rechte, wobei bei den vermögensmässigen Rechten das Recht auf Dividende im Vordergrund steht.
Nach Art. 660 Abs. I OR hat jeder Aktionär Anspruch auf einen verhältnismässigen Anteil am Bilanzgewinn. Der Anteilseigner kann dabei über die ausgeschütteten Mittel frei verfügen, während die in der Unternehmung zurückbehaltenen Gewinne für ihn nicht zugänglich sind.
Da eine Dividende nach Art. 675 Abs. 2 OR nur ausgeschüttet werden darf, wenn Gewinne erzielt worden sind, muss zuerst abgeklärt werden, was unter dem in Art. 660 OR genannten ‘Bilanzgewinn’ verstanden wird. Dieser setzt sich aus zwei Kom- ponenten zusammen, nämlich dem Jahresgewinn des vergangenen Jahres und dem aus früheren Jahren auf neue Rechnung vorgetragenen Gewinnvortrag. Abzuziehen wären ein allenfalls angefallener Jahresverlust oder ein Verlustvortrag. Daraus folgt, dass kein Bilanzgewinn ausgewiesen und damit auch keine Dividende ausgeschüttet werden darf, wenn zwar im vergangenen Geschäftsjahr ein Reingewinn erzielt wurde, dieser aber den Verlustvortrag aus früheren Jahren nicht übersteigt.
Art. 675 Abs. 2 des Obligationenrechts präzisiert im weiteren Verlauf, dass Dividenden nicht nur aus dem Bilanzgewinn, sondern auch aus hierfür gebildeten Reserven ausgerichtet werden können. Das Gesetz lässt nach Art. 674 Abs. 2 Ziff. 2 die Bildung von Reserven (sogenannte Dividendenreserve) und in Art. 669 Abs. 3 OR sogar die Bildung stiller Reserven zu, wenn sich dies mit Rücksicht auf die Ausrichtung einer möglichst gleichmässigen Dividende rechtfertigt.
Den Entscheid über die Höhe der Dividende fällt nach Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR die Generalversammlung, obwohl dieses Recht des oberste n Organs der Aktiengesell- schaft nicht zu hoch bewertet werden darf. In den allermeisten Fällen nämlich folgen die Aktionäre dem Vorschlag des Verwaltungsrates, wie wir dies schon in Kapitel 2.1 gesehen haben.
Zur Wahl der Form der Gewinnausschüttung lässt das Gesetz der Unternehmung weitgehend freie Hand. Normalerweise wird der Gewinn in Form der Bardividende ausgeschüttet. Aber auch Sachdividenden stellen problemlose Möglichkeiten der Gewinnausschüttung dar.
Die Ausschüttung der Dividende erfolgt bei Inhaberaktien gegen Einreichung des durch den Generalversammlungsbeschluss als zahlbar erklärten Coupons, der nach Art. 981 OR als Inhaberpapier zu betrachten ist, und entweder direkt bei der Gesellschaft oder bei den als Zahlstelle beauftragten Banken einzulösen ist und gem. Art. 128 OR nach Ablauf von 5 Jahren verjährt.16
4. Die Kontroverse um die Dividendenpolitik
Es geht in der ganzen Thematik um die Kontroverse der Dividendenpolitik grundsätz- lich um die Frage, welche Auswirkungen Dividendenzahlungen auf den Wert einer Unternehmung haben. Die verschiedenen Antworten lassen sich dabei in drei mögli- che Kategorien einteilen. Die Dividendenzahlungen können den Wert der Unternehmung resp. das Aktionärsvermögen erhöhen, nicht tangieren oder aber sen- ken. Damit ist ein Einteilungsschema gegeben, nach dem die Vertreter der verschie- denen Theorieansätze leicht eingeordnet werden können. Die Abbildung 1 stellt die- ses Einteilungsschema dar.
Abb.1: Die Standpunkte in der Kontroverse um die Dividendenpolitik
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Darstellung
Die Befürworter einer grosszügigen Dividendenausschüttungspolitik, im Englischen ‘Rightists’ genannt, postulieren selbstverständlich einen positiven Zusammenhang zwischen Dividendenerhöhungen und dem Wert der Unternehmung. Im Gegensatz dazu glauben die Vertreter einer möglichst geringen Ausschüttungspolitik, die ‘Lef- tists’, dass eine Erhöhung der Dividendenauszahlung das Aktionärsvermögen ver- mindert. Zwischen diesen beiden Meinungen stehen dann jene Theorieansätze, wel- che jeglichen Zusammenhang zwischen der Dividendenausschüttung und dem Wert der Unternehmung verneinen. Ausgangspunkt dieser zuletzt erwähnten Theoriean- sätze ist eine 1961 erschienene Arbeit von Miller und Modigliani.17 Kernaussage dieser letztgenannten These ist, dass eine Dividendenänderung immer exakt durch entge-gengesetzte Kursänderungen ausgeglichen werden, und somit keinen Einfluss auf den Gesamtwert einer Unternehmung hat. Diese Aussage wird heute allgemein als richtig akzeptiert.
5. Dividendenpolitische Strategien
Die Verantwortlichen einer Aktiengesellschaft stehen bei der Festlegung der dividen- denpolitischen Strategie vor zwei Entscheidungen. Erstens müssen sie die Höhe und zweitens die Konstanz bzw. die zeitliche Verteilung des auszuschüttenden Anteils am erzielten Unternehmensgewinn festlegen. Bei der ersten Entscheidung, die in Ab- schnitt 5.1 behandelt wird, geht es um die Frage, ob es eine für die Unternehmung optimale Pay-Out-Ratio gibt. Die zweite Entscheidung, die Gegenstand des Ab- schnittes 5.2 ist, befasst sich mit der Kontinuität der auszuschüttenden Gewinn- anteile über mehrere Geschäftsjahre hinweg. Dabei muss sich die Unternehmens- leitung grundsätzlich entweder auf eine Strategie der Dividendenstabilität oder auf eine solche der Dividendenflexibilität festlegen, wobei in der Praxis auch Mischformen dieser zwei Ausschüttungsstrategien gewählt werden können.
5.1 Die optimale Pay-Out-Ratio
Hinsichtlich der Höhe des auszuschüttenden Dividendenbetrages im Verhältnis zum Unternehmensgewinn ist zu fragen, ob für eine bestimmte Unternehmung eine Stra- tegie mit einer hohe n oder tiefen Pay-Out-Ratio optimal ist. Die verschiedensten Aspekte wirken sich auf diese Strategie aus. So wird die Ausschüttungsrate bei- spielsweise von der Steuersituation und den Einkommenspräferenzen der Investo- ren, aber auch vom Selbstfinanzierungsbedarf des Unternehmens beeinflusst.
Dennoch versuchte Gutenberg18 ein Modell zur optimalen Pay-Out-Ratio einer Ak- tiengesellschaft aufzustellen, das ohne all die erwähnten Faktoren, welche die Aus- schüttungsrate bestimmen, auskommt. Dieses Modell wird nachfolgend kurz vorge- stellt. Nach Gutenberg variiert der Eigenkapitalkostensatz einer Gesellschaft resp. die von den Aktionären geforderte Rendite in Abhängigkeit von der Gewinnaus- schüttungsquote der Unternehmung. Nach Abbildung 2 ist er dort am tiefsten, wo das Verhältnis von einbehaltenem und ausgeschüttetem Gewinn optimal ist.
Abb. 2: Abhängigkeit des Eigenkapitalkostensatzes von der Ausschüttungsrate
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: In Anlehnung an Gutenberg 1980, S. 258
Gutenberg nimmt in seinem Modell an, dass die von den Investoren auf ihre Aktien geforderte Rendite und damit auch der Eigenkapitalkostensatz der Gesellschaft bei Ausschüttungsraten im Bereich von 0 oder 100 Prozent vergleichsweise hoch aus- fällt. Eine vollständige Thesaurierung des Gewinnes (Punkt A) läuft auf alle Fälle den Dividendenpräferenzen eines grossen Teils der Aktionäre zuwider. Andererseits ist bei einer vollständigen Gewinnausschüttung (Punkt C) damit zu rechnen, dass die In- vestoren die Sicherung der Existe nz und die Zukunftschancen der Unternehmung für gefährdet halten und daher den Risikograd ihrer Aktien höher einstufen.
Das Minimum der geforderten Rendite liegt bei jener Gewinnverwendung, bei der die Mehrheit der Anteilseigner eine optimale Pay-Out-Ratio als gegeben ansieht (Punkt
B). In diesem Punkt B dürfte folglich der Wert der Unternehmung und damit auch der Shareholder Value am höchsten sein.
Man muss aber deutlich betonen, dass Gutenbergs Modell lediglich auf einen eher unscharfen, nicht quantifizierbaren Ausschüttungsbereich verweist, der von der Mehrheit der Investoren als wünschenswert angesehen werden dürfte.19 Für die Ge- schäftsleitung dürfte dieser Ansatz folglich als Entscheidungshilfe wenig geeignet sein, lässt sich doch konkret eine optimale Gewinnverwendung nicht näher bestim- men. Das Management muss sich ergo dennoch mit den weiteren Bestimmungs- faktoren ihrer Pay-Out-Ratio wie Selbstfinanzierungsbedarf, Steuersituation der Aktionäre, etc. auseinandersetzen, um engere Grenzen für die zu wählende Aus- schüttungsrate zu erhalten.
Hochrentable Unternehmen sollten einen grösseren Teil ihres Gewinnes einbehalten und reinvestieren. Die damit selbsterarbeiteten zukünftigen Ertragschancen dürften den Shareholder Value eher steigern als eine Dividendenausschüttung, die zudem noch steuerliche Nachteile hat. Dagegen ist eine relativ hohe Pay-Out-Ratio dann angezeigt, wenn die Unternehmung keine hinreichenden Renditen für ihre geplanten Geschäftsaktivitäten und Investitionsprojekte erwartet.20
5.2 Strategie der Dividendenstabilität
Die Politik der Dividendenstabilisierung zielt darauf ab, den Ausschüttungsbetrag pro Aktie über eine möglichst lange Zeitspanne hinweg unverändert zu lassen. Die Divi- dendenausschüttung wird damit von der gegenwärtigen Ertragslage der Unterneh- mung losgelöst und orientiert sich ausschliesslich an der vorhersehbaren langfristi- gen Ertragsentwicklung. Das Ausschüttungsniveau wird erst dann der neuen Lage angepasst, wenn sich ein besserer oder schlechterer Gewinntrend abzeichnet.
Zur Begründung der Strategie der Dividendenstabilität wird angeführt, dass eine konstante Dividendenzahlung spekulativen Börsentransaktionen entgegenwirkt. Ausserdem sei den Interessen der Investoren, die ihre Aktien als Anlagepapiere erworben haben, mit einer stabilen Dividende am besten gedient.
Obwohl die Dividendenstabilität bis in die neueste Zeit ein wesentliches Merkmal der Finanzpolitik schweizerischer Unternehmungen gewesen ist und auch dem neuen Aktienrecht noch immer zugrunde liegt21, hat sie dennoch einen negativen Beigeschmack. “Man kann sich allerdings aufgrund verschiedener Beobachtungen in den letzten Jahren des Eindruckes nicht erwehren, dass die Dividendenstabilisierung vorwiegend nach oben spielt, indem mögliche Dividendenerhöhungen unterbleiben oder nur in bescheidenem Umfang beschlossen werden, während Dividendenkürzungen oft überraschend schnell und recht massiv erfolgen.”22
Ferner büsst die konkrete Dividendenzahlung ihre Signalfunktion an die Anleger durch die Dividendenstabilität ein. Der Investor erhält keine Hinweise darauf, welchen künftigen Geschäftsgang das Management erwartet.
Besonders die Banken waren lange Zeit Anhänger von stabilen Dividenden. So darf sich beispielsweise die Schweizerische Kreditanstalt loben, von 1895 bis 1933 immer eine 8%-Dividende ausgerichtet zu haben.23
5.3 Strategie der Dividendenflexibilität
In den letzten Jahren liess sich eine Trendwende von der Dividendenstabilisierung in Richtung Dividendenflexibilität feststellen. Im Gegensatz zur Dividendenstabilität möchte die Strategie der Dividendenflexibilität nicht den Ausschüttungsbetrag pro Aktie, sondern die Pay-Out-Ratio konstant halten. Die Geschäftsleitung bekennt sich zum Grundsatz, dass die Aktie ein Risikopapier mit veränderlichem Ertrag darstellt und reserviert den Investoren einen gleichbleibenden Anteil an den jeweils erzielten Jahresgewinnen als Dividende. Da sich bei einer derartigen gewinnorientierten Dividendengestaltung wechselseitige Geschäftsergebnisse unmittelbar auf die Ge- winnausschüttung auswirken, unterliegt eine flexible Dividende in der Regel starken Schwankungen. Aber auch bei einer flexiblen Dividendenpolitik muss sich nicht jede Ertragsschwankung sogleich in der Dividende auswirken. Vorübergehende Gewinn- minderungen werden durch Kürzung der zurückbehaltenen Gewinne aufgefangen, während eine Dividendenerhöhnung erst bei einer nachhaltigen Verbesserung der Ertragslage vorgenommen wird.
Auf die Titel mit stark schwankenden Ausschüttungen werden häufiger Spekulationskäufe getätigt, was sich auch in den Aktienkursen niederschlägt.
5.4 Strategie der relativen Dividendenkontinuität
Heute ist in der Praxis die relative Dividendenkontinuität, welche eine Mischform zwischen den beiden soeben besprochenen Grundprinzipien darstellt, weit verbreitet. Bei dieser werden allzu häufige Anpassungen der Dividende an kurzfristige Gewinnschwankungen vermieden. Die Ausschüttungen richten sich vielmehr nach den längerfristigen Gewinnerwartungen.
Solange nicht feststeht, ob sich ein gestiegener Gewinn auch nachhaltig erzielen lässt, wird die Dividende unverändert bleiben. Trotzdem wird eine weitere Aus- schüttung vorgenommen, die z.B. als Bonus deklariert wird. Diese Zusatzdividende kann später, wenn sich die positiven Gewinnerwartungen bestätigen sollten, in einen festen Bestandteil der Ausschüttung verwandelt werden und damit in einem erhöhten Dividendensatz aufgehen.24 Falls sich die Gewinnsituation nicht ansprechend ent- wickelt, kann im Folgejahr wieder auf den Bonus verzichtet werden. Dieses Vorgehen beeinträchtigt das Ansehen der Unternehmung wohl weniger als eine Senkung des Dividendensatzes. Aber auch für Gesellschaften, bei denen die Gewinne stark schwanken oder ein Geschäftsjahr ungewöhnlich hohe Erträge her- vorbringt, stellt der Bonus ein geeignetes Mittel dar, die Investoren am aktuellen Ge- winn teilhaben zu lassen.
5.5 Zusammenfassung zur Frage der Dividendenkontinuität
Für die Ableitung einer geeigneten Dividendenpolitik hinsichtlich der Kontinuität der Gewinnausschüttungen sind beispielsweise die auf der nächsten Seite in der nach- folgenden Abbildung 3 aufgeführten Entscheidungskriterien heranzuziehen, die sich je nach der spezifischen Unternehmenssituation verschieden auswirken. Die sich daraus ergebenden Strategien können von Dividendenstabilität über Kontinuität in der Steigerung und bedingter Flexibilität bis hin zur gewinnabhängigen Dividendenausschüttung reichen. In der Abbildung 3 wurden aber nur diese drei Formen aufgeführt, welche in den vorherigen Abschnitten Gegenstand der Diskussion waren.
Abb. 3: Mögl. Entscheidungskriterien bezügl. stabiler v. flexibler Dividendenstrategie
Quelle: In Anlehnung an Drill 1995, S.190
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bisher haben wir uns nur mit verschiedenen Arten der Gewinnausschüttung befasst. Es gibt aber auch Unternehmen, welche ganz oder teilweise auf Gewinnausschüttung verzichten und sich dadurch Kapital beschaffen. Man spricht dabei von der Selbstfinanzierung. Was unter diesem Begriff zu verstehen ist, welche Gründe ein Unternehmen dazu führen, Kapital mittels Selbstfinanzierung zu beschaffen, und welche Formen man dabei unterscheidet - all dies sei Gegenstand des nächsten und letzten Kapitels dieser Semesterarbeit.
Da sich diese jedoch primär mit der Dividendenpolitik befasst, werden wir das Thema der Selbstfinanzierung möglichst kurz und prägnant behandeln.
Wir sind uns darüber im Klaren, dass zum Thema der Selbstfinanzierung wesentlich mehr gesagt werden könnte. Wir möchten uns jedoch nur auf die wichtigsten Fakten und Informationen beschränken und auch ausdrücklich auf die Fussnoten verweisen.
6. Die Selbstfinanzierung
6.1 Begriff der Selbstfinanzierung
Unter Selbstfinanzierung versteht man die Kapitalbeschaffung durch Verzicht auf Ge- winnausschüttung. Volkswirtschaftlich bezeichnet man diese Form der Kapitalbildung auch als Unternehmungssparen. Der Anteil des zurückbehaltenen Gewinns wird dabei im Gegensatz zum Pay-Out-Ratio oftmals als Plow-Back-Ratio bezeichnet. Die Selbstfinanzierung ist eine Form der Innenfinanzierung und setzt einen realisierten Gewinn voraus, da nur dann der Unternehmung Mittel für Erweiterungsinvestitionen zur Verfügung stehen.25
Den Anteil der thesaurierten Gewinne am gesamten Investitionsvolumen bezeichnet man als Selbstfinanzierungsquote. Die Selbstfinanzierung verändert sowohl Aktiv-, als auch Passivseite der Bilanz. Im Fall von verdeckter Selbstfinanzierung erscheint das neugebildete Eigenkapital jedoch nicht in der Bilanz.
6.2 Gründe für die Selbstfinanzierung
Das erarbeitete Eigenkapital stellt für jedes Unternehmen die ideale Kapitalart dar. Deshalb ist einer ausreichenden Selbstfinanzierung möglichst grosse Beachtung zu schenken, vorallem aus vier Gründen, welche im Folgenden kurz erläutert werden sollen.
1. Heutzutage ist es für eine Unternehmung überlebenswichtig, durch ständig neue Investitionen und Entwicklung mit dem Fortschritt gleichzuziehen. Damit sich eine Unternehmung aber auch entwickeln kann, muss das erforderliche Kapital bereit- stehen. ‘Eine Unternehmung kann nur in dem Umfang am wirtschaftlichen Wachstum teilnehmen, als sie imstande ist, dieses zu finanzieren‘.26 Je schwä- cher das Wirtschaftswachstum und je instabiler der Markt, desto wichtiger ist es, dass eine Unternehmung genügend erarbeitetes Kapital besitzt, um so das Risiko etwas zu verringern.
2. Wenn in einer Unternehmung der Erweiterungskapitalbedarf die Möglichkeiten der Selbstfinanzierung über eine längere Zeitspanne hinweg übersteigt, entsteht eine Finanzierungslücke. Grundsätzlich wird diese durch zusätzliche Kapitaelein- zahlungen der Gesellschafter oder durch Fremdfinanzierung gedeckt. Sowohl eine Erhöhung des einbezahlten Eigenkapitals, wie auch Aufnahme von Fremd- kapital ist jedoch nicht immer ohne weiteres möglich und birgt nicht zu unter- schätzende Risiken.27
3. ‘Das erarbeitete Eigenkapital verursacht keine festen periodischen Zinszahlungen und Tilgungsverpflichtungen und damit keine fixen Auszahlungen, welche unab- hängig von Rentabilität und Liquiditätslage der Unternehmung geleistet werden müssen.’28
4. Die Selbstfinanzierung sowie die Bildung von stillen Reserven bringen dem Unter- nehmen auch steuerliche Vorteile.29
3.3 Formen der Selbstfinanzierung
Man unterscheidet grundsätzlich zwei Formen der Selbstfinanzierung: Die offene Selbstfinanzierung und die verdeckte Selbstfinanzierung.
3.3.1 Die offene Selbstfinanzierung
Die offene Selbstfinanzierung erkennt man daran, dass sie aus der Bilanz ersichtlich ist. Die nicht ausgeschütteten Gewinne werden besonderen Resevekonten gutgeschrieben oder als Gewinnvortrag in der neuen Rechnung aufgeführt.
Sowohl für die Aktiengesellschaft30, als auch für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung31 und die Genossenschaft32 schreibt das Schweizerische Obligationenrecht in vor, dass aus einem Teil des Jahresgewinnes eine allgemeine Reserve gespeist werden muss. Oftmals werden aber zusätzlich offene Reserven gebildet, welche die gesetzliche Reserve in vielen Fällen übersteigen.
Auch das Agio ist nach dem Schweizerischen Obligationenrecht Teil der allgemeinen Reserve33, kann jedoch auch separat in der Rechnung ausgewiesen werden.
Das Reservevermögen muss innert 6 Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres, in dem die Reserven verbucht worden sind, dem Bund oder auf ein Sperrkonto einer zur Entgegennahme ermächtigten Bank einbezahlt werden, wobei es zu marktübli- chen Sätzen verzinst wird. Es darf weder verpfändet, noch mit Gegenforderungen verrechnet werden.34
3.3.2 Die verdeckte Selbstfinanzierung
Verdeckte Selbstfinanzierung ist identisch mit der Bildung von stillen Reserven. Dies erfolgt durch einen Entscheid des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung und geschieht35 Durch Unterbewertung von Aktiven36 oder Verbuchung von Scheinaufwand § Durch Ueberbewertung von Passiven
- Durch vollständige oder teilweise Nichtaktivierung von Anlagegütern § Durch Verzicht auf Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen
Die Auflösung stiller Reserven wird durch den Verwaltungsrat bestimmt und erfolgt durch37
- Veräusserung von Vermögenswerten über dem bisherigen Buchwert § Aufwertung von unter dem Höchstwert bilanzierten Aktiven
[...]
1 Kap. 6 dieser Semesterarbeit
2 Vgl. Drill 1995, S. 175.
3 Vgl. Boemle 1995, S. 353.
4 Vgl. Wyss 1995, S. 1.
5 Vgl. Brealey/Myers 1996, S.417.
6 Vgl. Wyss 1995, S. 12.
7 Vgl. Wyss 1995, S. 11-12.
8 Vgl. Drill 1995, S. 191.
9 Vgl. Boemle 1995, S. 358.
10 Vgl. Drill 1995, S.192
11 Vgl. Boemle 1995, S.362.
12 Vgl. Boemle 1995, S. 373
13 Vgl. Boemle 1995, S. 373
14 Vgl. Boemle 1995, S. 373
15 Vgl. Boemle 1995, S. 374
16 teilw. zit. nach Boemle 1995, S. 375
17 Vgl. Miller/Modigliani 1961, S. 411-433.
18 Vgl. Gutenberg 1980, S. 256-260
19 Vgl. Drill 1995, S. 180.
20 Vgl. Drill 1995, S. 189
21 Vgl. Art. 669 Abs. 3 und 674 Abs. 2 des Obligationenrechts
22 Zit. nach Boemle 1995, S. 363
23 Vgl. Boemle 1995, S. 363
24 Vgl. Drill 1995, S. 189
25 Vgl. Boemle1995, S.342
26 Zit. nach Boemle1995, S.343unter (1)
27 Vgl. Boemle1995, S.343/344unter (2)
28 Vgl. Boemle1995, S.344unter (3)
29 Vgl. Boemle1995, S.344unter (4)
30 Vgl. Art. 671 Abs. 3 des Obligationenrechts
31 Vgl. Art. 805 Abs. 3 des Obligationenrechts
32 Vgl. Art. 860 Abs. 3 des Obligationenrechts
33 Vgl. Art. 671 Abs. 2 Ziff. 1 des Obligationenrechts
34 Vgl. Boemle 1995, S. 348
35 Vgl. Boemle 1995, S. 349
36 Vgl. Art. 666 des Obligationenrechts
Häufig gestellte Fragen: Dividendenpolitik
Was ist Dividendenpolitik?
Dividendenpolitik bezieht sich auf die bewussten Maßnahmen eines Unternehmens zur Festlegung der Höhe, Form und zeitlichen Verteilung der Gewinnausschüttung an Aktionäre. Sie ist eng mit Finanzierungs- und Investitionsentscheidungen verknüpft und zielt darauf ab, verschiedene Aktionärsgruppen zufrieden zu stellen.
Welche Formen der Gewinnausschüttung gibt es?
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen offenen und verdeckten Gewinnausschüttungen. Offene Formen umfassen Bardividende, Stockdividende (Wertpapierdividende), Naturaldividende und Alternativdividende. Verdeckte Gewinnausschüttungen sind geldwerte Leistungen, die Aktionären ohne angemessene Gegenleistung zukommen.
Was ist eine Bardividende?
Die Bardividende ist die gebräuchlichste Form der Gewinnausschüttung, bei der Aktionäre eine bestimmte Summe pro Aktie in bar erhalten.
Was ist eine Stockdividende?
Eine Stockdividende, auch Wertpapierdividende genannt, ist eine Ausschüttung in Form von zusätzlichen Aktien oder Partizipationsscheinen, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln an die Aktionäre verteilt werden.
Was ist eine Naturaldividende?
Eine Naturaldividende ist eine Gewinnausschüttung in Form von Produkten oder Dienstleistungen des Unternehmens.
Was sind Alternativdividenden?
Bei Alternativdividenden haben die Aktionäre die Wahl zwischen einer Bar- oder einer Stockdividende.
Was sind Aktionärsoptionen?
Aktionärsoptionen sind unentgeltliche Optionen, die an die bisherigen Aktionäre ausgegeben werden und das Recht beinhalten, Aktien oder Partizipationsscheine des Unternehmens während einer bestimmten Periode zu einem festgelegten Preis zu beziehen.
Was sind Cash-oder-Titel-Optionen (COTO)?
Die Cash-or-Title-Option (COTO) ist ein Finanzinstrument, das dem Aktionär drei Wahlmöglichkeiten bietet: Bezug einer Aktie, Weiterverkauf der Option oder Rückgabe der Option gegen eine Barentschädigung an die Gesellschaft.
Was bedeutet Teilrückzahlung des Eigenkapitals durch Nennwertreduktion?
Bei einer Teilrückzahlung des Eigenkapitals durch Nennwertreduktion wird das Aktienkapital herabgesetzt und ein Teil des Nennwerts an die Aktionäre zurückgezahlt. Diese Rückzahlungen gelten nicht als steuerpflichtiger Vermögensertrag.
Ist der Rückkauf eigener Aktien eine Form der Gewinnausschüttung?
Ja, der Rückkauf eigener Aktien kann als eine Form der Gewinnausschüttung betrachtet werden, da Mittel an die Aktionäre ausgeschüttet werden, die ihre Aktien verkaufen wollen.
Welche rechtlichen Aspekte sind bei der Dividendenpolitik zu beachten?
Das Obligationenrecht (OR) regelt wesentliche Aspekte der Dividendenpolitik, darunter den Anspruch der Aktionäre auf einen Anteil am Bilanzgewinn, die Verwendung von Reserven für Dividendenzahlungen und die Beschlussfassung der Generalversammlung über die Höhe der Dividende.
Was ist die Kontroverse um die Dividendenpolitik?
Die Kontroverse um die Dividendenpolitik dreht sich um die Frage, ob und wie sich Dividendenzahlungen auf den Wert eines Unternehmens auswirken. Es gibt unterschiedliche Meinungen, ob Dividendenzahlungen den Unternehmenswert erhöhen, nicht beeinflussen oder senken.
Welche dividendenpolitischen Strategien gibt es?
Grundsätzlich müssen Unternehmen zwei Entscheidungen treffen: die Höhe der Ausschüttungsrate (Pay-Out-Ratio) und die Kontinuität der Ausschüttungen über mehrere Geschäftsjahre hinweg. Strategien umfassen Dividendenstabilität, Dividendenflexibilität und relative Dividendenkontinuität.
Was ist eine Dividendenstabilität?
Die Dividendenstabilität zielt darauf ab, den Ausschüttungsbetrag pro Aktie über einen langen Zeitraum unverändert zu lassen.
Was ist eine Dividendenflexibilität?
Bei der Dividendenflexibilität wird die Pay-Out-Ratio konstant gehalten, während der Ausschüttungsbetrag pro Aktie je nach Gewinnlage variiert.
Was ist eine relative Dividendenkontinuität?
Die relative Dividendenkontinuität ist eine Mischform aus Dividendenstabilität und -flexibilität, bei der Anpassungen der Dividende an kurzfristige Gewinnschwankungen vermieden werden und die Ausschüttungen sich nach den längerfristigen Gewinnerwartungen richten.
Was versteht man unter Selbstfinanzierung?
Selbstfinanzierung ist die Kapitalbeschaffung durch Verzicht auf Gewinnausschüttung. Der Gewinn wird im Unternehmen zurückbehalten, um Investitionen zu tätigen.
Welche Formen der Selbstfinanzierung gibt es?
Man unterscheidet zwischen offener und verdeckter Selbstfinanzierung. Die offene Selbstfinanzierung ist aus der Bilanz ersichtlich, während die verdeckte Selbstfinanzierung durch die Bildung stiller Reserven erfolgt.
- Quote paper
- Wilhelm, Julian (Author), 2000, Dividendenpolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102932