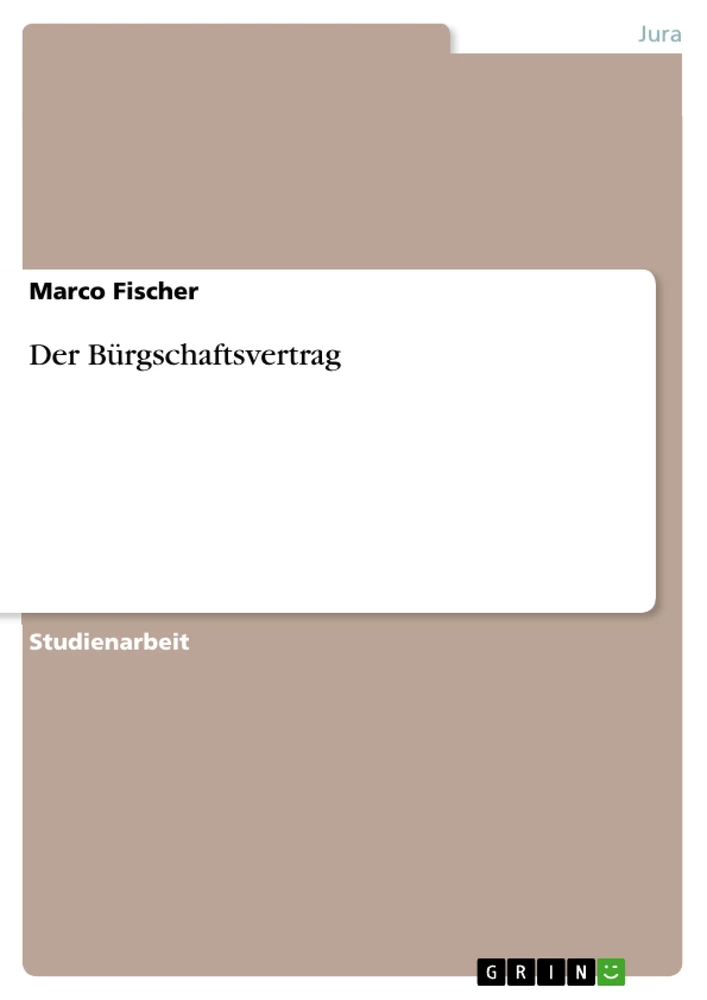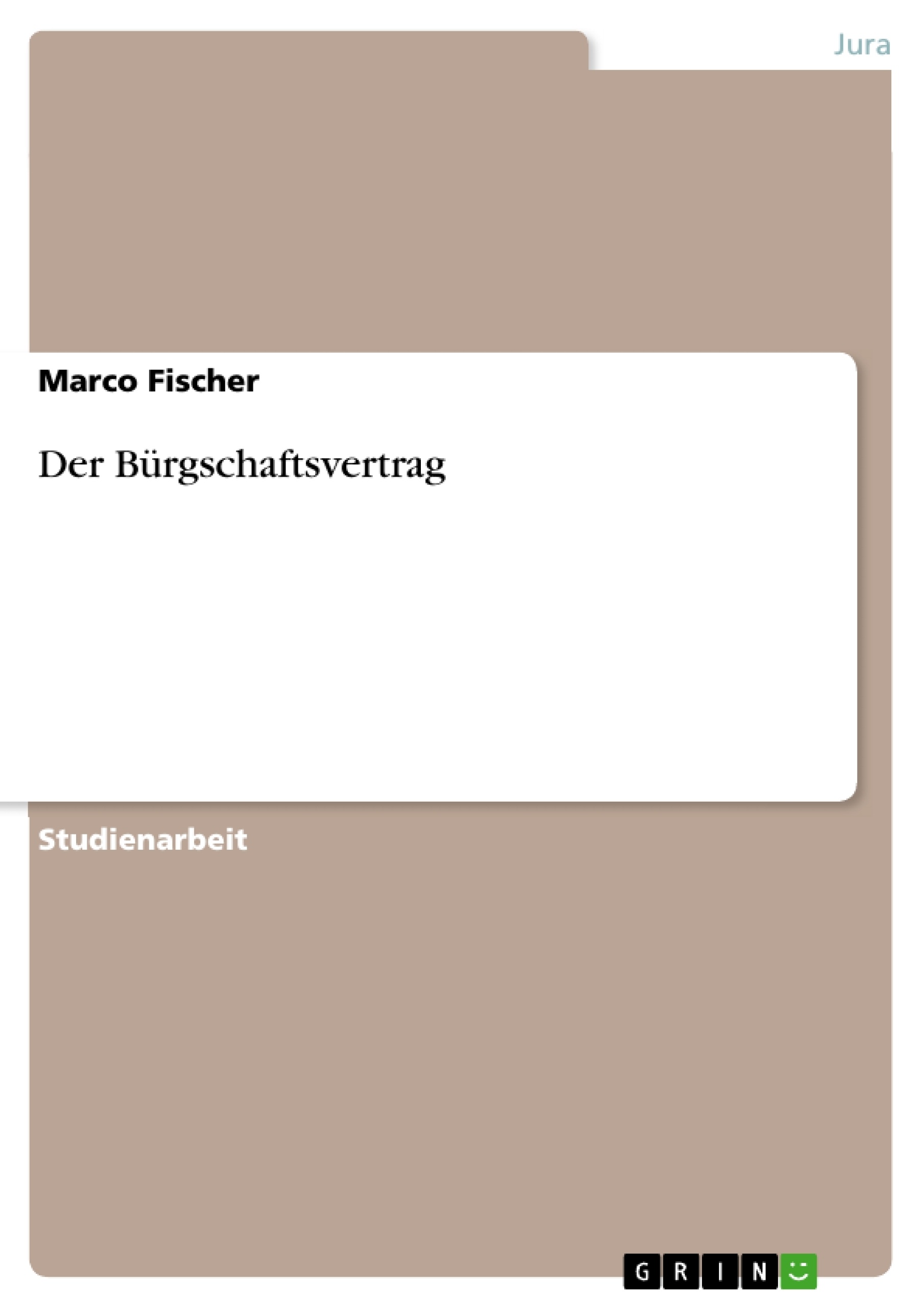1. Der Bürgschaftsvertrag
Mit dem Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich der Bürge einseitig gegenüber dem Gläubiger, für die Erfüllung einer - auch künftigen- Verbindlichkeit des Schuldners einzustehen (§765 I BGB).Der Bürge übernimmt also das Risiko, bei Zahlungsunfähigkeit des Schuldners selbst zahlen zu müssen.
Die Bürgschaft entsteht durch Vertrag zwischen dem Bürgen und dem Gläubiger. Wegen der Gefährlichkeit dieser persönlichen Sicherheit bedarf die Willenserklärung des Bürgen der Schriftform nach § 766 S.1 BGB, wobei ein Formmangel jedoch geheilt wird, soweit der Bürge freiwillig die Hauptschuld erfüllt (§766 S.2 BGB). Die Urkunde muss den Gläubiger, den Hauptschuldner und die zu sichernde Forderung bezeichnen sowie den Verbürgungswillen erkennen lassen (BGH NJW-RR 1991, 757; ZIP 1993, 102).
Damit der Vertrag Gültigkeit erlangt, muss die schriftliche Erklärung "erteilt" sein. Dazu genügt nicht die Unterzeichnung des Schriftstücks; vielmehr ist es erforderlich, dass dieses dem Gläubiger zur Verfügung gestellt wird.
Das Motiv für die Bürgschaftsübernahme ist in der Regel ein Auftrag oder ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem Bürgen und dem Hauptschuldner (Deckungsverhältnis).
Die Beteiligten an dem Dreiecksverhältnis heißen Gläubiger, Hauptschuldner und Bürge.
1.1 Rechtsverhältnisse in der Übersicht:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.2 Bestehen der Hauptschuld
Da die Bürgschaft zu Sicherungszwecken benötigt wird, ist sie vom jeweiligen Bestand der Hauptforderung abhängig (Akzessorietät der Bürgschaft; §767 I 1; dazu BGH WM 1991,1869)Ist die Hauptforderung nicht entstanden, so besteht auch keine Forderung des Gläubigers gegen den Bürgen. Zwar kann die Bürgschaft auch für eine künftige oder eine bedingte Verbindlichkeit übernommen werden (§ 765 II); solange aber diese Hauptschuld noch nicht entstanden ist, bleibt die Bürgschaft schwebend unwirksam. Ist die Hauptschuld entstanden und sie vermindert sich oder sie erlischt, so ermäßigt sich oder erlischt auch die Bürgschaft. Die Bürgschaft ist durch die Akzessorietät unmittelbar an die Hauptschuld geknüpft. Sollte sich die Hauptschuld erhöhen, ist zu unterscheiden, ob die Erhöhung aufgrund eines Gesetzes oder auf ein Rechtsgeschäft beruht. Eine gesetzliche Erweiterung der Hauptschuld (z.B. Schadensersatz wegen Schuldnerverzugs) führt zu einer Erweiterung der Bürgschaftsschuld (§ 767 I 2). Der Bürge haftet auch für die vom Schuldner dem Gläubiger zu ersetzenden Kosten der Kündigung und Rechtsverfolgung (§767 II). Gegen solche Erhöhungen seiner Verpflichtung kann sich der Bürge nur schützen, indem er eine Höchstbetragsbürgschaft abschließt. Mit der Höchstbetragsbürgschaft vereinbart er mit dem Gläubiger nur bis zu einem bestimmten Betrag einzustehen.
Eine rechtsgeschäftliche Erweiterung der Hauptschuld (durch Vereinbarungen zwischen Gläubiger und Schuldner nach Übernahme der Bürgschaft) führt nicht zu einer Erweiterung der Bürgschaftsschuld (§ 767 I 3). Das schützt den Bürgen davor, daß Gläubiger und Schuldner ihm eine Verpflichtung auferlegen, die er nicht übernehmen wollte. Sollte der Bürge jedoch damit einverstanden sein, daß seine Bürgschaft erhöht wird und er diese Erklärung schriftlich abgibt, ist er nicht schutzwürdig (§ 766).
1.3. Gegenrechte des Bürgen
A Gegenrechte aus dem Verhältnis des Bürgen zum Gläubiger
a. Allgemeine Einwendungen und Einreden
Einwendungen und Einreden gegenüber dem Gläubiger können dem Bürgen aus dem Bürgschaftsvertrag oder aus einem anderen Grund (z.B. Aufrechnung mit einer Gegenforderung des Bürgen gegen den Gläubiger) zustehen. Das ergibt sich zwar nicht aus den Regeln der §§ 765 ff., wohl aber aus allgemeinen Grundsätzen. So kann der Bürge z.B. die Formrichtigkeit des Bürgschaftsvertrages (§§ 125, 766) geltend machen. Er hat die Möglichkeit, seine Willenserklärung aufgrund der §§ 119 ff. (Irrtum) anzufechten. Allerdings scheidet eine Anfechtung nach § 119 II wegen Irrtums über die Kreditwürdigkeit des Schuldners aus, da es gerade der Sinn der Bürgschaft ist, dem Gläubiger gegenüber für die Schuld des Schuldners einzustehen, wenn dieser nicht leisten kann.
b. Einrede der Vorausklage
Der Bürge kann die Befriedigung des Gläubigers verweigern, solange nicht der Gläubiger eine Zwangsvollstreckung gegen den Schuldner ohne Erfolg versucht hat (§ 771). Er hat auch die verzögerliche Einrede der Vorausklage. Sie ergibt sich aus der Subsidiarität der Bürgschaftsverpflichtung; der Bürge will normalerweise erst nach dem Schuldner haften und
nur für den Fall einstehen, daß Rechtshilfe gegen den Schuldner fruchtlos versucht worden ist.
In der heutigen Praxis verzichtet der Bürge auf die Einrede der Vorausklage. Er verbürgt sich als Selbstschuldner (§ 773 I Nr.1) und tritt damit sofort bei Fälligkeit der Forderung für den Schuldner ein. Die selbstschuldnerische Bürgschaft schließt nur die Einrede der Vorausklage, nicht aber andere Gegenrechte des Bürgen aus. Der Verzicht auf die Einrede bedarf der Form des § 766 (BGH NJW 1968, 2332)
B.Gegenrechte des Bürgen aus dem Verhältnis des Schuldners zum Gläubiger.
a. Einrede nach § 768
Die Einreden des Schuldners kann auch der Bürge geltend machen (§ 768 I 1). Aus dem Grundgedanken der Akzessorität folgt, daß der Bürge nicht in Anspruch genommen werden kann, wenn der Schuldner dem Gläubiger nicht zur Leistung verpflichtet ist. Durch ein Verzicht der Einrede gegenüber dem Gläubiger von Seiten des Schuldners wird die Situation des Bürgen nicht verschlechtert (§ 768 II).
b. Einrede nach § 770 I
Ist es dem Schuldner möglich, das seiner Verbindlichkeit zugrunde liegende Rechtsgeschäft nach §§ 119 ff. anzufechten, so wird dadurch der Bestand der Hauptschuld und damit der Bürgschaft nicht berührt. Der Bestand wird erst dann berührt, wenn er sein Anfechtungsrecht ausübt.
Wird die Anfechtung wirksam erklärt, so erlischt die Hauptschuld (§ 142 I) und folglich durch die Akzessorität auch die Schuld des Bürgen (§ 767 I).
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Bürgschaftsvertrag?
Ein Bürgschaftsvertrag ist eine einseitige Verpflichtung des Bürgen gegenüber dem Gläubiger, für die Erfüllung einer Verbindlichkeit des Schuldners einzustehen (§765 I BGB). Der Bürge trägt das Risiko, bei Zahlungsunfähigkeit des Schuldners zahlen zu müssen.
Wie entsteht eine Bürgschaft?
Die Bürgschaft entsteht durch einen Vertrag zwischen dem Bürgen und dem Gläubiger. Die Willenserklärung des Bürgen bedarf der Schriftform (§ 766 S.1 BGB). Ein Formmangel wird geheilt, wenn der Bürge freiwillig die Hauptschuld erfüllt (§766 S.2 BGB).
Welche Angaben muss die Urkunde enthalten?
Die Urkunde muss den Gläubiger, den Hauptschuldner und die zu sichernde Forderung bezeichnen sowie den Verbürgungswillen erkennen lassen.
Was bedeutet "erteilt" in Bezug auf die schriftliche Erklärung?
"Erteilt" bedeutet, dass die schriftliche Erklärung dem Gläubiger zur Verfügung gestellt werden muss. Die reine Unterzeichnung des Schriftstücks genügt nicht.
Welche Rechtsverhältnisse bestehen bei einem Bürgschaftsvertrag?
Es besteht ein Dreiecksverhältnis zwischen Gläubiger, Hauptschuldner und Bürge.
Was bedeutet Akzessorietät der Bürgschaft?
Die Bürgschaft ist vom jeweiligen Bestand der Hauptforderung abhängig (§767 I 1 BGB). Ist die Hauptforderung nicht entstanden, besteht auch keine Forderung gegen den Bürgen. Vermindert oder erlischt die Hauptschuld, so vermindert oder erlischt auch die Bürgschaft.
Was passiert bei einer Erhöhung der Hauptschuld?
Eine gesetzliche Erweiterung der Hauptschuld (z.B. Schadensersatz wegen Schuldnerverzugs) führt zu einer Erweiterung der Bürgschaftsschuld (§ 767 I 2 BGB). Eine rechtsgeschäftliche Erweiterung der Hauptschuld hingegen nicht (§ 767 I 3 BGB), es sei denn, der Bürge stimmt dieser schriftlich zu (§ 766 BGB).
Was ist eine Höchstbetragsbürgschaft?
Bei einer Höchstbetragsbürgschaft vereinbart der Bürge mit dem Gläubiger, nur bis zu einem bestimmten Betrag einzustehen.
Welche Gegenrechte hat der Bürge gegenüber dem Gläubiger?
Der Bürge hat allgemeine Einwendungen und Einreden, die sich aus dem Bürgschaftsvertrag oder anderen Gründen ergeben können (z.B. Aufrechnung). Er kann auch die Formrichtigkeit des Bürgschaftsvertrages geltend machen oder seine Willenserklärung aufgrund von Irrtum anfechten.
Was ist die Einrede der Vorausklage?
Der Bürge kann die Befriedigung des Gläubigers verweigern, solange der Gläubiger nicht erfolglos eine Zwangsvollstreckung gegen den Schuldner versucht hat (§ 771 BGB).
Was bedeutet selbstschuldnerische Bürgschaft?
Bei einer selbstschuldnerischen Bürgschaft verzichtet der Bürge auf die Einrede der Vorausklage (§ 773 I Nr.1 BGB) und tritt sofort bei Fälligkeit der Forderung für den Schuldner ein. Der Verzicht muss in der Form des § 766 BGB erfolgen.
Welche Gegenrechte hat der Bürge aus dem Verhältnis des Schuldners zum Gläubiger?
Der Bürge kann die Einreden des Schuldners geltend machen (§ 768 I 1 BGB). Ein Verzicht des Schuldners auf Einreden verschlechtert nicht die Situation des Bürgen (§ 768 II BGB).
Was passiert, wenn der Schuldner das zugrunde liegende Rechtsgeschäft anfechten kann?
Der Bestand der Hauptschuld und damit der Bürgschaft wird erst berührt, wenn der Schuldner sein Anfechtungsrecht ausübt. Bis dahin hat der Bürge eine verzögerliche Einrede (§ 770 I BGB) und kann die Befriedigung des Gläubigers verweigern, solange dem Schuldner das Anfechtungsrecht zusteht. Nach wirksamer Anfechtung erlischt die Hauptschuld (§ 142 I BGB) und damit auch die Schuld des Bürgen (§ 767 I BGB).
- Quote paper
- Marco Fischer (Author), 2000, Der Bürgschaftsvertrag, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102891