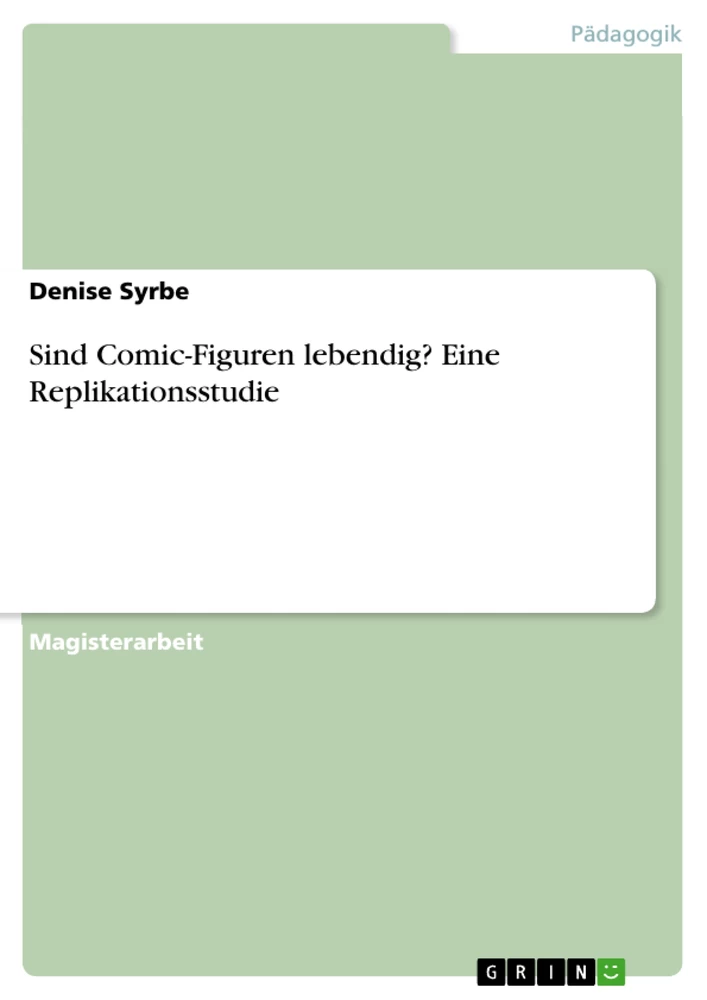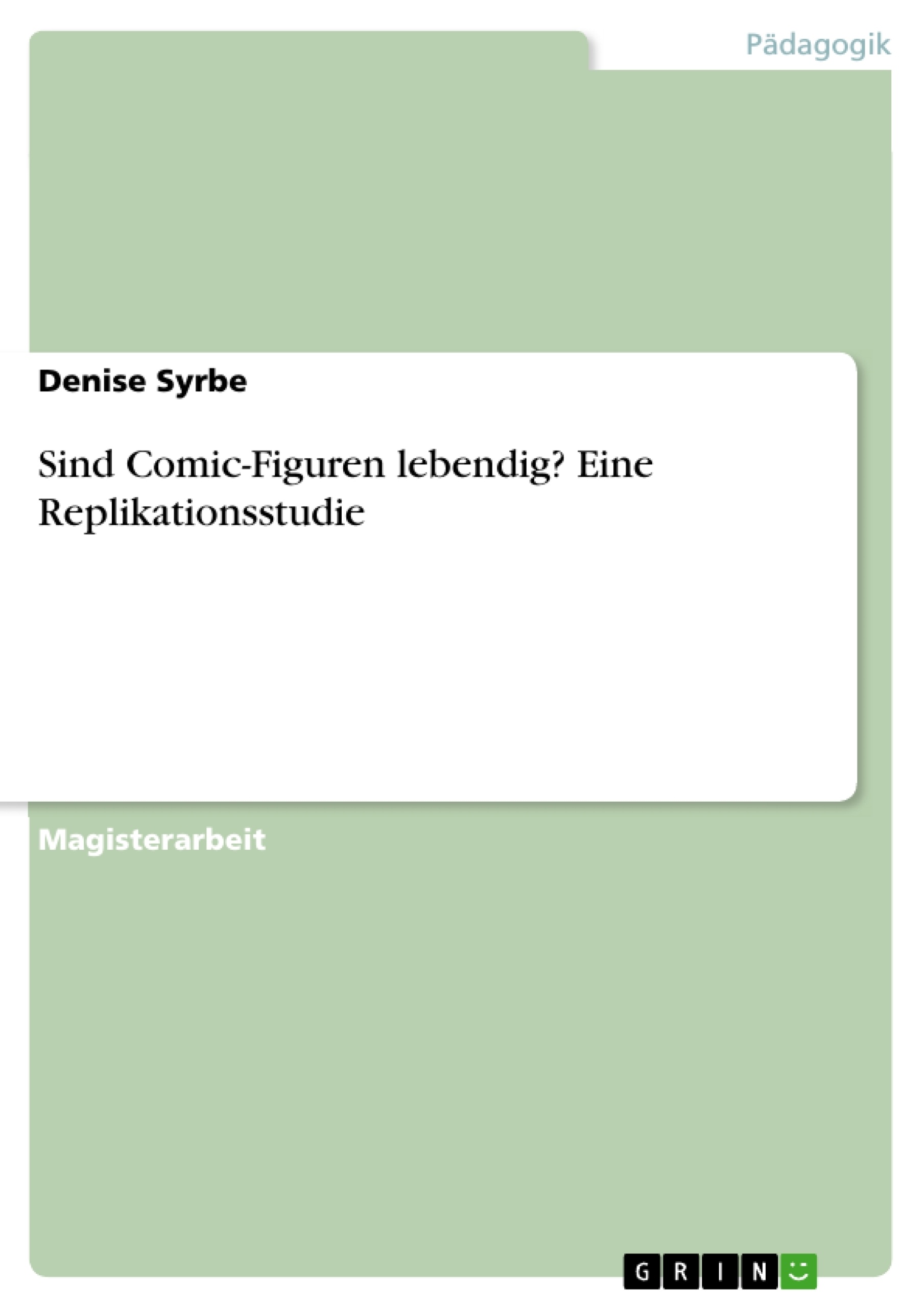„Sind Comic- Figuren lebendig?“ Eine Replikationsstudie lautet der Titel dieser Arbeit. Sie knüpft an das von Piaget postulierte Phänomen Animismus an. Er bezeichnete die Tendenz unbelebte Objekte mit Leben und Bewußtsein auszustatten, als Animismus. Vor diesem Hintergrund wurde die Fragestellung formuliert, ob Kinder Comicfiguren Eigenschaften zuschreiben, die traditionell animistisch sind und ob es Unterschiede in der Wahrnehmung zwischen verschiedenen Trickfiguren gibt.
Um diese Fragen beantworten zu können, wurde neben der Darstellung theoretischer Konzepte, eine Studie in zweiten und vierten Klassen durchgeführt. Es konnte festgestellt werden, daß Comicfiguren von einem Teil der Grundschulkinder animistisch wahrgenommen werden. Somit läßt sich das von Piaget postulierte Phänomen auch noch nach 70 Jahren replizieren. Die Mehrheit der befragten Kinder kann jedoch zwischen Realität und Fiktion unterscheiden und denkt somit nicht animistisch. Dieses Ergebnis bestätigt die Annahme der Medientheorie, daß Kinder im Grundschulalter verschiedene Genres klar voneinander trennen können. Sie wissen, daß Trickfiguren nicht echt und lebendig sind. Ein Vergleich zwischen den Figuren Bart Simpson, Dennis, Chip & Chap und den Turtles ergab, daß Comicfiguren, die in ihrer äußeren Darstellung dem Mensch bzw. Tier sehr ähnlich sind, häufiger mit Leben und Bewußtsein ausgestattet wurden, als Comicfiguren, die in ihrer äußeren Darstellung von realen Menschen bzw. Tieren abweichen. Somit wurde den Figuren Dennis und Chip & Chap mehr Leben und Bewußtsein zugeschrieben, als den Figuren Bart Simpson und den Turtles. Ferner wurde die Zuschreibung von Leben zu klassischen Piaget- Objekten untersucht. Auch diese werden von einem Teil der Kinder animistisch bewertet.
Das kindliche Phänomen Animismus läßt sich jedoch weder nur durch die Sichtweise Piagets, noch durch moderne theoretische Konzepte, die naiven Theorien, erklären. Tendenziell sprechen die Ergebnisse jedoch in die Richtung der naiven Theorien, animistisches Denken als Wissensdefizit aufzufassen und nicht wie Piaget als Ausdruck einer präkausalen egozentrischen Denkstruktur. Demnach werden durch einen Wissenszuwachs in verschiedenen Bereichen der erfahrbaren Umwelt von Kindern, animistische Denkweisen reduziert bzw. treten nicht mehr auf.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- 1. Problemstellung
- 2. Theoretischer Hintergrund der Studie
- 2.1 Animismus- Ein Phänomen in der kindlichen Entwicklung
- 2.1.1 Animismus im Blickwinkel der Theorie Piagets
- 2.1.1.1 Die kognitive Entwicklung aus der Sichtweise von Piaget
- 2.1.1.2 Das klassische Animismuskonzept von Jean Piaget
- 2.1.2 Konzeption der naiven Theorien
- 2.1.2.1 Die naive Physik
- 2.1.2.2 Die naive Biologie
- 2.1.2.3 Die naive Psychologie
- 2.1.2.4 Animistisches Denken von Kindern- ein Wissensdefizit?
- 2.1.3 Alternative Konzepte zur Erklärung des Animismusphänomens
- 2.2 Medientheoretische Überlegungen
- 2.2.1 Fernsehnutzung und Präferenzen von Kindern
- 2.2.2 Die kindliche Entwicklung und das Fernsehverständnis
- 2.2.2.1 Fernsehen und die kleinsten Zuschauer
- 2.2.2.2 Das Fernsehverständnis bei Vorschulkindern
- 2.2.2.3 Zum Fernsehverständnis der Kinder im Grundschulalter
- 2.2.2.4 Das Fernsehverständnis bei älteren Kindern
- 2.3 Wissenschaftliche Fragestellung und Hypothesen
- 3. Methodik der empirischen Untersuchung
- 3.1 Planung und Vorbereitung
- 3.1.1 Die Auswahl der Stichprobe
- 3.1.2 Methode der Datenerhebung- die schriftliche Befragung
- 3.1.3 Die Auswahl der Comicfiguren
- 3.1.4 Der Fragebogen
- 3.2 Durchführung
- 3.2.1 Die Probanden
- 3.2.2 Die Durchführung der Untersuchung
- 3.3 Auswertung
- 3.3.1 Kategorienbildung- eine wesentliche Grundlage der Auswertung
- 3.3.2 Die Auswertungsobjektivität
- 4. Ergebnisse
- 4.1 Beliebte und unbeliebte Zeichentrickserien
- 4.2 Der Bekanntheitsgrad der gewählten Zeichentrickfiguren
- 4.3 Attribution von Leben
- 4.4 Zuschreibung von Bewußtsein
- 4.5 Zuschreibung von Leben zu den klassischen Piaget- Objekten
- 5. Ergebnisse der Hypothesenprüfung
- 5.1 Auswertung zu Hypothese I
- 5.1.1 Ergebnisse
- 5.1.2 Vergleich zwischen den Zeichentrickfiguren
- 5.1.3 Resümee
- 5.2 Auswertung zu Hypothese II
- 5.2.1 Ergebnisse
- 5.2.2 Vergleich zwischen den Zeichentrickfiguren
- 5.2.3 Resümee
- 5.3 Auswertung zu Hypothese III
- 5.3.1 Ergebnisse
- 5.3.2 Vergleich zwischen den Zeichentrickfiguren
- 5.3.3 Resümee
- 5.4 Auswertung zu Hypothese IV
- 5.4.1 Ergebnisse
- 5.4.2 Altersspezifische Betrachtung der Objekte
- 5.4.3 Die Bewegung der Objekte als entscheidende Begründung
- 5.4.4 Resümee
- 5.5 Auswertung zu Hypothese V
- 5.5.1 Ergebnisse
- 5.5.2 Die Begründungen der Kinder- ähnlichkeitsorientierte- und kategorienorientierte Attribution
- 5.5.3 Altersspezifische Betrachtung der ähnlichkeitsorientierten Begründungen
- 5.5.4 Resümee
- 5.6 Auswertung zu Hypothese VI
- 5.6.1 Ergebnisse
- 5.6.2 Die Begründungen der Kinder- ähnlichkeitsorientierte- und kategorienorientierte Attribution
- 5.6.3 Altersspezifische Betrachtung der kategorienorientierten Begründungen
- 5.6.4 Resümee
- 6. Diskussion der Ergebnisse
- 6.1 Beurteilung der Lebendigkeit zu den klassischen Untersuchungsfragen Piagets
- 6.2 Die Wahrnehmung und Interpretation der Trickfiguren
- 6.3 Beantwortung der wissenschaftlichen Fragestellung
- 7. Ausblick
- Animismus in der kindlichen Entwicklung
- Wahrnehmung von Comicfiguren durch Kinder
- Unterschiede in der Wahrnehmung von verschiedenen Trickfiguren
- Replikation der Piagetschen Theorie
- Anwendung medientheoretischer Konzepte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Phänomen des Animismus, das von Jean Piaget postuliert wurde und die Tendenz beschreibt, unbelebten Objekten Leben und Bewusstsein zuzuschreiben. Die Studie untersucht, ob Kinder Comicfiguren animistische Eigenschaften zuschreiben und ob Unterschiede in der Wahrnehmung zwischen verschiedenen Trickfiguren bestehen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer detaillierten Darstellung des Animismus-Konzepts nach Piaget, einschließlich der kognitiven Entwicklungstheorie und der Kritik an der Vorstellung eines präkausalen egozentrischen Denkens. Es werden alternative Konzepte zur Erklärung des Animismusphänomens vorgestellt, die in den naiven Theorien der Physik, Biologie und Psychologie verankert sind. Die Studie analysiert den Einfluss von Medien auf die kindliche Entwicklung und das Fernsehverständnis, insbesondere im Hinblick auf die Unterscheidung zwischen Realität und Fiktion. Es wird eine wissenschaftliche Fragestellung formuliert und Hypothesen werden aufgestellt, die die Zuschreibung von Leben und Bewusstsein zu Comicfiguren und klassischen Piaget-Objekten untersuchen. Die empirische Untersuchung wird detailliert beschrieben, einschließlich der Auswahl der Stichprobe, der Methode der Datenerhebung (schriftliche Befragung), der Auswahl der Comicfiguren und der Konstruktion des Fragebogens. Die Ergebnisse der Untersuchung werden präsentiert, einschließlich der Analyse der Beliebtheit von Zeichentrickserien, des Bekanntheitsgrads der ausgewählten Comicfiguren und der Zuschreibung von Leben und Bewusstsein. Die Ergebnisse der Hypothesenprüfung werden in separaten Abschnitten zusammengefasst, wobei die Ergebnisse für jede Hypothese detailliert dargestellt und verglichen werden. Die Ergebnisse der Untersuchung werden in der Diskussion der Ergebnisse eingeordnet und mit den theoretischen Konzepten abgeglichen. Die Arbeit schließt mit einem Ausblick auf weitere Forschungsfelder.
Schlüsselwörter
Animismus, Comicfiguren, kindliche Entwicklung, Wahrnehmung, Medientheorie, Piaget, naive Theorien, Bewusstsein, Lebendigkeit, Replikationsstudie, Grundschulalter.
- Quote paper
- Denise Syrbe (Author), 2000, Sind Comic-Figuren lebendig? Eine Replikationsstudie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10287