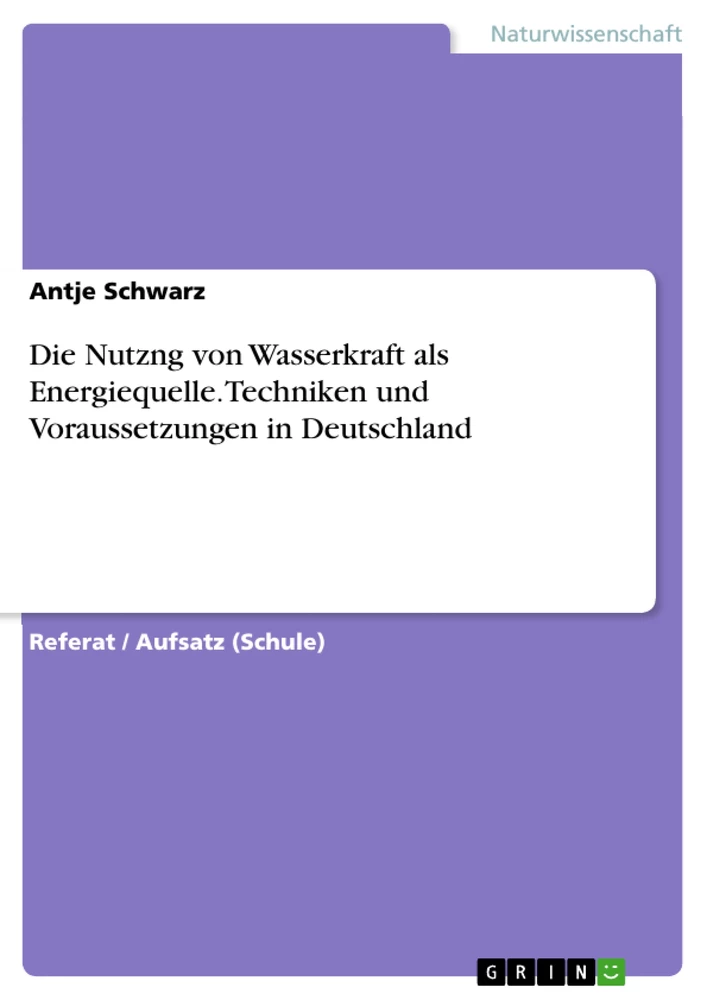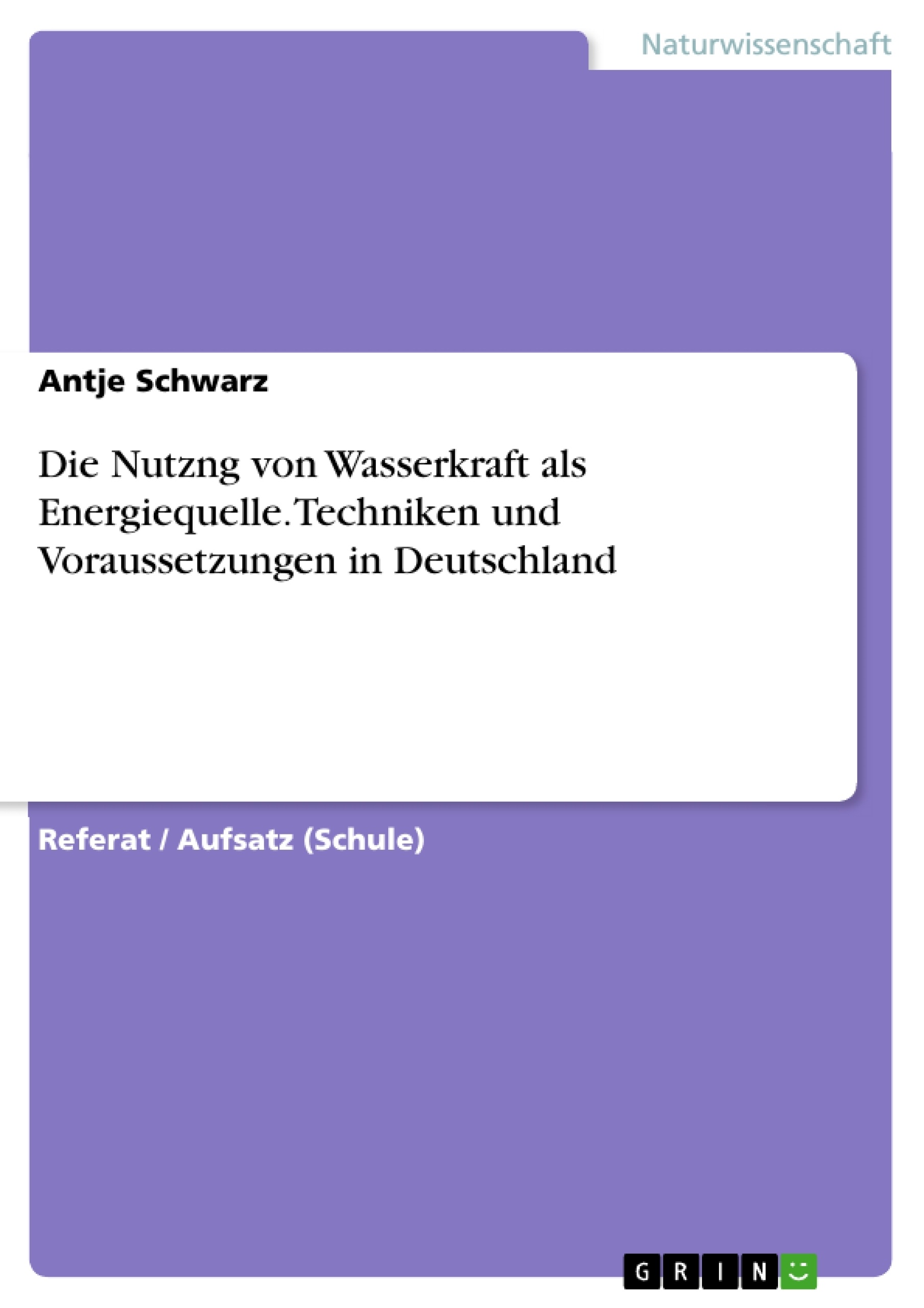Wasserkraft
- 70% der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt
- in den Meeren, Seen und Flüssen steckt ein gewaltiges Energiepotential
- in Deutschland gab es 1992, 660 Wasserkraftwerke
- sie erzeugten 15900 GWh
- das sind etwa 4% des Strombedarfs
- das scheint nicht viel, aber es handelt sich um regenerative Energien
- der Anteil bei regenerativen Energien liegt bei 85%
- angesichts der CO2 -Problematik ist es ein nicht zu vernachlässigender Energielieferant
- da die Baukosten sehr hoch sind und das Potential zu ¾ ausge nutzt ist, wird damit gerechnet, das bis zum Jahr 2000, 2000 neue Kleinkraftwerke gebaut werden
I. Natürliche Voraussetzungen in der Bundesrepublik
- die Nutzung der Wasserkraft hängt vom Wasserangebot der Gewässer ab
- die Abflusshöhe beträgt 50 mm - 2000 mm/a
- der Niederschlag hängt vom Einzugsgebiet ab
- die Topographie und die in Richtung Osten zunehmende Kontinentalität beeinflussen dies
- Niederschlagsreiche Gebiete sind: Alpennordrand, Mittelgebirge(Schwarzwald, Rothargebirge, Harz und Bayrischer Wald)
- das Norddeutsche Tiefland, insbesondere der Osten sind Niederschlagsarm
- der Wasserkraftnutzung kommt auch der Fremdniederschlag der Nachbarländer zugute
II. Physikalische Grundlage
- die Nutzung der Wasserkraft beruht auf der Kenetischen Energie einer Wassermenge, die durch Überwindung natürlicher und künstlicher Höhenunterschiede frei wird und die durch die Umwandlung in eine mechanische Drehbewegung nutzbar gemacht wird
- die Energie des Wassers wird in Rotationsenergie der Turbine umgesetzt und kann durch einen angekoppelten Stromerzeuger in Elektrische Energie umgewandelt werden
- hydraulische Leistung ist P hy Phy= d * g * Q * H [kW]
- Hydraulische Leistung = Dichte des Wassers * Erdbeschleunigung * Wasserführung * ausgenutztes Gefälle
- Leistung gleich Wasserdurchflussmenge und Fallhöhe
- 1866 entdeckte Werner von Siemens das dynamo-elektrische Prinzip
- es erklärt wie die mechanische in Elektrische Energie umgewandelt wird
- das war der Durchbruch zur Starkstromtechnik und der Beginn der Stromerzeugung aus Wasserkraft
III.Kraftwerksarten
Kraftwerke werden unterschieden nach ihrer Fallhöhe Niederdruckanlagen 1-20m Mitteldruckanlagen 20-100m Hochdruckanlagen mehr als 100m und nach ihrer Betriebsweise in Lauf-und Speicherkraftwerken
III.1 Laufwasserkaftwerke
- es sind meist Wasserräder an Flüssen und Kanälen
- um den Druck zu erhöhen werden die natürlichen Widerstände im Fluß verkleinert und der Sinkstofftransport vermindert
- Flüsse werden begradigt ➔ Erosion nimmt ab
- die Fließgeschwindigkeit wird verringert ➔ innere Reibung nimmt ab, wird verkleinert
- Druck entsteht außerdem noch durch Gefälle und wenn das Wasser weite Strecken zurücklegt
- rund um die Uhr in Betrieb
- Grundwasserkraftwerk
- kleine Fallhöhen, große Zuflüsse
- auf der Basis von aktuell zur Verfügung stehendem Wasser
- sie können extreme Wassermengen meist nicht verarbeiten
- die größten Laufwasserkraftwerke erreichen eine Leistung von bis zu 84.5 MW
III.2 Gezeitenkraftwerke
- nutzen die doppelte Kraft des Wassers
- Wasser wird zweimal durch Turbinen geleitet
1. wenn sich das Becken bei Flut füllt
2. wenn es aus dem Becken rausfließt
- es lohnt sich nur bei Tidenhüben über 8m
wie zum Beispiel in Saint-Malo an der Französischen Atlantikküste, dort fließt das Wasser
durch 10 Turbinen in einer 750m langen Staumauer
- es erreicht eine Leistung von 0,24 GWh/a
- aber es gibt nur 50 mögliche Standorte auf der Welt
- außerdem gibt es hohe Stromkosten
III.3 Speicherkraftwerke
- Einteilung in Tages- (<6h), Wochen- (6-25h), Saison- (<500h), Jahres- (>500h) und Überjahresspeicher
- werden zu Spitzenverbrauchszeiten eingesetzt
- Wasser wird in Becken angestaut ➔ potentielle Energie
- wird bei Bedarf verwendet
- Stauung dient außerdem zur Hochwasserzurückhaltung, Regulierung des Abflusses, Sicherheit der Schifffahrt, Speicherung des Trinkwassers, Bewässerung
- können Energie in Form von Wasservorräten die in natürlich oder künstlich angelegten Becken sammeln und speichern
- können Unregelmäßigkeiten im Wasserzufluß ausgleichen
III.4 Pumpspeicherkraftwerke
- dienen zur Haltung der Netzfrequenz und zur Stabilisierung
- sie werden in tiefergelegenen Gewässern gespeist
- es sind Reservewerke, wenn andere ausfallen
- es gibt ein höheres- und ein tiefergelegrenes Becken
- an Zeiten, wo der Strombedarf am höchst en ist, wird das Wasser von dem höheren durch Turbinen und Generatoren in das tiefergelegene Becken gepumpt
- in der Nacht, wenn es den billigeren Nachtstrom gibt, wird das Wasser durch Rohrleitungen wieder ins obere Becken gepumpt
- die Generatoren und Turbinen werden dann als Pumpen verwendet
- größtes: Vianden in Luxemburg,
- es kann jederzeit 1100 Megawatt liefern
- das größte in Deutschland ist am Schluchsee, südöstlich von Freiburg
- Nachteil: das Kosten/Nutzverhältniss stimmt nicht überein
- man entwickelt aber die Idee von Werner von Siemens weiter, um dieses Problem zu lösen
- Wirkungsgrad von 75%
- trotz hoher Verluste, ein unersetzbarer Bestandteil zur Deckung des Strombedarfs
III.5 Kraftwerke als Talsperren
- Hochgelegenen Seen, mit natürlichen Zu- und Abfluß
- aufgestautes Wasser wird in Rohrleitungen auf Francisturbinen geleitet
- sie können durch verstellen der Leitschlaufen reguliert werden
III.6 Gletscherkraftwerke
- auch die zweitgrößte Eismasse das „Grönländische Inlandeis“ wird zur Stromerzeugung genutzt
- es hat eine Masse von 2,4 Millionen Kubikkilometern
- der Bodensee hingegen nur 48 Kubikkilometer
- der Schmelzwassersee wird an seiner tiefsten Stelle angebohrt, damit auch dann noch genug Wasser da ist, wenn die Oberfläche gefriert
- dann wird das Wasser durch Rohre unter dem Eis an die Küste geleitet, wo es in Turbinen Strom erzeugt
- in Grönland gibt es bisher nur ein solches Kraftwerk, das Wasser aus einem 11 Kilometer entfernten See bekommt
- man schätzt das in Grönland pro Jahr etwa 10 Terawattstunden gefördert werden könnten
III.7 Wellenkraftwerke
- die Kraft der Wellen kann auch zur Energiegewinnung genutzt werden
- die Nutzung ist sehr Schwierig ➔ teuer
- die Kraftwerke müssen auf Plattformen stehen
- sie müssen voll automatisiert funktionieren
- der Mechanismus der die Wellenenergie in elektrische Energie umwandelt, ist sehr kompliziert
- da die Stärke und die Richtung der Wellen stark schwankt
III.8 Hochdruckkraftwerke an Gebirgen
- bei Fallhöhen über 400m
- Freistrahl- oder Peltonturbinen
- der Wasserstrahl trifft auf das Laufrad
- der ganze Umfang ist mit blechförmigen Schaufeln versehen
- Leistungsregelung erfolgt an der Düse durch Düsennadeln
IV. Turbinentypen
Turbinen haben die Aufgabe die potentielle Energie des Wassers in Rotationsenergie der Turbinenwelle umzuwandeln.
IV.1 Francisturbine
- 1849 vom Engländer James B. Francis erfunden
- ist eine Turbine mit verstellbaren Flügeln
- in Pump- und Speicherkraftwerken verwendet
- bei Fallhöhen von bis zu 700m
- Wirkungsgrad von bis 90%
- Leistungen bis zu 60 MW
- das Wasser wird durch ein feststehendes Leitrad mit verstellbaren Schaufeln auf die gegenläufig gekrümmten Schaufeln des Laufrades gedrückt
- das Wasser hat vor dem Eintritt in die Turbine einen Höheren Druck als nach dem Austritt
- deshalb spricht man von einer Überdruckturbine
- sie werden in Laufwasserkraftwerken sowie in Speicher- und Pumpspeicherkraftwerken eingesetzt
IV.2 Kaplanturbine
- 1910 vom Österreichischen Ingenieur Viktor Kaplan erfunden
- ähnelt einer Schiffsschraube
- das Laufrad trägt mehrere Propellerflügel die axial durchströmt werden
- und die Schwankungen des Wasserangebotes angepaßt werden können
- Einsatzbereiche sind Laufwasserkraftwerke
- Fallhöhen bis zu 200m
- Leistungen bis zu 125 MW · Wirkungsgrad bis zu 95%
- das einfließende Wasser wird vom Leitwerk so gelenkt, das es parallel zur senkrecht angeordneten Welle auf 3-6 verdrehte Schaufeln trifft
- Flügel sind verstellbar
- Turbinenleistung kann an das Flußwasserangebot angepaßt werden
IV.3 Peltonturbine
- 1889 vom Amerikaner Lester A. Pelton
- das Wasser trifft tangential aus einer Düse auf das bis zu 40 Bechern bestückten Laufrades
- in Speicherkraftwerken im Hochgebirge
- Fallhöhen von 550 bis 2000m
- Leistungen von bis zu 500 MW
- Wirkungsgrad über 90%
V. Auswirkungen auf Fließgewässer
- die Aufstauung bewirkt weitgehende Veränderungen in der Abflußdynamik, den Wasserwechselzonen und der Fließcharakterristik
- Fließgeschwindigkeit nimmt drastisch ab
oberhalb der Stauanlagen➔ Sedimentablagerungen unterhalb der Stauanlagen➔ Erosion
- Störung des Geschiebehaushaltes
- Zerstückelung des Lebensraumes viele im Wasser lebender Tierarten
- Veränderung in Struktur und Artenzusammensetzung der Flora und Fauna der Gewässer und Uferzone
- Gewässergüteverschlechterung: Sauerstoffarmut, Themperaturveränderung, änderung der Strömverhältnisse und der Eutrophierung
- Regulierung der Wasserführung(z.B. Dämpfung von Hochwasser)
- Hebung des Grundwasserspiegels
VI. Vor und Nachteile der Wasserkraft
VI.1 Vorteile:
- kein Verbrauch natürlicher Ressourcen
- keine Emission von Schadstoffen und geringe Abwärme
- hoher Wirkungsgrad von etwa 90%
- lange Lebensdauer der Anlagen
- einfache und bewährte Technologie
- niedrige Betriebskosten Aufgrund geringer Erfordernisse an Wartung und Bedienung
- Energiespeichermöglichkeiten
- Schnelligkeit des Auffahren und Abstellens der Anlage
- mittlere Vorteile bei Mehrzwecknutzung (Bewässerung, Schifffahrt, Erholung, Fischzucht)
- Verbesserung der ökologischen Verhältnisse an einem zuvor natur - fern ausgebauten Gewässers
- Hebung des Grundwasserspiegels
VI.2 Nachteile
- hohe Investitionskosten von 1000-6000 KW/installierter Leistung häufig große Entfernungen zwischen günstigen Wasserkraftstandorten und Verbraucherzentren
- Energieerzeugung ist unregelmäßig
- Überstauung anderweitig nutzbarer Flächen und ökologischen wertvoller Lebensräume
- soziologische Effekte aufgrund von Umsiedlungen
- Störung des Geschiebe- und Wasserhaushaltes
- Unterbrechung und Einschränkung des Lebensraumes für Wanderfische
VII. Fazit
- Energiegewinnung durch Wasserkraft ist ein nicht zu vernachlässigender Beitrag zur öffentlichen Stromversorgung
- Ausbaupotentiale sind realistisch gesehen jedoch relativ gering
- in den nächsten Jahren ist nur eine geringe Steigerung zu erwarten
- angesichts der Tatsache, das in der Bundesrepublik kaum noch intakte Fließgwässer verhanden sind, erscheint jeder weitere Eingriff in das Ökosystem mehr als problematisch
Häufig gestellte Fragen
Was ist Wasserkraft?
Wasserkraft nutzt die Energie des Wassers, um Strom zu erzeugen. 70% der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt und dieses enthält ein gewaltiges Energiepotential.
Wie viel Strom wird in Deutschland durch Wasserkraft erzeugt?
1992 gab es in Deutschland 660 Wasserkraftwerke, die 15900 GWh erzeugten. Das sind etwa 4% des Strombedarfs, aber es macht 85% der regenerativen Energien aus.
Welche natürlichen Voraussetzungen sind für Wasserkraft in Deutschland wichtig?
Das Wasserangebot der Gewässer, beeinflusst durch Abflusshöhe (50 mm - 2000 mm/a), Niederschlag (beeinflusst vom Einzugsgebiet, Topographie und Kontinentalität), ist entscheidend. Niederschlagsreiche Gebiete sind z.B. Alpennordrand, Mittelgebirge, während das Norddeutsche Tiefland eher niederschlagsarm ist. Auch Fremdniederschlag der Nachbarländer kommt der Wasserkraftnutzung zugute.
Wie funktioniert die Stromerzeugung aus Wasserkraft physikalisch?
Die kinetische Energie des Wassers, die durch natürliche oder künstliche Höhenunterschiede frei wird, wird in mechanische Drehbewegung umgewandelt. Diese wird dann durch einen Generator in elektrische Energie umgewandelt. Die hydraulische Leistung (Phy) berechnet sich aus Dichte des Wassers * Erdbeschleunigung * Wasserführung * ausgenutztes Gefälle.
Welche Arten von Wasserkraftwerken gibt es?
Kraftwerke werden nach Fallhöhe (Niederdruck, Mitteldruck, Hochdruck) und Betriebsweise (Lauf-, Gezeiten-, Speicher-, Pumpspeicher-, Gletscherkraftwerke) unterschieden.
Was sind Laufwasserkraftwerke?
Laufwasserkraftwerke nutzen den natürlichen Fluss von Flüssen und Kanälen. Sie sind meist rund um die Uhr in Betrieb und haben kleine Fallhöhen, aber große Zuflüsse. Sie nutzen das aktuell verfügbare Wasser und können extreme Wassermengen meist nicht verarbeiten.
Wie funktionieren Gezeitenkraftwerke?
Gezeitenkraftwerke nutzen die Kraft von Ebbe und Flut. Das Wasser wird zweimal durch Turbinen geleitet: beim Füllen und Leeren des Beckens. Es lohnt sich nur bei Tidenhüben über 8m.
Was sind Speicherkraftwerke?
Speicherkraftwerke stauen Wasser in Becken an, um es bei Bedarf (Spitzenverbrauchszeiten) zur Stromerzeugung zu nutzen. Die Stauung dient auch zur Hochwasserzurückhaltung, Abflussregulierung, Schifffahrtssicherheit, Trinkwasserspeicherung und Bewässerung.
Wie arbeiten Pumpspeicherkraftwerke?
Pumpspeicherkraftwerke nutzen zwei Becken (hoch- und tiefergelegen). Bei hohem Strombedarf wird Wasser vom oberen ins untere Becken geleitet, um Strom zu erzeugen. In der Nacht (bei billigerem Strom) wird das Wasser wieder ins obere Becken gepumpt. Sie dienen zur Haltung der Netzfrequenz und zur Stabilisierung.
Wie funktionieren Gletscherkraftwerke?
Gletscherkraftwerke nutzen Schmelzwasser von Gletschern zur Stromerzeugung. Das Schmelzwasser wird durch Rohre unter dem Eis an die Küste geleitet, wo es Turbinen antreibt.
Welche Turbinentypen werden in Wasserkraftwerken eingesetzt?
Es gibt verschiedene Turbinentypen, darunter Francisturbinen, Kaplanturbinen und Peltonturbinen, die jeweils für unterschiedliche Fallhöhen und Wassermengen geeignet sind.
Was bewirkt die Wasserkraftnutzung an Fließgewässern?
Die Aufstauung verändert die Abflussdynamik, Wasserwechselzonen und Fließcharakteristik. Die Fließgeschwindigkeit nimmt ab, es kommt zu Sedimentablagerungen oberhalb und Erosion unterhalb der Stauanlagen. Der Lebensraum wird zerstört und das Gewässer kann sich verschlechtern.
Was sind die Vorteile der Wasserkraft?
Kein Verbrauch natürlicher Ressourcen, keine Schadstoffemissionen, hoher Wirkungsgrad, lange Lebensdauer der Anlagen, einfache Technologie, niedrige Betriebskosten, Energiespeichermöglichkeiten und mittlere Vorteile bei Mehrzwecknutzung.
Was sind die Nachteile der Wasserkraft?
Hohe Investitionskosten, unregelmäßige Energieerzeugung, Überstauung von Flächen, soziologische Effekte durch Umsiedlungen, Störung des Geschiebe- und Wasserhaushaltes, Unterbrechung des Lebensraumes für Wanderfische.
Was ist das Fazit zur Wasserkraft?
Die Wasserkraft leistet einen Beitrag zur Stromversorgung, aber das Ausbaupotential ist begrenzt. Jeder weitere Eingriff in das Ökosystem ist problematisch, da kaum noch intakte Fließgewässer vorhanden sind. Der Umweltschutz kann nicht auf Kosten des Gewässer- und Naturschutzes erfolgen.
- Citation du texte
- Antje Schwarz (Auteur), 2000, Die Nutzng von Wasserkraft als Energiequelle. Techniken und Voraussetzungen in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102839