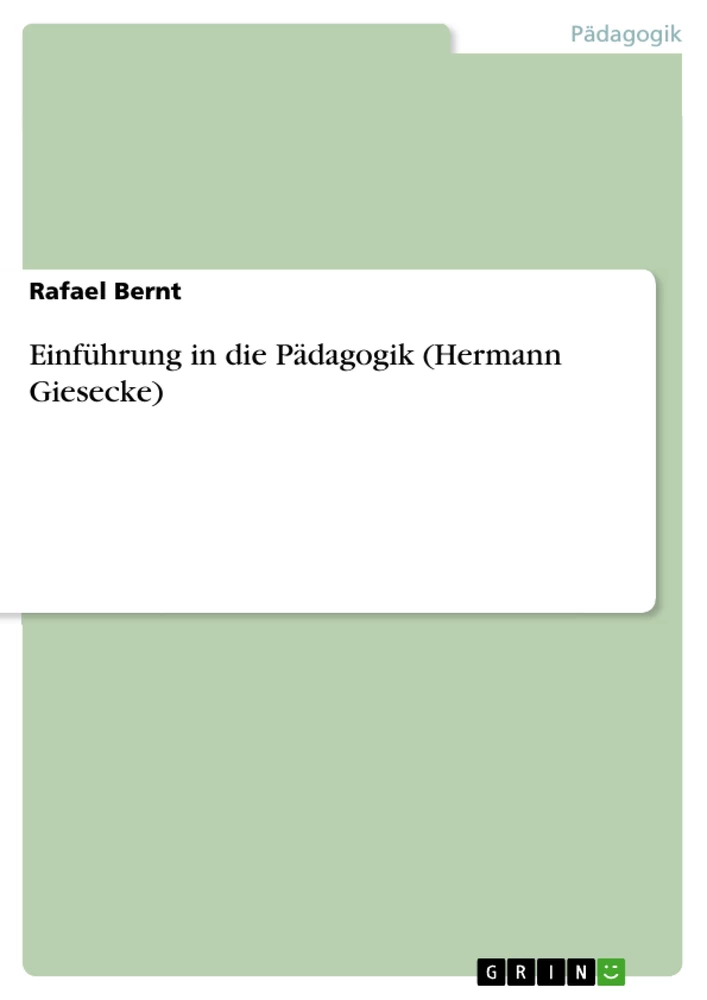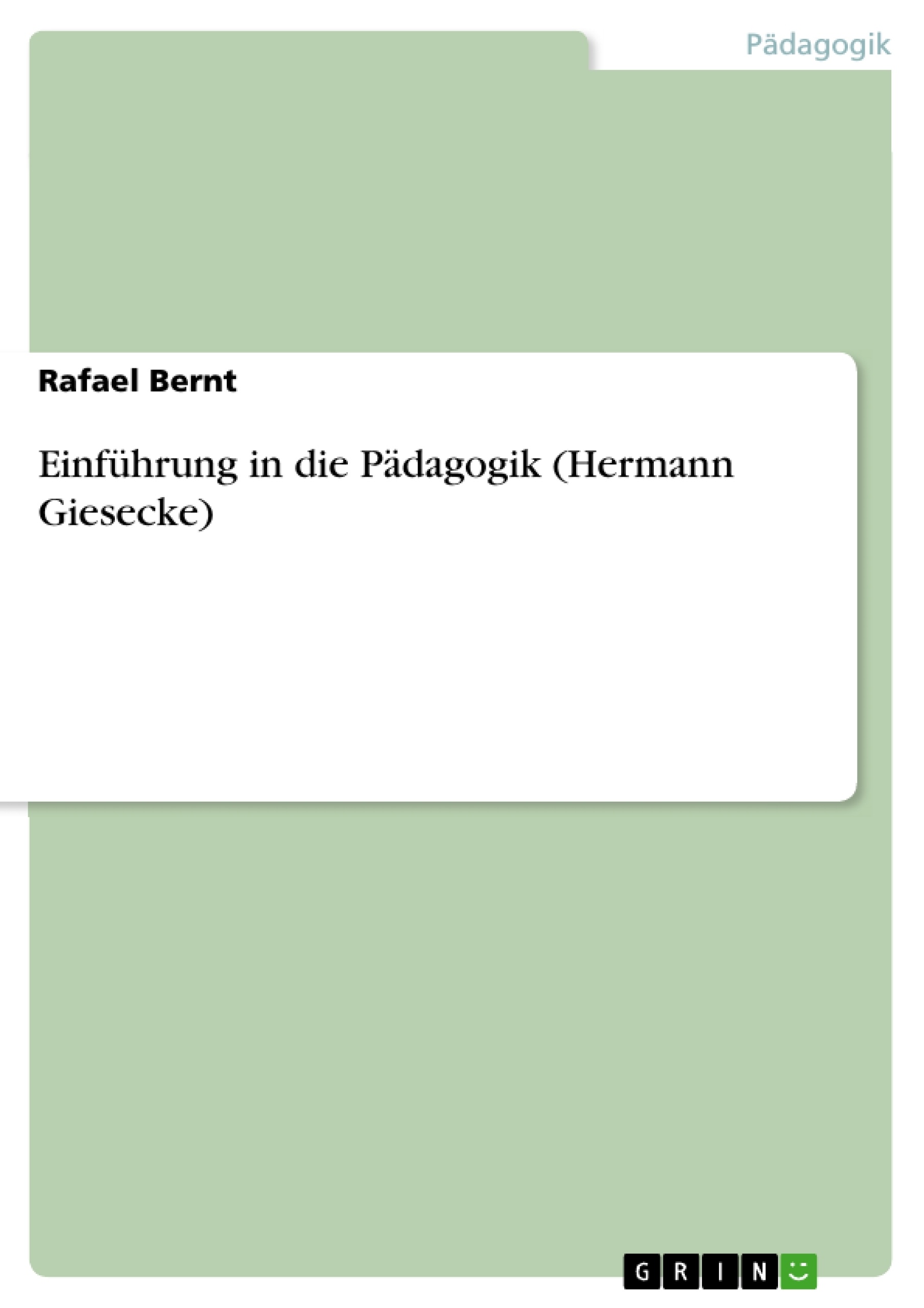Was macht den Menschen zum Menschen und wie formen gesellschaftliche Kräfte seine Entwicklung? Dieses Buch nimmt den Leser mit auf eine erkenntnisreiche Reise durch die Grundlagen der Pädagogik, indem es die vielschichtigen Aspekte des Heranwachsens von Kindern und Jugendlichen beleuchtet. Ausgehend von einer Zeit des gesellschaftlichen und pädagogischen Umbruchs in der Bundesrepublik, entfaltet der Autor ein umfassendes Bild, das sowohl biologisch-psychologische als auch geschichtlich-gesellschaftliche Dimensionen berücksichtigt. Im Fokus steht dabei die Frage, wie Erziehung, Bildung und Sozialisation ineinandergreifen und welche Rolle sie im Leben junger Menschen spielen. Der Leser erhält einen klaren Einblick in die Bedeutung grundlegender pädagogischer Begriffe wie Didaktik und Methodik, die als praktische Werkzeuge im Umgang mit Kindern und Jugendlichen dienen. Dabei werden unterschiedliche Zugänge zur Geschichte der Pädagogik aufgezeigt und aktuelle Phänomene vielschichtig betrachtet. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Herausforderungen des Heranwachsens im Kontext der bürgerlichen Gesellschaft und der Frage, wie pädagogische Probleme entstehen, definiert und gelöst werden können. Abschließend widmet sich der Autor der Erziehungswissenschaft selbst und ihrer Rolle im Gefüge der Wissenschaften. Er verdeutlicht, dass die Pädagogik interdisziplinär angelegt sein muss und die Aufgabe hat, Modelle zu entwickeln, die der Komplexität praktischer Probleme gerecht werden. Dieses Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für Studierende der Pädagogik, Sozialpädagogik, Erziehungswissenschaften sowie für alle, die sich beruflich oder privat mit der Entwicklung junger Menschen auseinandersetzen. Es bietet eine fundierte Einführung in die Thematik und regt dazu an, über die Bedingungen und Möglichkeiten von Bildung und Erziehung in unserer Gesellschaft nachzudenken. Es erweist sich als ein wertvoller Begleiter für alle, die pädagogische Konzepte klarer fassen und strukturieren wollen, indem es empirische und pädagogische Denkmodelle verständlich aufschlüsselt.
Gieseckes Buch, soll, wie der Titel schon verrät, eine Einführung in die Pädagogik vornehmen. Damit ist das Zentralthema - wie bereits auch die Einleitung zeigt - die Darstellung von Aspekten des Heranwachsens von Kindern und Jugendlichen. Dabei nähert sich der Autor von zwei unterschiedlichen Perspektiven: der biologisch- psychologischen Dimension und der geschichtlich-gesellschaftlichen Dimension hinsichtlich der Betrachtung von pädagogischen Phänomenen.
Erstmalig veröffentlicht wurde das Buch bereits 1969, also in einer Zeit des (pädagogischen) Umbruchs in der Bundesrepublik. Der Autor war zu dieser Zeit bereits Professor an der Pädagogischen Hochschule Göttingen (heute Universität Göttingen, Pädagogische Fakultät).
Prof. Dr. Hermann Giesecke wurde 1932 in Duisburg-Hamborn geboren und widmete sein Arbeitsleben ganz der pädagogischen Arbeit: 1954 beginnend mit dem Studium des Lehramtes in Münster (Geschichte, Latein, Philosophie und Pädagogik), über Dozententätigkeit am Jugendhof Steinkimmen und seiner Promotion 1964 im Bereich Politische Bildung am Institut für Pädagogik der Universität Kiel bis hin zu seiner Professur für Pädagogik und Sozialpädagogik 1967 an der Pädagogischen Hochschule Göttingen.
Das erste Kapitel „Biologische und psychologische Voraussetzungen des Heranwachsens“ beschreibt dem Menschen als ein „weltoffenes“ Wesen. Er zeigt auf, dass auf der einen Seite die Lernbedürftigkeit des Menschen von seiner Entwicklung, der Ontogenese, abhängt aber die prinzipielle Bildsamkeit und Begabung von seinen natürlichen Erbanlagen bestimmt wird. Damit kann der fundamentale Ansatz in der Erziehung formuliert werden: Der Mensch ist ein „Mängel-Wesen“ und versucht die natürlichen Defizite über seine soziale Umwelt und sein Handeln auszugleichen. Aus der Tatsache, dass Erbanlagen statisch, fest fixiert sind - Begabung und Bildsamkeit dynamisch, abhängig von den Angeboten sind, ergibt sich die Folgerung: Das Bildungswesen ist so zu gestalten, das es diesen Umstand gerecht wird z. B. durch dreigliedriges Schulwesen.
Im zweiten Kapitel „Die geschichtlich-gesellschaftliche Dimension der Pädagogik“ geht der Autor von der pädagogischen Praxis aus und versteht die grundlegenden pädagogischen Begriffe wie Erziehung, Bildung, Sozialisation, Lernen, Didaktik und Methodik usw. als Bezeichnungen für praktische Probleme, die beim beruflichen oder privaten Umgang mit Kindern und Jugendlichen entstehen.
Sein Augenmerk setzt er dabei im bürgerlichen Zeitalter. Er zeigt auf, dass es zur Geschichte der Pädagogik verschiedene Zugänge gibt.
Es wird deutlich, dass durch die unterschiedlichen Fragestellungen ggf. auch in Kombination aktuelle Phänomene vielschichtig/verschiedenartig in erziehungswissenschaftlichen Arbeiten betrachtet werden können
Die praxisorientierte Darstellung der pädagogischen Grundbegriffe verbessert es dem Leser diese Begriffe klarer zu fassen und zu strukturieren. Sein Exkurs in empirische und pädagogische Denkmodelle erweist sich als sehr hilfreich. Insbesondere seine Begriffsbestimmung zur Sozialisation in Abgrenzung zur Pädagogik erscheint leicht verständlich und gut nachvollziehbar: Sozialisation ist der übergeordnete Begriff. Er umfasst alle geplanten pädagogischen Maßnahmen und ungeplanten Wirkungen, die dazu führen, daß Kinder und Jugendliche in die bestehende Gesellschaft und ihre Verantwortungsbereiche hineinwachsen“ (S. 69) Die gut einprägbare Unterscheidung von Bildung als den Anspruch individueller menschlicher Selbstverwirklichung und Erziehung, als ein Gewalt und Führsorgeverhältnis ist dem Autor ebenfalls sehr gut gelungen.
Im dritten Kapitel „Gefährdungen des Heranwachsens“ geht der Autor der Frage nach, warum ist ein Jugendlicher so geworden wie er ist. Dabei geht er praxisorientiert von Kindern und Jugendlichen im bürgerlichen Zeitalter aus, deren Aufwachsen besondere Schwierigkeiten bereitet. Eindrucksvoll zeigt er, wie pädagogische Probleme im gesellschaftlichen (bürgerlichen) Kontext entstehen und wer diese Probleme wie definiert und welche Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen bzw. realisiert werden.
Im vierten und letzen Kapitel „Erziehungswissenschaft“ widmet sich der Autor der Erziehungswissenschaft bzw. der Rolle der Wissenschaften im Rahmen der pädagogischen Praxis. Dabei stellt er fest, dass die Herausbildung der Erziehungswissenschaft und deren Weiterentwicklung zur Sozialwissenschaft ein gesellschaftliches Erfordernis war, da
- die ideologischen Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft von Anfang an auf Wissenschaft bzw. auf rationalem wissenschaftlichen Denken beruhten,
- wissenschaftliche Methoden besonders dort nötig waren, wo geplant und entschieden wurde und
- die Erziehungswissenschaft gesellschaftliche Probleme aus der Perspektive von Lernproblemen formuliert.
Der Autor stellt anhand von Beispielen klar heraus, das die Probleme der Pädagogik interdisziplinäre Probleme sind, weist aber der Pädagogik auch eine klare Aufgabe im wissenschaftlichen Gefüge zu:
„Die Pädagogik hat die Aufgabe, Denk- und Informationsmodelle zu entwerfen, Modelle, die der Komplexität und damit dem interdisziplinären Charakter der praktischen Probleme Rechnung tragen; so weit wie möglich auf empirischen Unterlagen basieren;offenbleiben für neue Forschungen und Ergebnisse, also wissenschaftlich diskutierbar bleiben.“ (S. 189)
Häufig gestellte Fragen zu Gieseckes Einführung in die Pädagogik
Worum geht es in Gieseckes Buch "Einführung in die Pädagogik"?
Das Buch bietet eine Einführung in die Pädagogik und konzentriert sich auf das Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen. Der Autor betrachtet pädagogische Phänomene aus zwei Perspektiven: der biologisch-psychologischen und der geschichtlich-gesellschaftlichen Dimension.
Wann wurde das Buch veröffentlicht und wer war der Autor?
Das Buch wurde 1969 veröffentlicht. Der Autor, Prof. Dr. Hermann Giesecke, war Professor an der Pädagogischen Hochschule Göttingen (heute Universität Göttingen, Pädagogische Fakultät).
Was behandelt das erste Kapitel ("Biologische und psychologische Voraussetzungen des Heranwachsens")?
Das erste Kapitel beschreibt den Menschen als "weltoffenes" Wesen. Es betont, dass die Lernbedürftigkeit von der Ontogenese abhängt, aber die Bildsamkeit und Begabung von den Erbanlagen bestimmt werden. Der Mensch wird als "Mängel-Wesen" betrachtet, das versucht, Defizite durch soziale Interaktion und Handeln auszugleichen.
Was ist das Thema des zweiten Kapitels ("Die geschichtlich-gesellschaftliche Dimension der Pädagogik")?
Dieses Kapitel geht von der pädagogischen Praxis aus und betrachtet grundlegende Begriffe wie Erziehung, Bildung, Sozialisation, Lernen, Didaktik und Methodik als Bezeichnungen für praktische Probleme im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Der Fokus liegt auf dem bürgerlichen Zeitalter und verschiedenen Zugängen zur Geschichte der Pädagogik.
Wie definiert Giesecke Sozialisation im Vergleich zur Pädagogik?
Giesecke versteht Sozialisation als den übergeordneten Begriff, der alle geplanten pädagogischen Maßnahmen und ungeplanten Wirkungen umfasst, die dazu führen, dass Kinder und Jugendliche in die Gesellschaft hineinwachsen.
Was behandelt das dritte Kapitel ("Gefährdungen des Heranwachsens")?
Dieses Kapitel untersucht, warum Jugendliche so geworden sind, wie sie sind, und geht von Kindern und Jugendlichen im bürgerlichen Zeitalter aus, deren Aufwachsen besondere Schwierigkeiten bereitet. Es zeigt, wie pädagogische Probleme im gesellschaftlichen Kontext entstehen, wer diese Probleme definiert und welche Lösungsansätze vorgeschlagen werden.
Womit beschäftigt sich das vierte Kapitel ("Erziehungswissenschaft")?
Das vierte Kapitel widmet sich der Erziehungswissenschaft und der Rolle der Wissenschaften im Rahmen der pädagogischen Praxis. Es betont, dass die Herausbildung der Erziehungswissenschaft ein gesellschaftliches Erfordernis war, da die ideologischen Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft auf Wissenschaft und rationalem Denken beruhten.
Welche Aufgabe weist Giesecke der Pädagogik im wissenschaftlichen Gefüge zu?
Giesecke sieht die Aufgabe der Pädagogik darin, Denk- und Informationsmodelle zu entwerfen, die der Komplexität und dem interdisziplinären Charakter der praktischen Probleme Rechnung tragen, auf empirischen Unterlagen basieren und offen bleiben für neue Forschungen und Ergebnisse.
Für wen ist das Buch geeignet?
Das Buch ist sehr gut geeignet für Studierende als eine allgemeine Einführung in die Problematik der Pädagogik und wird als Standardwerk der Pädagogik bezeichnet.
- Quote paper
- Rafael Bernt (Author), 2001, Einführung in die Pädagogik (Hermann Giesecke), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102831