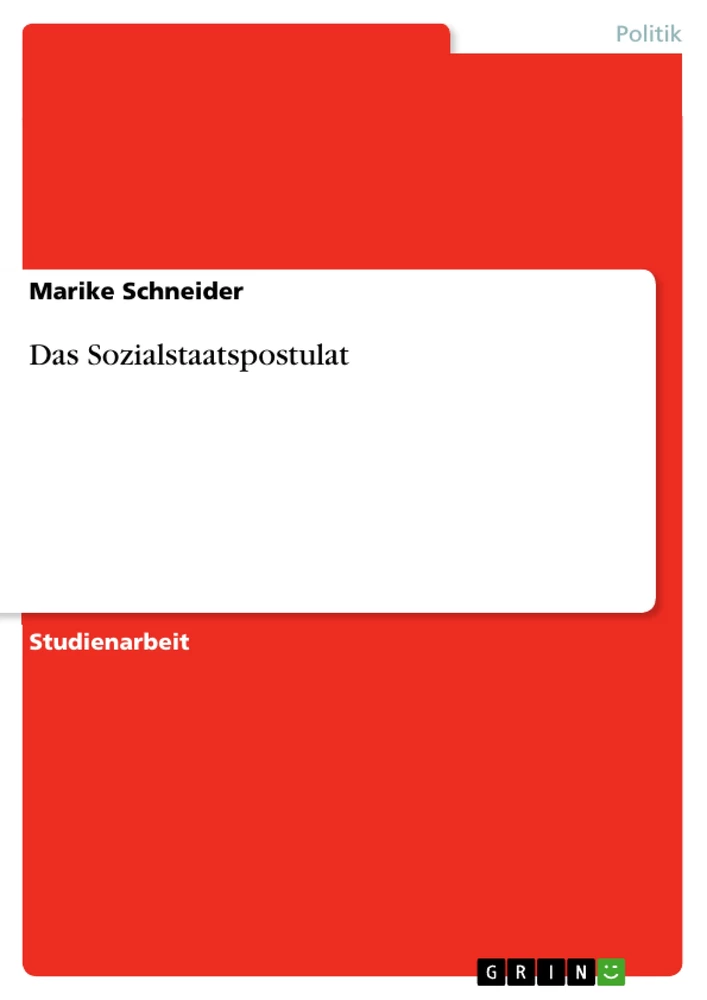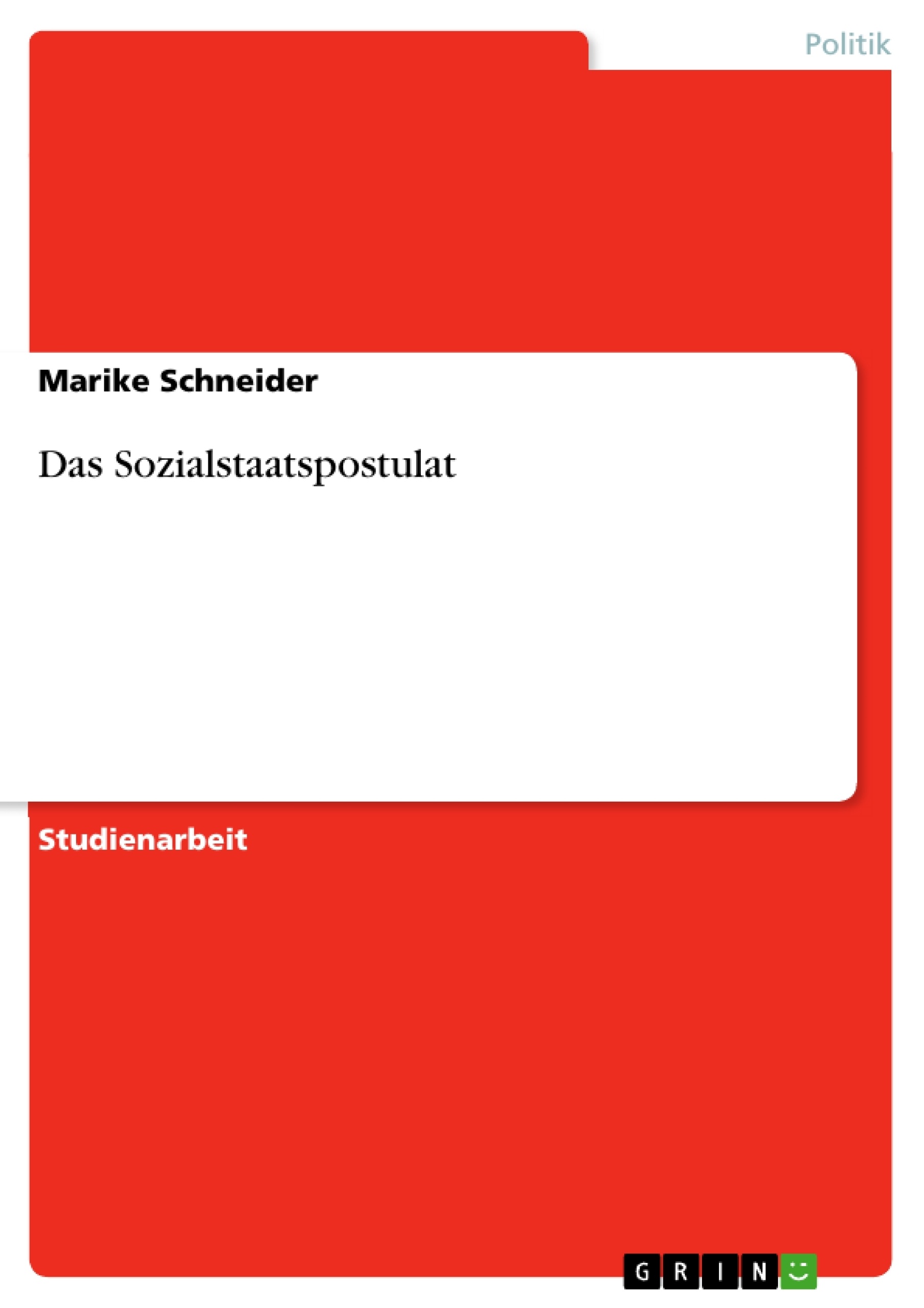Stellen Sie sich eine Gesellschaft vor, in der Gerechtigkeit nicht nur ein Ideal, sondern ein verfassungsmäßiges Gebot ist. Dieses Buch enthüllt die tiefgreifenden Prinzipien des deutschen Sozialstaats, ein System, das darauf abzielt, soziale Ungleichheiten zu minimieren und die Existenzgrundlage aller Bürger zu sichern. Von den Nachkriegswirren bis zu den komplexen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts untersucht es, wie das Grundgesetz die Balance zwischen individueller Freiheit und sozialer Verantwortung neu definiert. Entdecken Sie die historischen Wurzeln des Sozialstaatsprinzips, seine verfassungsrechtliche Verankerung und die daraus resultierenden Pflichten des Staates gegenüber seinen Bürgern. Erfahren Sie, wie soziale Grundwerte wie Menschenwürde, Gleichheit und der Schutz von Ehe und Familie in konkrete Gesetze und Maßnahmen umgesetzt werden. Analysiert werden die Spannungen zwischen Rechtsstaat und Sozialstaat, zwischen formaler Gerechtigkeit und materieller Gleichheit. Das Buch beleuchtet die Rolle der Grundrechte als Abwehrrechte gegen staatliche Eingriffe und als Instrumente zur Förderung sozialer Teilhabe. Es zeigt auf, wie das Sozialstaatsgebot den Gesetzgeber verpflichtet, die Sozialordnung immer wieder neu zu gestalten und an die sich wandelnden Bedürfnisse der Gesellschaft anzupassen. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Frage, inwieweit soziale Gerechtigkeit durchsetzbar ist und welche Grenzen der staatlichen Gestaltungsmacht gesetzt sind, fehlt ebenso wenig wie die Diskussion um die Bedeutung des Sozialstaatsprinzips für die politische Willensbildung und die Rolle der Parteien bei der Konkretisierung sozialstaatlicher Ziele. Tauchen Sie ein in die Welt des deutschen Sozialstaats, seine Errungenschaften, seine Herausforderungen und seine Zukunftsperspektiven. Dieses Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für die Grundlagen unserer Gesellschaft, für soziale Gerechtigkeit und für die Rolle des Staates im 21. Jahrhundert interessieren. Es bietet fundierte Einblicke in die verfassungsrechtlichen Grundlagen, die politische Praxis und die ethischen Implikationen eines Systems, das weltweit Beachtung findet und als Vorbild für andere Nationen dient, die eine gerechtere und sozialere Gesellschaft anstreben. Ein tiefgründiges Werk über Sozialpolitik, Grundrechte, Verfassungsrecht und die Zukunft sozialer Sicherheit in Deutschland.
I. Das verfassungsrechtliche Sozialstaatsgebot
Nach dem zweiten Weltkrieg mußte das Verhältnis von Bürger und Staat und das Staatswesen selbst insgesamt neu geordnet werden, denn nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht waren nicht nur das politische System und Staat zusammengebrochen, sondern auch die für das Leben notwendigen Einrichtungen aufgelöst, zerstört oder stark beschädigt. Die Existenzerhaltung der Menschen mußte das absolut vorrangige Ziel der Politik sein. Dem Parlamentarischen Rat, der die Regelungen auszuarbeiten hatte, wurde dieses als „Denkaufforderung“ (= Postulat) gegeben. Sie griffen auf die Erfahrungen zurück, die man im 19. Jahrhundert und insbesondere in und nach Weimar gemacht hatte.
Ihre Ergebnisse wurden im Grundgesetz niedergelegt - es liefert nun die verfassungsrechtli- che Grundlage des Sozialstaats in der BRD. Es enthält eine Reihe von Vorschriften, die dem Staat soziales Handeln gebieten. Die Vorschriften lassen sich in zwei Kategorien zusammen- fassen:
1. das allgemeine Sozialstaatsprinzip und
2. die sozialen Grundwerte.
Die sozialen Grundwerte sind vor allem in der Form von Grundrechten des Bürgers gegenüber dem Staat festgelegt.
1. Sozialstaatsprinzip
Ausdrücklich gefordert wird der soziale Staat nur an zwei Stellen. In Art. 20 Abs. 1 GG wird bestimmt, daß die BRD ein „demokratischer und sozialer Bundesstaat“ ist, und nach Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG muß die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern „den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundge- setzes entsprechen.“ Diese Bestimmungen findet man in ähnlicher Form in den meisten Lan- desverfassungen. Die Formulierung von Art. 20 und - ergänzend - die in Art. 28 wird als So- zialstaatsprinzip bezeichnet. Dieses ist inhaltlich zunächst einmal unbestimmt, deshalb haben Staatsrechtslehre und Rechtsprechung sich schon früh darum bemüht, aus dem Gesamtzu- sammenhang der Verfassungsnormen und der historischen Entwicklung des Sozialstaats eine größere inhaltliche Bestimmtheit abzuleiten.
Dieses Bemühen hat zu dem allgemein anerkannten Ergebnis geführt, daß das Sozialstaats- prinzip den Staat auf zwei allgemeine Ziele verpflichtet. Zum Einen ist dies der soziale Aus- gleich. Hiermit ist gemeint, daß der Staat Unterschiede zwischen sozial schwachen und sozial starken Personen und Personengruppen nicht einfach hinnehmen, sondern möglichst verrin- gern soll. Das zweite Ziel ist die soziale Sicherheit. Dies bedeutet, daß der Staat die Existenz- grundlage ganz allgemein sichern und möglichst auch fördern soll. Unabhängig vom sozialen Ausgleich soll der Staat Daseinsvorsorge betreiben, z. B. durch geeignete Maßnahmen im Bildungs- und Gesundheitswesen, in anderen Bereichen der Sozialpolitik und in der Wirt- schaftspolitik.
2. Soziale Grundwerte
Neben dem ausdrücklichen, aber sehr allgemeinen Gebot zum sozialen Handeln enthält das Grundgesetz eine Reihe von Normen, die den Staat in allgemeiner oder spezieller Form auf bestimmte soziale Grundwerte verpflichten. An erster Stelle steht die in Art. 1 Abs. 1 GG ausgesprochene Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, die Menschenwürde zu achten und zu schützen. Hieraus ergibt sich die Pflicht, bedürftigen Staatsbürgern ein materielles Existenzminimum zu sichern, was im unmittelbaren inhaltlichen Zusammenhang mit der Pflicht zur Daseinsvorsorge und zum sozialen Ausgleich steht.
Auch der Katalog der Grundrechte enthält Normen mit sozialstaatlichem Gehalt. Sie beziehen sich teils auf staatliche Handlungspflichten, teils auf private Handlungsrechte. Von sozialstaatlicher Bedeutung sind vor allem:
- Die Gleichheitssätze des Art. 3 GG: Sie beinhalten das allgemeine Verbot einer willkür- lich ungleichen Behandlung der Staatsbürger, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, sowie das Diskriminierungsverbot. Die Gleichheitssätze verpflichten den Staat, soziale Ungleichheiten zu vermeiden, soweit sie nicht in „wesentlichen“ Unterschieden begründet sind. Die Gleichberechtigungsgrundsätze verpflichten den Staat beispielsweise, bei der Einstellung von Männern und Frauen in den Staatsdienst die gleichen Maßstäbe anzuwen- den und Frauen und Männer gleich zu entlohnen, wenn sie gleiche Arbeit leisten; Ge- schlechterunterschiede gelten nicht als „wesentlicher“ oder akzeptabler Grund für unglei- che Beschäftigungs- und Verdienstchancen.
- Die besondere Pflicht des Staates zum besonderen Schutz von Ehe, Familie und Mutter und zum Schutz der nichtehelichen Kinder in Art. 6 Abs. 1, Abs. 3-5 GG. Sie begründen u. a. Steuererleichterungen der Ehepaare und Familien sowie besondere arbeitsrechtliche Maßnahmen des Mutterschutzes.
- Das Recht für jeden Bürger und alle Berufe, „zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden“ (Art. 9 Abs. 3 GG). Diese Koali- tionsfreiheit enthält die verfassungsrechtliche Garantie für die Arbeitnehmer, sich durch die Bildung von Gewerkschaften eine stärkere Stellung im Arbeitsleben zu verschaffen. Es ist eine spezielle Form des sozialen Ausgleichs, auf den der Staat durch das Sozial- staatsprinzip allgemein verpflichtet wird.
- Die Sozialbindung des Privateigentums durch Art. 14 Abs. 2 GG: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“ Sie verlangt, die in Art. 14 Abs. 1 GG garantierte Freiheit des Privateigentums mit den schutzwürdigen Inte- ressen der Eigentumsbenutzer (z. B. Mieter) in einen gerechten Ausgleich zu bringen.
- Die Möglichkeit, privates Eigentum an Grund und Boden, Naturschätzen und Produkti- onsmitteln gegen Entschädigung „in Gemeineigentum oder in andere Formen der Ge- meinwirtschaft“ zu überführen (Art. 15 GG). Dieser Artikel ist bisher praktisch bedeu- tungslos geblieben, und dient als Ergänzung zu Art. 14.
Rechtsgarantie der Grundrechte
Vergleicht man die Festlegungen im Grundgesetz mit der umfangreichen sozialstaatlichen Zielsetzung in der Weimarer Verfassung, zeigt sich eine deutliche inhaltliche Beschränkung. Allerdings gehen die Verfassungsnormen heute über die früheren in ihrer rechtlichen Bedeu- tung weit hinaus. In Weimar hatten sie den Charakter einer unverbindlichen Zielvorgabe für den Gesetzgeber; im Grundgesetz sind sie als unwiderrufliche und bindende Vorgaben für den Staat formuliert. Die Väter des Grundgesetzes hatten aus den Erfahrungen nach Weimar gelernt, daß es nicht genügt, in die Verfassung bestimmte Grundsätze hineinzuschreiben, wenn nicht sichergestellt ist, daß sie hinterher auch befolgt werden. Deshalb wird der Staat dauerhaft auf bestimmte Grundwerte verpflichtet:
- Die Grundrechte sind unmittelbar geltendes, für Gesetzgebung, Verwaltung und Recht- sprechung bindendes Recht (Art. 1 Abs. 3 GG), das in seinem Wesensgehalt nicht angetastet werden darf (Art. 19 Abs. 2 GG).
- Die Pflicht zur Achtung und zum Schutz der Menschenwürde darf durch Änderungen des Grundgesetzes überhaupt nicht berührt werden (Art. 79 Abs. 3 GG).
- Die gleiche absolute Bestandsgarantie genießt das Sozialstaatsprinzip; denn nach Art. 79 Abs. 3 GG ist eine Änderung des Grundgesetzes unzulässig, welche die in Art. 20 niedergelegten Grundsätze berührt, und zu diesen Grundsätzen gehört, daß die Bundesrepublik ein sozialer Staat ist.
Gerade das Sozialstaatsprinzip hat damit einen besonders herausgehobenen verfassungsrechtlichen Rang; es gehört ebenso wie die Grundsätze der Demokratie, der Republik, des bundesstaatlichen Aufbaus und des Rechtstaates zu den Staatsfundamentalnormen.
Angesichts der starken rechtlichen Stellung des Sozialstaatsprinzips hat man sich oft gefragt, warum es inhaltlich so wenig bestimmt worden ist. Dafür gibt es eine einfache Erklärung. Die Väter des Grundgesetzes wollten den Staat zwar unwiderruflich auf bestimmte Grundwerte verpflichten; die Idee der sozialen Gerechtigkeit, die mit dem Sozialstaatsziel angesprochen ist, läßt sich aber in ihrem konkreten Inhalt gar nicht ein für allemal verbindlich fassen. Was als sozial gerecht erscheint, hängt immer auch ab von der historischen Situation und von dem Bewußtsein, in dem die Menschen den jeweiligen gesellschaftlichen und wirtschaftlichtechni- schen Entwicklungen gegenübertreten. Man war sich beim Formulieren des Grundgesetzes nur über die Fortdauer der Gesetze einig, eine zu konkrete Formulierung hätte aber mögli- cherweise eine Anpassung an spätere Bedürfnisse verbaut. Der Verfassungsgrundsatz des sozialen Staates ist deshalb in erster Linie zu sehen als verbindlicher Auftrag an den Gesetz- geber, insbesondere die Sozialordnung immer wieder zielbewußt und sachlich gerecht festzu- legen.
II. Sozialstaat und Rechtsstaat
Bisher wurde das Sozialstaatsprinzip isoliert betrachtet. Das Grundgesetz will aber den - de- mokratisch und föderativ aufgebauten - sozialen Rechtsstaat. Sozialstaat und Rechtsstaat sind zwei Verfassungsgrundsätze, die gemeinsam verwirklicht werden müssen. Dieses Verfas- sungsgebot war anfangs heftig umstritten, und auch heute sind noch nicht alle Fragen restlos geklärt.
Das Rechtsstaatsprinzip verlangt, vereinfacht ausgedrückt, daß der Staat kein Unrechtsstaat sein soll. Er soll seine Bürger nicht willkürlich, sondern rechtmäßig, das heißt gemäß den gel- tenden Rechtsnormen behandeln, und in den Rechtsnormen selbst soll Gerechtigkeit walten. Man bezeichnet das erste oft als formale, das zweite als materiale oder inhaltliche Seite des Rechsstaats.
Formale Rechtsstaatlichkeit
Kaum umstritten war die Verbindung von Sozialstaat und formaler Rechtsstaatlichkeit. Formale Rechtsstaatlichkeit entsteht im wesentlichen dadurch, daß die gesamte staatliche Gewalt in wirksamer Weise an das geltende Recht gebunden wird. Die Bindung schafft Rechtssicherheit; sie verlangt ihrerseits vor allem Rechtsschutz und Unabhängigkeit der Justiz.
Die formale Seite des Rechtsstaates besteht aus bestimmten Spielregeln bzw. Verfahrensvorschriften dafür, wie Gesetze gemacht, angewandt und auf ihre Einhaltung kontrolliert werden sollen. Die Wendung „sozialer Rechtsstaat“ heißt hier, daß das sozialstaatliche Handeln den Spielregeln gehorchen muß, die den formalen Rechtsstaat kennzeichen; der Sozialstaat ist in den Formen des Rechtsstaates zu verwirklichen.
Materielle Rechtsstaatlichkeit
Umstritten war dagegen die Verbindung von Sozialstaat und Rechtsstaat im materiellen Sin- ne. Materielle Rechtsstaatlichkeit entsteht durch die Bindung der Staatsgewalt an bestimmte Grundwerte, in denen sich die Vorstellungen von gerechter Gesellschaftsordnung äußern. Das Grundgesetz knüpft in erster Linie an die klassischen liberalen Grundwerte der persönlichen Freiheit und rechtlichen Gleichheit an. Es enthält in Art. 1 das Bekenntnis zu den unveräußer- lichen Menschenrechten, und es gewährleistet in den nachfolgenden Grundrechten vor allem Freiheit und Gleichheit: Freiheit, indem es konkrete Rechte auf Selbstentfaltung und Selbst- bestimmung einschließlich der Privateigentumsgarantie als einklagbare Rechte des Bürgers gegenüber dem Staat formuliert; Gleichheit, indem es namentlich in Art. 3 Abs. 1 GG dem Staat in allgemeiner Weise gebietet, wesentlich Gleiches auch gleich zu behandeln und damit eine elementare Forderung des Rechtsgefühls zu verwirklichen. Der Grundrechtskatalog ent- hält aber auch eine Reihe sozialstaatlicher Normen; darüber hinaus ist alle staatliche Gewalt an den Grundsatz des sozialen Staates gebunden. Der Rechtsstaat nach dem Grundgesetz soll also sowohl liberal als auch sozial sein; das Grundgesetz will die inhaltliche Anfüllung des klassischen Rechtsstaates unter dem Gesichtspunkt der sozialen Gerechtigkeit.
Gegen diese Forderung wurde hauptsächlich eingewandt, daß die klassischen Grundrechte den Staat daran hindern sollen, in die garantierten Freiheitsräume des Bürgers einzudringen, daß sie Abwehrrechte des Bürgers gegen Staatseingriffe sind, während der Sozialstaat gerade umgekehrt den gebenden und nehmenden Staatseingriff fordert, weil er dem Bürger Ansprü- che auf soziale Leistungen und Teilhabe einräumt. Sozialstaat und Rechtsstaat seien deshalb ihrem Wesen nach Gegensätze. Die Sozialstaatsklausel sei doch wohl mehr oder weniger zu- fällig in den nach Art. 79 Abs. 3 GG unveränderlichen Teil des Grundgesetzes hineingeraten, und der volle Schutz der Verfassung erstrecke sich nur auf die uneingeschränkte Sicherung des im klassischen Sinne verstandenen Rechtsstaates. Ernst Forsthoff, ein konservativer Staats- und Verwaltungsrechtslehrer, kommt zu dem Schluß, daß der Rechtsstaat „nach der Ordnung des Grundgesetzes der Primäre und mit allen Rechtsgarantien ausgestattete Wert“ ist. „Eine Verbindung von Rechtsstaat und Sozialstaat unter Kürzung der rechtsstaatlichen Verfassungselemente ist durch das Grundgesetz ausgeschlossen.“
Individuelle Freiheit und sozialer Ausgleich
Diese Auffassung wird heute ganz überwiegend nicht mehr geteilt, zumindest nicht mehr in dieser Strenge. Sei verweist zwar auf mögliche Konkurrenzbeziehungen zwischen den Zielen der individuellen Freiheit und des sozialen Ausgleichs, geht aber in ihrem kompromißlosen Entweder-Oder entschieden zu weit, und zwar vor allem aus zwei Gründen:
- Auch die klassischen Grundrechte verbürgen eine bestimmte Form der sozialen Teilhabe, nämlich die Teilhabe an rechtlichen Möglichkeiten der Entscheidung und Selbstbestimmung, die vorher nur wenigen offenstanden. Der liberale Rechtsstaat war ein wichtiger Schritt zum gerechten Staat, weil er allen Bürgern ein grundsätzlich gleiches Maß an rechtlicher Entfaltungsfreiheit einräumte. Das bedeutete zugleich, daß bestimmte Gruppen ihre überkommenen Standesprivilegien verloren und damit eine bestimmte Form sozialer Ungleichheit verschwand, nämlich die Ungleichheit im staatsbürgerlichen Status. Der freie Zugang zu Ausbildung und Beruf und die Ausweitung der Vereinigungsfreiheit auf Arbeitnehmer bzw. Gewerkschaften sind dafür gute Beispiele.
- Gleiche rechtliche Entfaltungsfreiheit heißt nur Gleichheit des rechtlichen Dürfens; Un- gleichheiten im Können bleiben hier gänzlich unbeachtet. Man spricht deshalb auch von einer Gleichheit der formalen Freiheit. Daß sie für einen gerechten Staat zu wenig ist, zeigt der sarkastische Satz von der „majestätischen Gleichheit der Gesetze, welche den Reichen wie den Armen verbietet, unter den Brücken zu schlafen, auf den Straßen zu bet- teln und Brot zu stehlen“ (Anatole France). Gerade hier liegt der besondere Ansatzpunkt des sozialen Rechtsstaats: Er sichert nicht nur rechtliche Freiheit und Gleichheit und über- läßt den einzelnen ansonsten seinem Schicksal, sondern sucht nach Kräften auch die mate- riellen Voraussetzungen dafür zu verbessern, daß der einzelne tatsächlich tun kann, was er tun darf. Der soziale Rechtsstaat führt insoweit den klassischen liberalen Rechtsstaat inhaltlich weiter.
Die Bindung des Staates an liberale und soziale Grundwerte ist sicherlich unterschiedlich stark. In der Regel haben nur jene Grundwerte den Rang unmittelbarer Rechtsansprüche des Bürgers gegenüber dem Staat, die als Grundrechte formuliert sind; das sind im wesentlichen die klassischen Menschenrechte. Aus dem Sozialstaatsprinzip läßt sich dagegen nur in ausnahmefällen ein unmittelbar einklagbarer oder mit der Verfassungsbeschwerde zu wahrender Rechtsanspruch des Bürgers auf staatliche Leistungen herleiten.
Als ein solcher Ausnahmefall gilt bisher nur die allgemeine Verpflichtung des Staates, seinen Bürgern ein materielles Existenzminimum zu sichern. Diese Verpflichtung folgt schon aus der umfassenden Pflicht des Staates, die Menschenwürde zu achten und zu schützen.
III. Die Verwirklichung des Sozialstaatsgebots
Das Grundgesetz sagt nur wenig darüber, worin das Soziale am sozialen Rechtsstaat besteht; es beauftragt im wesentlichen den Gesetzgeber, festzulegen, auf welche Weise und in wel- chem Umfang den Zielen des sozialen Ausgleichs und der Daseinsvorsorge entsprochen wer- den soll. Mit anderen Worten: Der Sozialstaat ist im Grundgesetz nur andeutungsweise und vor allem in seiner Zielrichtung geregelt; der Sozialstaat nach oder gem äß dem Grundgesetz entsteht erst durch politische Entscheidungen, die das Sozialstaastsgebot inhaltlich konkreti- sieren. Diese Entscheidungen sind nicht auf einen bestimmten Politikbereich beschränkt, son- dern grundsätzlich universell in dem Sinne, daß sich die Ziele der Angleichung unterschiedli- cher Lebenschancen und der Sicherung oder Verbesserung von Lebensbedingungen auf ganz verschiedenen Lebensgebieten und mit ganz verschiedenen Mitteln anstreben lassen. Der Staat hat ein Mandat zu einer allgemeinen Gesellschaftspolitik, die alle herkömmlichen Poli- tikbereiche umfaßt, soweit sie an den genannten Zielen orientiert sind.
Für die Bereiche sozialstaatlicher Entscheidungen gibt das Grundgesetz selbst einige Hinwei- se. Die Art. 73 und 74 enthalten einen ganzen Katalog von Gesetzgebungsbereichen, der von öffentlicher Fürsorge, Sozialversicherung, Arbeitsrecht einschließlich Betriebsverfassung bis hin zum Verkehrswesen, Gesundheitswesen, Umweltschutz und zur Verhütung des Mißbrauchs wirtschaftlicher Machstellungen reicht. Zusätzlich genannte Staatsaufgaben be- ziehen sich auf den Bildungsbereich, die regionale Wirtschaftsstruktur und die Agrarstruktur (Art. 91a, b) und die Sicherung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts (Art. 109 Abs 2ff.). Schon diese - unvollständigen - Hinweise lassen exemplarisch die Breite des sozial- staatlichen Handlungsspektrums erkennen.
Die inhaltliche Offentheit des Sozialstaatsprinzips gibt den unterschiedlichen Kräften in besonderem Maße die Möglichkeit, über die verfassungsmäßige Beiteiligung an der politischen Willensbildung ihre Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit und sozialstaatlichem Handeln zur Geltung zu bringen. Das gilt in erster Linie für die politischen Parteien. Ihre sozialstaatlichen Vorstellungen sind regelmäßig niedergelegt in Parteiprogrammen, die in der Form von Grundsätzen, Leitlinien oder Orientierungsrahmen die Wähler informieren und der politischen Tagesarbeit eine längerfristige Ausrichtung geben sollen.
Quellenangaben:
(1) Informationen zur politischen Bildung Nr. 215: Der Sozialstaat, Bonn 1987
(2) Kontrovers: Soziale Sicherung, Bonn 1994
(3) Veröffentlichungen der deutschen Staatsrechtslehrer, Heft 12, Walter de Gruyter, Berlin 1954, S. 8 ff.
(4) Das Grundgesetz
Soziale Grundwerte
Artikel 3
[Gleichheit vor dem Gesetz; Gleichberechtigung von Männern und Frauen; Diskriminierungsverbot]
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachtei- le.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt wer- den.
Artikel 6
[Ehe und Familie; nichteheliche Kinder]
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahlrosen drohen.
(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.
(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.
Artikel 9
[Vereinigungs-, Koalitionsfreiheit]
(2) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu vehindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden.
Artikel 14
[Eigentum, Erbrecht, Enteignung]
(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.
(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.
Artikel 15
[Sozialisierung]
Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Abs. 3 Satz 3 und 4 entsprechend.
Verfassungsrechtliche Grundlagen des Sozialstaats
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Rechtsgarantie der Grundrechte
Artikel 1
[Menschenwürde; Grundrechtsbindung der staatlichen Gewalt]
(3) Die Nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.
Artikel 19
[Einschränkung von Grundrechten; Wesensgehalts-, Rechtswegegarantie]
(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.
Artikel 79
[Änderung des Grundgesetzes]
(3) Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig.
Artikel 20
[Staatsstrukturprinzipien; Widerstandsrecht]
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtspre- chung ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das verfassungsrechtliche Sozialstaatsgebot?
Nach dem Zweiten Weltkrieg musste das Verhältnis von Bürger und Staat neu geordnet werden. Das Grundgesetz bildet die verfassungsrechtliche Grundlage des Sozialstaats in der BRD und enthält Vorschriften, die dem Staat soziales Handeln gebieten. Diese Vorschriften lassen sich in das allgemeine Sozialstaatsprinzip und die sozialen Grundwerte unterteilen. Die sozialen Grundwerte sind vor allem in Form von Grundrechten des Bürgers gegenüber dem Staat festgelegt.
Was ist das Sozialstaatsprinzip?
Das Sozialstaatsprinzip, formuliert in Art. 20 Abs. 1 und Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG, verpflichtet den Staat auf zwei allgemeine Ziele: sozialen Ausgleich und soziale Sicherheit. Der soziale Ausgleich zielt darauf ab, Unterschiede zwischen sozial schwachen und sozial starken Personen zu verringern. Soziale Sicherheit bedeutet, dass der Staat die Existenzgrundlage sichert und fördert, unabhängig vom sozialen Ausgleich.
Welche sozialen Grundwerte sind im Grundgesetz verankert?
Neben dem Sozialstaatsprinzip enthält das Grundgesetz Normen, die den Staat auf bestimmte soziale Grundwerte verpflichten. An erster Stelle steht die Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG). Der Katalog der Grundrechte enthält Normen wie Gleichheitssätze (Art. 3 GG), den Schutz von Ehe, Familie und Mutter (Art. 6 GG), die Koalitionsfreiheit (Art. 9 Abs. 3 GG), die Sozialbindung des Privateigentums (Art. 14 Abs. 2 GG) und die Möglichkeit der Sozialisierung (Art. 15 GG).
Welche Rechtsgarantie haben die Grundrechte?
Im Gegensatz zur Weimarer Verfassung sind die Verfassungsnormen im Grundgesetz bindend. Die Grundrechte sind unmittelbar geltendes Recht (Art. 1 Abs. 3 GG), das in seinem Wesensgehalt nicht angetastet werden darf (Art. 19 Abs. 2 GG). Die Pflicht zur Achtung der Menschenwürde und das Sozialstaatsprinzip genießen absoluten Bestandsschutz (Art. 79 Abs. 3 GG).
Wie verhalten sich Sozialstaat und Rechtsstaat zueinander?
Das Grundgesetz will den sozialen Rechtsstaat. Der Rechtsstaat verlangt, dass der Staat seine Bürger rechtmäßig behandelt und in den Rechtsnormen selbst Gerechtigkeit waltet (formale und materielle Rechtsstaatlichkeit). Der soziale Rechtsstaat sichert nicht nur rechtliche Freiheit und Gleichheit, sondern verbessert auch die materiellen Voraussetzungen dafür, dass der Einzelne tun kann, was er tun darf.
Wie wird das Sozialstaatsgebot verwirklicht?
Das Grundgesetz beauftragt den Gesetzgeber, festzulegen, wie und in welchem Umfang den Zielen des sozialen Ausgleichs und der Daseinsvorsorge entsprochen werden soll. Der Sozialstaat entsteht durch politische Entscheidungen, die das Sozialstaatsgebot konkretisieren. Das Grundgesetz gibt Hinweise auf Bereiche sozialstaatlicher Entscheidungen wie öffentliche Fürsorge, Sozialversicherung, Arbeitsrecht, Gesundheitswesen und Umweltschutz (Art. 73, 74, 91a, b, 109 Abs. 2ff. GG).
- Quote paper
- Marike Schneider (Author), 2001, Das Sozialstaatspostulat, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102807