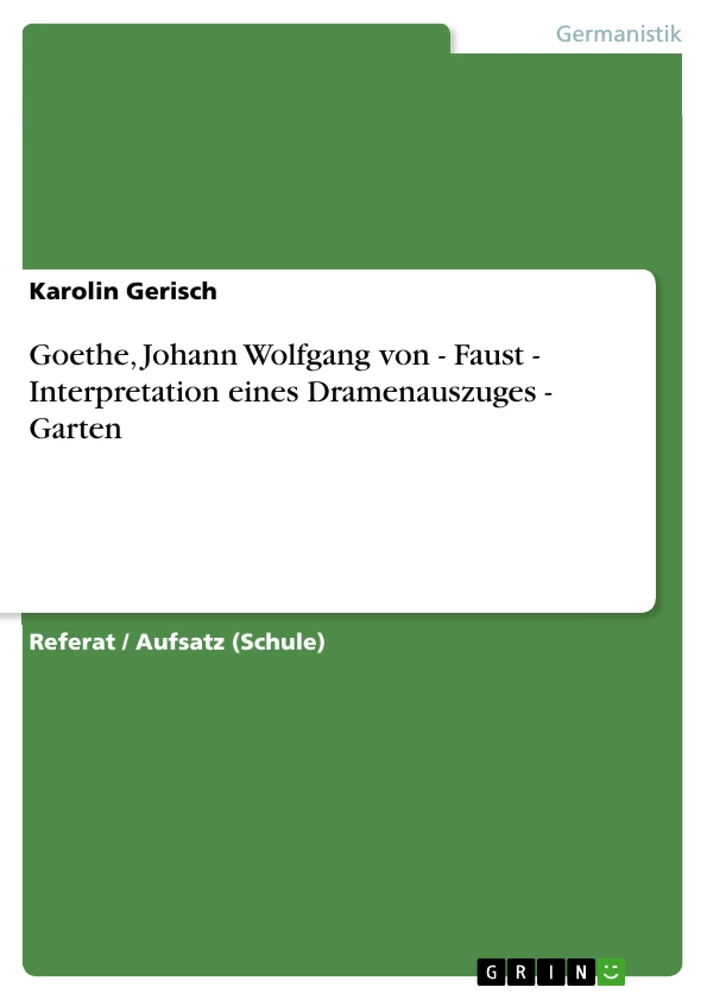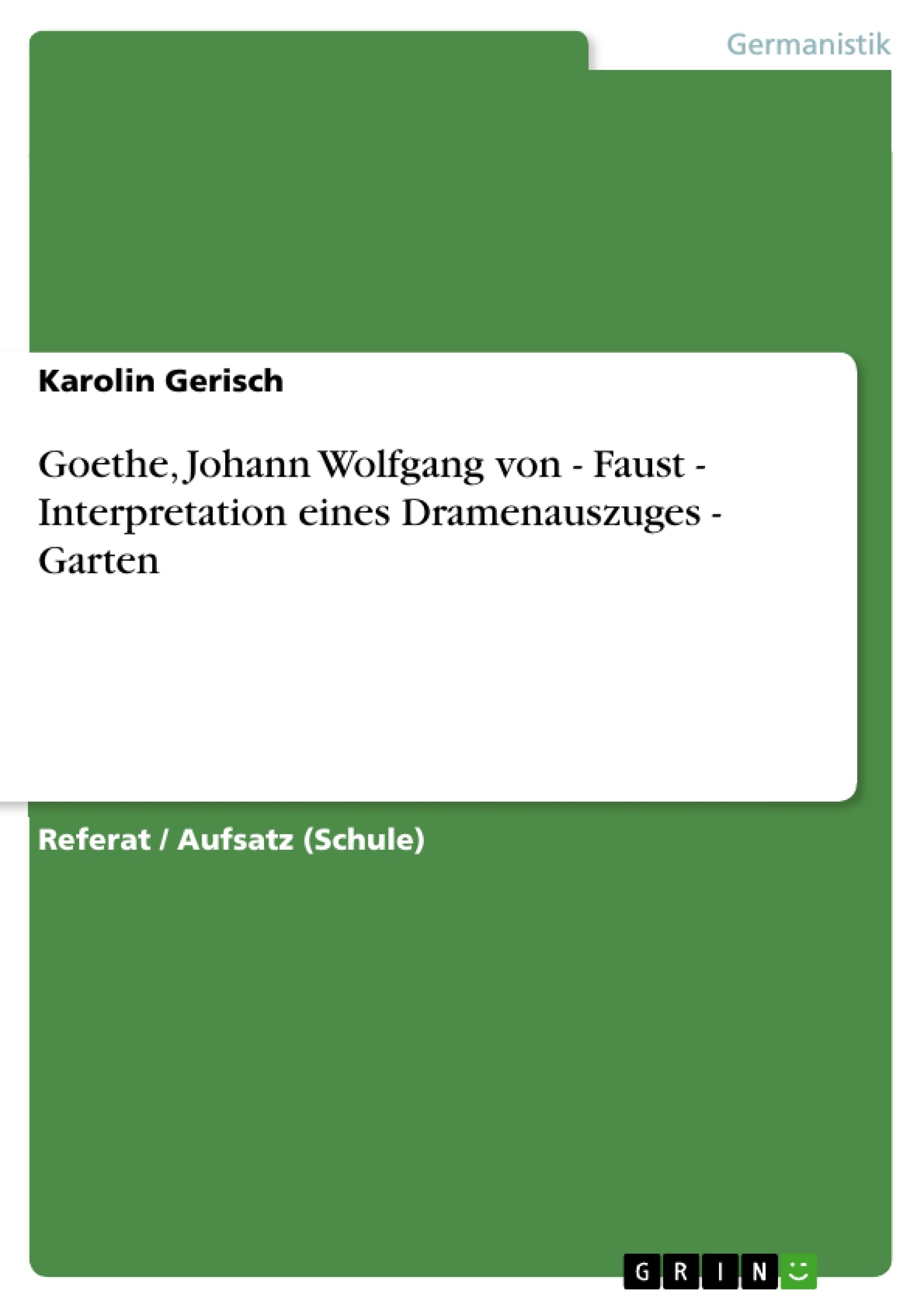Was ist der Preis der Verführung, und wer zahlt ihn? In Goethes "Faust I", inmitten der idyllischen Kulisse eines Gartens, entfaltet sich ein gefährliches Spiel aus Begierde und Manipulation. Der verjüngte Faust, getrieben von neu entfachter Lebenslust, begegnet der unschuldigen Margarete, einem jungen Mädchen, dessen Reinheit ihn magisch anzieht. Doch im Schatten dieser zarten Begegnung spinnt Mephisto seine Fäden, um Faust vom Pfad der Erkenntnis abzubringen und ihn dem sinnlichen Genuss zu unterwerfen. Die Szene "Garten" wird zum Schauplatz einer doppelten Verführung: Während Faust um Margaretes Gunst wirbt, bahnt sich zwischen der Nachbarin Marthe und dem intriganten Mephisto eine zwielichtige Allianz an. Marthe, auf der Suche nach einem Ehemann, lässt sich bereitwillig auf Mephistos Spiel ein, ohne die dunklen Absichten zu ahnen, die hinter seinem höflichen Äußeren verborgen liegen. Margarete, hin- und hergerissen zwischen bürgerlicher Bescheidenheit und der aufkeimenden Zuneigung zu Faust, offenbart in ihren Monologen eine innere Zerrissenheit, die sie zur leichten Beute für seine Verführungskünste macht. Faust selbst, einst ein Gelehrter auf der Suche nach Wissen, scheint in der Begegnung mit Margarete seine Ideale zu verraten, indem er ihr mit wortgewaltigen Liebesbekundungen den Hof macht. Doch ist seine Zuneigung echt, oder ist Margarete lediglich ein weiteres Mittel zum Zweck in Mephistos teuflischem Plan? Die Dialoge zwischen den Paaren sind gespickt mit Andeutungen und versteckten Absichten, die die drohende Katastrophe bereits erahnen lassen. Kuppelei, verbotene Begierde und der Verlust der Unschuld sind die zentralen Themen dieser Schlüsselszene, die den Leser in einen Strudel aus Leidenschaft, Intrigen und moralischen Abgründen zieht. Entdecken Sie, wie die Versuchung das Schicksal von Faust und Margarete besiegelt, und welche Rolle Mephisto in diesem perfiden Spiel spielt. Tauchen Sie ein in die Welt von "Faust I" und erleben Sie die zeitlose Kraft von Goethes Meisterwerk, eine Geschichte über die ewige Suche nach Glück, die Gefahren der Verführung und die dunklen Seiten der menschlichen Natur. "Faust" ist mehr als nur ein Drama; es ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit den großen Fragen des Lebens und ein Spiegelbild unserer eigenen inneren Konflikte. Lassen Sie sich von Goethes Sprache verzaubern und von der Geschichte in ihren Bann ziehen. Ein Muss für jeden Liebhaber der deutschen Klassik und für alle, die sich für die Abgründe der menschlichen Seele interessieren. Die Tragödie nimmt ihren Lauf, und der Garten wird zum Ort des Sündenfalls.
Interpretation eines Dramenauszugs Faust I - „Garten”
Gut oder Böse? Welche Seite ist im Menschen stärker? Diese Frage versucht Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) in seinem Lebenswerk, der Tragödie „Faust”, durch die Wette des Herrn und Mephisto um den Doktor „Faust” zu beantworten. Dabei läßt er das Geschehen wahrscheinlich im 18. oder 19. Jahrhundert abspielen - seiner Zeit. Einer Zeit, in der Goethe noch jung war und dem Sturm & Drang angehörte. So ist auch dieses Werk ein Zeugnis von den Idealen dieser Literaturrichtung: Gleichheit von Verstand und Gefühl.
In „Faust I” dreht sich die gesamte Handlung um die im Prolog zwischen Herrn und Mephistopheles getroffene Wette, in der es um den strebenden Menschen mit seinen Fehlern geht und wie leicht - oder Faust schwer - es ist, ihn von seinen Bestrebungen auf den falschen, auf Mephisto Weg zu bringen. In der Szene „Garten”, welche sich im „Garten” der Nachbarin Margaretes, Marthe, abspielt, lernen sich der verjüngte Faust und das unschuldige Mädchen Margarete kennen. Sie ist hierbei das Mittel, welches Mephisto zur Verführung von Faust vom Wissensdrang zum Genussstreben benutzt. In dieser Szene werden die 2 Hauptfiguren von Marthe und Mephisto begleitet und auch beobachtet. Margarete erzählt Faust dabei von ihrem bisherigen Leben, welches sie, in einem Reflexionsmonolog, als beschwerlich und doch angenehm (V. 3147f) bezeichnet. Während sich die beiden so unterhalten - obwohl Margarete dabei den meisten Redeanteil hat - wird bei Marthe und Mephisto schon eifrig geflirtet (V.3149 - V.3163). Gegen Ende der Szene erfolgt Margaretes indirekter Liebesbeweis, indem sie „mit holder Freude” (V.3183/Regieanweisung) „Er liebt mich!” (V.3183) ausruft. Weiterhin geschehen Andeutungen auf die zukünftige Katastrophe durch Faust und der Dialog zwischen Marthe und Mephisto, in welchem direkt auf Kupplerei angesprochen wird, beendet die Szene. Im nachfolgenden Teil von „Faust” sieht man, das Mephisto seine Wette verliert und er Faust, trotz Margarete, nicht vom Wissensdrang abbringen kann.
Im „Garten” stehen sich die zwei Pärchen Faust-Margarete und Mephisto-Marthe gegenüber.
Margarete beginnt mit einem kurzen Affektmonolog, in welchem sie ihre Gefühle („fühl”,V.3073) vor Faust hinsichtlich seines Benehmens als „Herr” (V.3073) vor ihr - einer Bürgerlichen - ausbreitet und dabei erkennen läßt, dass es mit ihrem Selbstwertgefühl nicht gut bestellt ist. So bezeichnet sie ihren Unterhaltungsteil - der im Vergleich zu Fausts groß ist - als „arm Gespräch” (V.3079) und benutzt dabei eine Personifikation, d.h. sie gibt dem „Gespräch” eine menschliche Eigenschaft (hier: Armut). Damit unterstreicht sie gleichzeitig die Ständeunterschiede, welche zwischen ihr und Faust herrschen. Dasselbe hat ihr Reflexionsmonolog (V.3109 - V.3123) zur Wirkung. Durch die nähere Beschreibung ihres Lebens - die „Wirtschaft” welche sie mit ihrer Mutter betreibt (V.3109), ihre dort zu verrichtenden Tätigkeiten, sei es „kochen, fegen, stricken [oder] nähn” (V.3111f) oder die Verringerung des Wertes durch das Suffix „-chen” bei „Häuschen und [...] Gärtchen” - zieht sie, bewußt oder unbewußt, Grenzen zwischen sich und Faust. Aussagen, wie „So lieb war mir das Kind” (V.3124) lassen erkennen, dass Margarete Kinder liebt und sie die Erziehung ihrer toten Schw ester (V.3123) genossen hat (V.3136f), auch wenn sie „mit dem Kind wohl [ihre] liebe Not” (V.3122) hatte. Dieses Qxymoron „liebe Not” zeigt, wie widersprüchlich sich ihr Leben abspielte. Sie mußte den Vater und die Schwester sterben sehen (V.3121, V.3126), mußte mit dem Glauben leben, dass ihre Mutter die Geburt des letzten Kindes nicht überleben könne (V.3127 - V.3129) und doch kann sie ihrem Leben positive Seiten abgewinnen. Das zeigt, das Margarete trotz ihres mangelnden Selbstvertrauens eine innere Stärke besitzt, die nicht viele besitzen. Mangelndes Selbstwertgefühl läßt sie auch dauernd an sich selbst zweifeln, was in ihrem Affektmonolog von Vers 3169 bis Vers 3183 erkennbar ist. Dort berichtet sie Faust von ihren Gefühlen, die sie bewegten, als er sie so unverhofft in der Szene „Straße I” anspricht. Selbstzweifel („hat er in deinem Betragen was Freches, Unanständiges gesehn?” V.3172f) sind da am stärksten. Schüchternheit läßt sich bei ihr auch finden. So in dem Aussagesatz”Ich schlug die Augen nieder” (V.3165).
Faust hat in der ganzen Szene als Hauptfigur relativ wenig zu sagen - wahrscheinlich ist es die Unkenntnis, sich mit anderen Leuten zu unterhalten, da er ja als Professor ein Menschenfeind gewesen ist oder die Tatsache, dass er in Gegenwart Margaretes nur noch auf die Verführung derselbigen hinarbeitet und deswegen so einsilbig wie „Ihr seid wohl viel allein?” (V.3108) ist. Denn wenn man diese Frage liest, kommt einem Faust nicht interessiert, eher desinteressiert, vor. Auf Margaretes sich im ersten Textabschnitt bemerkbar machendes mangelndes Selbstvertrauen, entgegnet Faust mit der Hyperbel „Ein Blick von dir, ein Wort mehr unterhält als alle Weisheit dieser Welt” (V.3079f) eigentlich eine Verleugnung seiner früheren Bestrebungen nach Wissen. Denn es ist kaum vorstellbar, dass die ungebildete Margarete einen Faust, welcher Wissen förmlich in sich aufsaugt, auf Dauer unterhält und fesselt. Darum besteht auch die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Ausspruch ironisch, d.h. nicht so gemeint ist, wie es klingt, ausgesprochen wird. Mit der Apostrophe „O Beste!” (V.3100) möchte Faust seinem Umwerben mehr Nachdruck verleihen, sie - in ihren Augen - auf ein Podest stellen und wahrscheinlich von ihren zuvor geäußerten Lobpreisungen auf andere „Freunde” (V.3098) abbringen. In den nur kurzen Redepassagen Fausts erkennt man seine Nicht-Beteiligung am Gespräch, sein mangelndes Eingehen auf Margarete. Nur im letzten ihrer insgesamt 3 Gesprächsanteile in der Szene kommt während der Unterhaltung Spannung, eine gewisse Eile, durch die Stichomythien, in welcher Faut seine Unkenntnis von normalerweise alltäglichen Dingen zeigt. Seine frühere Abgeschottenheit (Szene „Nacht”) macht sich bemerkbar, als Margarete anfängt, die Blätter einer Blume abzurupfen (V.3179/Regienanweisung) und er die für Verliebte typische Tätigkeit nicht (er-)kennt. Ein Indiz für das Nicht-Vorhandensein seiner Liebe zu Gretchen, das in Vers 3185 („Er liebt dich!”) unterstützt wird. Da das Personalpronomen „er” und nicht „ich” lautet, kann damit jeder Mann auf Erden, und nicht zwingend der Sprecher - Faust - sein. In dieser Doppeldeutigkeit und durch seinen einzigen längeren Monolog am Ende des dritten Gesprächsparts der beiden, in welchem er die Katastrophe - die bei Beginn einer Affäre unausweichlich kommen muß - erkennt („Ihr Ende würde Verzweiflung sein.” V.3193), zeigt sich sein hoher Bildungsgrad. Aber auch sein Bildungsstand bring ihn nicht von seiner Begierde auf Margarete ab - nein, er macht ihr die Liebeslust noch durch Ausrufesätze wie: „Lass diesen Blick, lass diesen Händedruck dir sagen, was unaussprechlich ist: Sich hinzugeben ganz und eine Wonne zu fühlen, die ewig sein muss!” (V.3188 - V.3192) schmackhaft.
Da die Szene „Garten” sichtbar in 6 Teile gegliedert ist und der Gesprächsteil von Faust und Margarete 3 umfasst, sind die anderen 3 Teile die Gespräche zwischen Marthe und Mephisto. Dabei wechseln sich die 2 Gesprächspartner immer ab. Da Faust und Margarete die Szene mit Margaretes Bemerkung beginnen, wird der „Garten” durch Marthe und Mephisto beendet.
Zu Beginn unterhalten sich Marthe und Mephisto noch um Belanglosigkeiten, so unter anderem um Mephistos Reiselust (V.3085), die er durch die Metapher „das Gewerb und Pflicht uns dazu treiben” (V.3086) nicht allzu ernst beschreibt, das heißt, dass er die ihm von Marthe gestellte Frage „Und Ihr, mein Herr, Ihr reist so immer fort?” geschickt umgeht und es mit den Anspielungen seitens Marthe um sein unstetes Leben genauso hält. Indirekte Aufforderungen, wie z.B. sesshaft zu werden (V.3092f), beantwortet er zweideutig und läßt Marthe sich ihre Deutung raussuchen. Nachdem Faust und Margarete ihren zweiten Part haben, wird Marthe dann schon deutlicher und spielt in einer Distichomythie (V.3149 - V.3156) offen auf die Liebe und Heirat an. Mit den Worten „Ein Hagestolz ist schwerlich zu bekehren” (V.3150) meint sie eine Heirat, zum Beispiel mit ihr. Mephisto provoziert sie durch seine nachfolgenden Worte, es doch zu probieren, ob sie ihn nicht durch Taten ihrerseits umstimmen könne (V.3151f). Marthes
Frage, ob sein „Herz nicht irgendwo gebunden” (V.3154) sei, bedient sich eines Symbols, das „Herz” für Liebe. In der darauffolgenden Stichomythie erfolgt eine Spannungssteigerung - hervorgerufen durch den schnellen Wechsel von Rede und Gegenrede - in der dann offen über ein mögliches Verhältnis gesprochen wird, was Mephisto mit den Worten „Doch ich versteh - dass ihr sehr gütig seid.” (V.3163) annimmt. Im letzten Teil der Szene „Garten wird dann aber nicht mehr von sich selbst, sondern über Faust und Margarete geredet. „Und unser Pärchen?” (V.3202) ist nichts weiter als eine Frage von Marthe an Mephisto, ob sie zusammen sind oder ob da noch nachgeholfen werden muß, erkennbar an der letzten Stichomythie zwischen den beiden und des Dialogs: Marthe „Er scheint ihr gewogen.” Mephisto „Und sie ihm auch.” (V.3205f)
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Hauptthematik der Gartenszene in Goethes Faust I?
Die Gartenszene in Faust I dreht sich um die erste Begegnung zwischen Faust und Margarete (Gretchen), inszeniert durch Mephisto. Hauptthemen sind Verführung, die Auseinandersetzung zwischen Verstand und Gefühl, das Aufeinandertreffen verschiedener sozialer Stände und die beginnende Tragödie, die sich aus der Beziehung zwischen Faust und Margarete entwickelt. Kupplerei spielt ebenfalls eine Rolle.
Welche Rolle spielt Mephisto in der Gartenszene?
Mephisto ist der Strippenzieher, der die Begegnung zwischen Faust und Margarete arrangiert. Er begleitet Faust und beobachtet die Interaktion. Gleichzeitig flirtet er mit Marthe, Margaretes Nachbarin, um von Fausts Absichten abzulenken und die Verführung zu erleichtern.
Wie wird Margarete in der Gartenszene dargestellt?
Margarete wird als ein unschuldiges, bürgerliches Mädchen dargestellt. Sie ist schüchtern, zweifelt an sich selbst und reflektiert über ihr einfaches Leben. Trotz ihrer Unsicherheit zeigt sie eine innere Stärke und positive Lebenseinstellung.
Wie verhält sich Faust in der Gartenszene?
Faust ist eher einsilbig und desinteressiert, was wahrscheinlich auf seine frühere Isolation als Gelehrter oder seine Konzentration auf die Verführung Margaretes zurückzuführen ist. Er macht ihr Komplimente, die jedoch teilweise ironisch wirken können. Er erkennt die potenziellen tragischen Konsequenzen seiner Handlungen, wird aber dennoch von seiner Begierde nach Margarete getrieben.
Welche Bedeutung hat Marthe in der Gartenszene?
Marthe dient als Kupplerin und Gesprächspartnerin für Mephisto. Ihre Unterhaltungen mit Mephisto verdeutlichen das Thema Kupplerei und die Verlockung des Verbotenen. Sie ist auch neugierig auf die Beziehung zwischen Faust und Margarete.
Was sind die wichtigsten sprachlichen Mittel, die in der Gartenszene verwendet werden?
Es werden verschiedene sprachliche Mittel eingesetzt, darunter Monologe (von Margarete), Hyperbeln (von Faust), Personifikationen (von Margarete), Oxymoron (von Margarete), Apostrophen (von Faust), Stichomythien (zwischen Faust und Margarete sowie zwischen Marthe und Mephisto) und Metaphern (von Mephisto). Diese Mittel tragen zur Charakterisierung der Figuren und zur Verdeutlichung der thematischen Schwerpunkte bei.
Wie ist die Gartenszene strukturiert?
Die Szene ist in sechs Teile gegliedert, wobei sich die Gespräche zwischen Faust und Margarete und zwischen Marthe und Mephisto abwechseln.
Welche Rolle spielt das Thema der Ständeunterschiede in der Gartenszene?
Die Ständeunterschiede zwischen Faust und Margarete werden durch Margaretes Reflexionen über ihr einfaches Leben und ihre Selbsteinschätzung als "arm" betont. Dies unterstreicht die soziale Kluft, die ihre Beziehung erschwert.
Gibt es Andeutungen auf zukünftige Ereignisse in der Gartenszene?
Ja, es gibt Andeutungen auf die zukünftige Katastrophe durch Fausts Begierde und die Kuppelei, die letztendlich zu Margaretes Unglück führen wird. Faust selbst erkennt die potenziellen tragischen Konsequenzen am Ende der Szene.
Welche Bedeutung hat Margaretes Ausruf "Er liebt mich!"?
Margaretes Ausruf ist ein indirekter Liebesbeweis und ein Ausdruck ihrer Freude über Fausts Zuneigung. Die Doppeldeutigkeit des Personalpronomens "er" lässt jedoch offen, ob sich ihre Aussage tatsächlich auf Faust bezieht oder eine allgemeine Sehnsucht nach Liebe ausdrückt.
- Citar trabajo
- Karolin Gerisch (Autor), 2001, Goethe, Johann Wolfgang von - Faust - Interpretation eines Dramenauszuges - Garten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102775