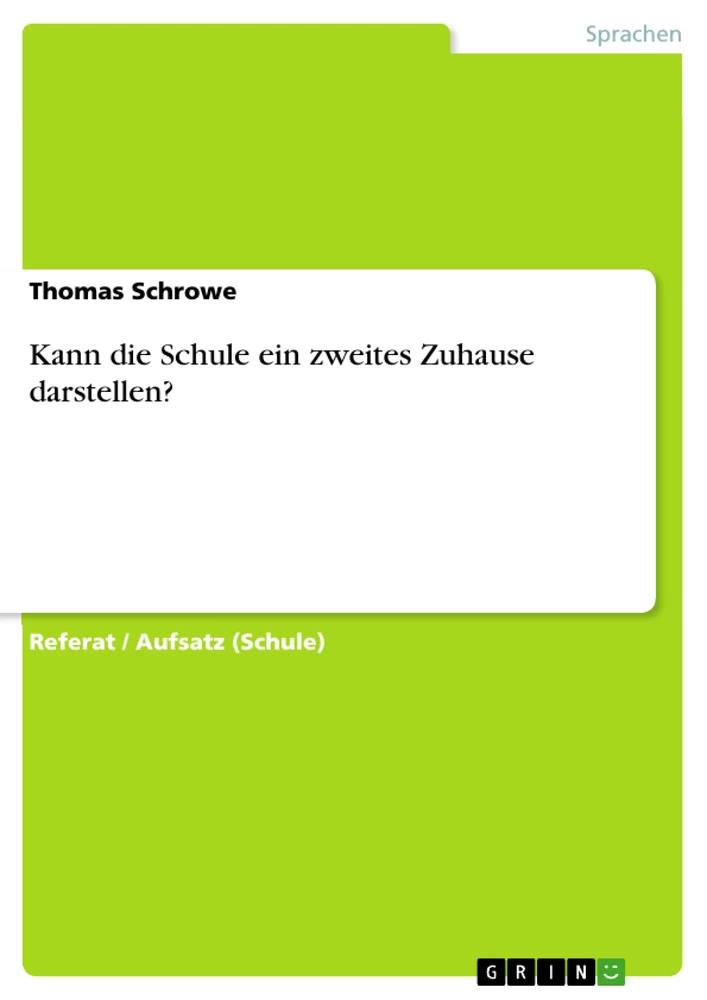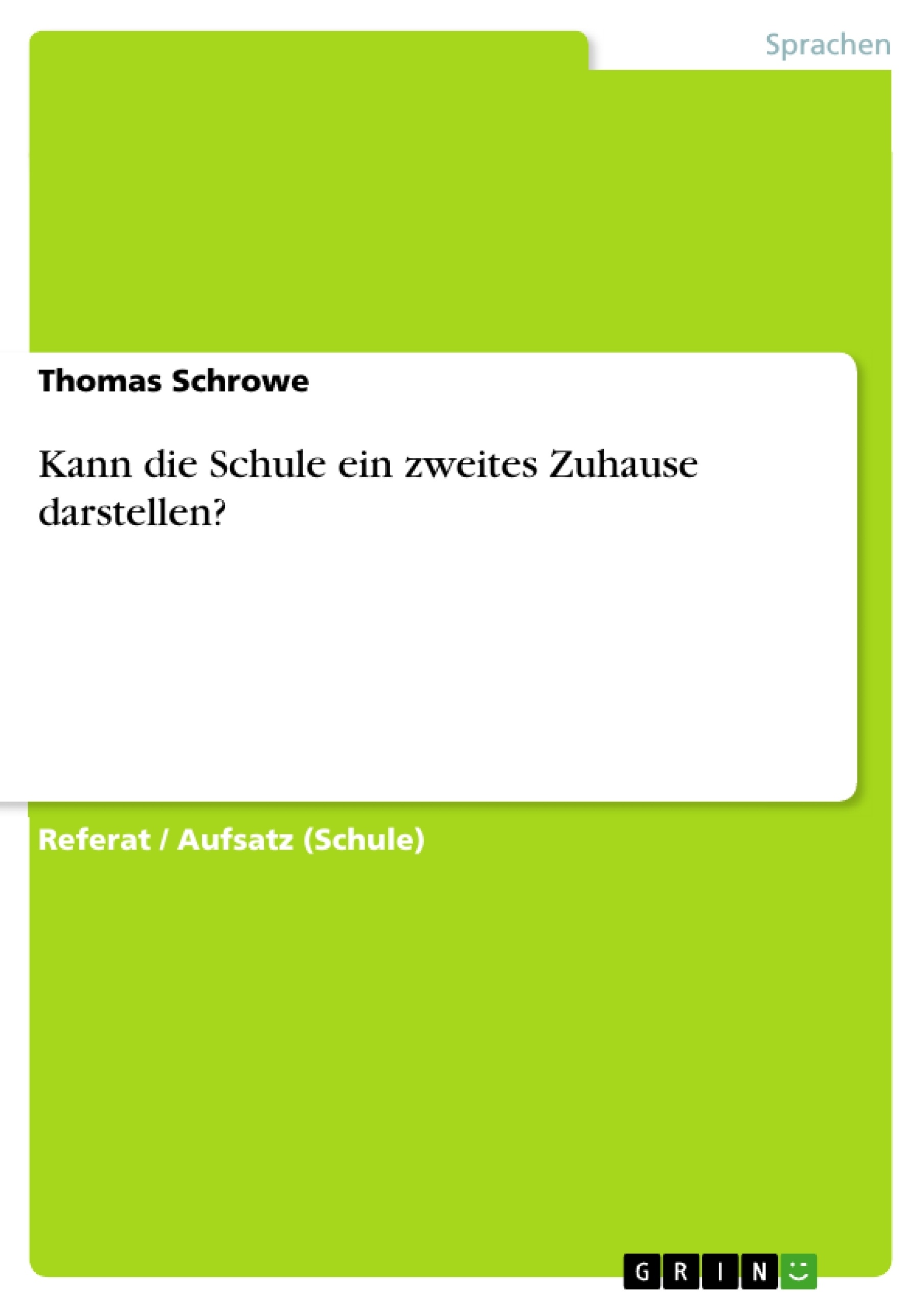Kurzreferat
Thema: Schule
Problematik: Kann die Schule ein zweites Zuhause darstellen?
Wie kommt man eigentlich zu dieser Frage?
Das ist normalerweise leicht beantwortet. Man geht einfach mal in einen etwas anderen Fachbereich und führt sich vor Augen, was Sozialisation beinhaltet - nämlich die Weitergabe von akkumuliertem Wissen durch verschiedene Sozialisationsinstanzen. Diese Instanzen sind verschiedene Einflussgrößen:
- Da gibt es einmal die Medien, die als Vermittler der „Wirklichkeit“, welche aber me- diengebunden ist, dienen (sollen).
- Zum anderen gibt es dann noch die Peer-Groups - die Gruppe der Gleichaltrigen -, die Interessengebunden sind und mit dem Einstieg in die Gesellschaft auftreten.
- Diese Instanz steht ständig im Konkurrenzkampf mit der Familie, die eine weitere sol- che Instanz darstellt. Sie bildet sogar die zentrale Instanz, die die Soziabilisierung ein- leitet. Dies ist die erste Stufe der menschlichen Entwicklung. Weiterhin führt sie in die Gesellschaft, d.h. in die Entkulturation und Individuation ein.
- Nun komme ich zu der letzten noch fehlenden Instanz. Dies ist nun die Schule, die die zweitwichtigste Instanz in sich bürgt. Sie übernimmt die gezielt gelenkte, klassische Funktion der Erziehung und Bildung. Im Alter von sechs bis sechzehn Jahren - manchmal auch bis achtzehn/ neunzehn Jahren oder noch länger - verbringt man ei- gentlich die meiste Zeit in der Schule.
Und genau hier müsste einem die Frage quälen, ob sich die Schule da nicht zu einem zweiten Zuhause entwickeln könnte oder sogar müsste.
Als Schüler könnte man jetzt durchaus denken, wie man sich in der Schule nur wohl fühlen soll, wenn viele kleine Interessenunterschiede zu mehr und mehr Interessenkonflikten führen, die von Interessen- oder manchmal auch Altersgruppen immer weiter geführt werden, was dann sehr schnell zu Provokation, nein sogar bis zu Keilereien führen kann. Die Schule hat an dieser Stelle ja nur noch einen Gedanken - nämlich, wie die Ordnung und die Ruhe am schnellsten wiederhergestellt werden kann. Und dazu nutzt sie jetzt ihre allzeit „beliebten“ Schulstrafen und zwingt die Schüler, ihre Probleme zu unterdrücken. So gibt die Schule nun vor, das Problem beseitigt zu haben und geht nicht näher darauf ein. Die Schüler behaupten nun, dadurch Angst vor der Schule zu entwickeln und sie dadurch zu vernachlässigen. Zu guter letzt leidet jetzt auch noch die Existenzfähigkeit des Freundeskreises darunter. Klar, ist hier die gesellschaftliche Stellung so ziemlich am Abgrund, und wenn die Schule wirklich die Verantwortung für diesen gesellschaftlichen Absturz trägt, ist es vollkommen logisch, dass sie sich dann nie zu einem zweiten Zuhause entwickeln kann.
Doch ich finde, dass solche Argumente nur von SchülerInnen genutzt werden, die der Welt gegenüberstehen, wie die Faust dem Auge, denn die Schule versucht Probleme auch zu lösen oder wenigsten zu besänftigen, indem sie Möglichkeiten zur Kreativierung der verschiedens- ten Interessen darlegt. Z.B. gibt es an vielen Schulen Feste oder Projektfeiern, bei denen Pro- jektgruppen aus dem musikalischen , künstlerischen, sportlichen (, schulsportlichen) und bio- logischen Bereichen ihre Arbeitsergebnisse vorstellen. Bei solchen Veranstaltungen gibt es auch nicht selten billige oder gar gesponserte Getränke und/ oder Speisen. Weiterhin kann ich auch Schulen, an denen Saisonfeste (z.B. Frühlings- oder Herbstfeste) veranstaltet werden, bei welchen ältere SchülerInnen phantasiereiche Spiele und Beschäftigungen mit den jünge- ren SchülerInnen veranstalten, was von den LehrerInnen, ErzieherInnen und Eltern natürlich gänzlich unterstützt wird. Mit meiner früheren Schule nahmen wir aber auch an vielen Projek- ten und Veranstaltungen teil, wie z.B. beim Kinderfest im damaligen Kanzleramt in Bonn oder an einer Autogrammstunde mit dem damaligen BVB-Spieler René Tretschock. Bei dieser Autogrammstunde kamen aber mehr als nur Autogramme für die SchülerInnen raus. Der BVB sponserte der Schule für Körperbehinderte aus Dessau auch neue Tore u.a. Dinge.
An wieder anderen Schulen heißt es, dass die Lehrer nicht zuhören, wenn SchülerInnen Probleme mit dem Lern- und/ oder Unterrichtsstoff, mit einem Teil der Hausordnung, mit anderen MitschülerInnen oder gar mit LehrerInnen haben, d.h. die SchülerInnen beschweren sich über die schlechte Vorbildshaltung der LehrerInnen. Die meisten SchülerInnen meinen noch dazu, dass dies nur drei Gründe gaben kann:
- Entweder sind die LehrerInnen total isoliert und desinteressiert, was ein gutes Ver- hältnis zwischen LehrerIn und SchülerIn angeht, solange es nicht auf einer körper- sportlichen Ebene für zwei Personen ist, wenn Sie wissen, was ich meine.
- Oder die LehrerInnen sind äußerst verschlossen und verkrampft, nach dem Sinn der alten Schule: „Der Lehrer hat recht und damit basta!“
- Oder die LehrerInnen sind voller Vorurteile und kommunizieren nur mit Menschen, die „perfekt“ aussehen und handeln, d.h. sie beurteilen die SchülerInnen nach ihrem Aussehen, ihren Interessen und ihren Leistungen.
Und dadurch, behaupten diese SchülerInnen nun, entsteht ihr Desinteresse am Konsens oder Kompromiss mit den LehrerInnen und später auch mit anderen Menschen, ihre Verschlos- senheit gegenüber LehrerInnen und später auch gegenüber anderen Menschen und ihr schlechter und kritischer Eindruck über die Schule und später auch über andere Dinge. D.h. dadurch werden alle ihre guten Tugenden entweder verschlechtert oder ganz und gar zerstört.
Doch solche Behauptungen werden heutzutage nur noch von SchülerInnen aufgestellt, die ihren Problemen so gegenüberstehen, wie ein Baby seiner mit Kot gefüllten Windel, denn es gibt en fast jeder Schule Schülergruppen - es sollte sie eigentlich sogar an allen Schulen geben -, die sich der SchülerInnen annehmen:
- Zum ersten gibt es da nämlich die SchülerInnenvertretung (SV), die z.B. in Sachsen- Anhalt die Probleme der SchülerInnen in die Schulgesetzesnovellierung (mehr oder weniger) erfolgreich einbrachten (zu Ende des zweiten Jahrtausends).
- Zum zweiten gibt es dann an vielen Schulen auch Schülerzeitungen, in denen persön- liche und offizielle Tatsachen und Bedürfnisse gut eingebracht werden können. (Z.B. lies meine frühere Direktorin schreiben, dass ihr Lieblingssport Reiten sei, was in den Köpfen vieler SchülerInnen zweideutig - die zweite Deutung eher als die erste - auf- gefasst wurde.)
- Aber es können sich ja auch so einmal SchülerInnen zusammensetzen und ihre Mei- nung schriftlich äußern, was in Dessau auch getan wurde, um gegen die neue Recht- schreibung zu rebellieren. (Es muss ja nicht immer zu zynisch und kritisch aussehen, kann aber auch viel schlimmer sein.)
Noch ein scheinbar recht gut begründetes Argument von SchülerInnen ist, dass man in der heutigen Zeit oft gezwungen ist, die Klasse zu wechseln, und selbst wenn das nur ein- oder zweimal der Fall ist, gibt es dann immer wieder neue Probleme, was das Einleben und Um- gewöhnen angeht. So ein Klassenwechsel kann durch vielerlei Ursachen herbeigeführt wer- den, wie z.B. durch Umzüge, Schließungen von anderen Schulen, Überweisungen von einer auf die andere Schule, durch Zurückstellung aufgrund von Krankheit oder anderen Dingen oder einfach durch Sitzen bleiben.
Aber auch dieses Problem ist nur unlösbar für SchülerInnen, die die Schule so ansehen, wie die Politiker das mit der ehrlichen Arbeit tun, denn wenn sich die betreffende SchülerIn und alle oder viele andere MitschülerInnen auch - genauso wie die LehrerInnen - Mühe geben und sich gegenseitig helfen, dann sind die Wunden nach so einem Klassenwechsel schnell verheilt. Und ich glaube meine frühere Klasse bietet dazu ein sehr gutes Beispiel, denn in ihr wurden neun SchülerInnen eingeschult, in/ aus ihr wurden neunzehn SchülerInnen umgeschult und aus ihr wurden zum Schluss wurden acht SchülerInnen ausgeschult. Aber auch meine jetzige Klasse bietet dafür ein gutes Beispiel. Beide Klassen haben sich zu Familien zusammengelebt, die in der Schule ihr zweites Zuhause gefunden hatten.
Somit ist es eigentlich klar, dass es nicht nur von der Schule abhängig ist, inwiefern sie ein zweites Zuhause darstellt.
Na klar hat die Einstellung und das Verhalten der LehrerInnen auch damit zu tun, aber zum größten Teil ist es vom Verhalten und der Einstellung der SchülerInnen abhängig, was die Schule für sie darstellt. Und wenn eine SchülerIn der Schule, dem Schulsystem und den LehrerInnen so gegenübersteht, wie ein verpackter Hintern dem geschlossenen Mund, nach dem Motto „Leck mich doch!“, dann kontert die Schule natürlich nach dem Motto „Wenn deine Hose schneller unten ist als meine Zunge draußen!“ Doch zeigt eine SchülerIn guten Willen, wird die Schule sie immer möglichst gut unterstützen.
Somit hängt es von jeder SchülerIn selber und ihrer Moral ab, ob ihr die Schule zu einem zweiten Zuhause wird oder nicht. Die Möglichkeiten dazu sind aber auf jeden Fall da, und man muss sie nur nutzen
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Kurzreferat: Thema Schule"?
Der Text behandelt die Frage, ob die Schule ein zweites Zuhause für Schülerinnen und Schüler darstellen kann oder sogar sollte. Er untersucht verschiedene Sozialisationsinstanzen wie Medien, Peer-Groups, Familie und Schule, um die Bedeutung der Schule in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu beleuchten.
Welche Rolle spielen die verschiedenen Sozialisationsinstanzen laut dem Text?
Der Text beschreibt die Medien als Vermittler der Realität, die Peer-Groups als interessensgebunden und gesellschaftlich relevant, die Familie als zentrale Instanz für die Soziabilisierung und die Schule als zweitwichtigste Instanz, die gezielte Erziehung und Bildung übernimmt.
Welche Kritikpunkte werden von Schülerinnen und Schülern an der Schule geäußert?
Schülerinnen und Schüler kritisieren, dass Interessenkonflikte und Provokationen zu Schulstrafen führen, die Probleme unterdrücken und Angst vor der Schule verursachen können. Sie bemängeln auch mangelnde Unterstützung durch Lehrerinnen und Lehrer bei Problemen mit Lernstoff, Hausordnung oder Mitschülerinnen und Mitschülern. Einige Schülerinnen und Schüler sehen Lehrerinnen und Lehrer als isoliert, desinteressiert, verschlossen oder voller Vorurteile.
Welche positiven Aspekte der Schule werden im Text hervorgehoben?
Der Text betont, dass Schulen versuchen, Probleme zu lösen oder zu besänftigen, indem sie Möglichkeiten zur Kreativierung der Interessen anbieten, z.B. durch Feste, Projektfeiern und Saisonfeste. Es werden auch Beispiele genannt, in denen Schulen an Projekten und Veranstaltungen teilnehmen und von Sponsoren unterstützt werden.
Welche Alternativen zur Problembewältigung werden für Schülerinnen und Schüler genannt?
Der Text nennt Schülerinnen- und Schülervertretungen (SV), Schülerzeitungen und informelle Treffen von Schülerinnen und Schülern, um Meinungen zu äußern und Probleme anzusprechen.
Welche Schwierigkeiten können durch Klassenwechsel entstehen?
Klassenwechsel können durch Umzüge, Schulschließungen, Überweisungen, Zurückstellungen oder Sitzenbleiben verursacht werden und Schwierigkeiten beim Einleben und Umgewöhnen mit sich bringen.
Welche Lösung wird für die Probleme mit Klassenwechseln vorgeschlagen?
Der Text schlägt vor, dass sich die betreffende Schülerin/der betreffende Schüler, die Mitschülerinnen und Mitschüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer gegenseitig helfen, um die Wunden nach einem Klassenwechsel schnell zu heilen.
Welchen Schluss zieht der Text bezüglich der Frage, ob die Schule ein zweites Zuhause sein kann?
Der Text kommt zu dem Schluss, dass es nicht nur von der Schule, sondern vor allem vom Verhalten und der Einstellung der Schülerinnen und Schüler abhängt, ob die Schule für sie zu einem zweiten Zuhause wird. Es wird betont, dass die Möglichkeiten dazu vorhanden sind und genutzt werden müssen.
Welche Rolle spielen die Lehrerinnen und Lehrer bei der Frage, ob Schule ein zweites Zuhause ist?
Die Einstellung und das Verhalten der Lehrerinnen und Lehrer spielen eine Rolle, aber der Text betont, dass das Verhalten und die Einstellung der Schülerinnen und Schüler den größten Einfluss haben.
- Citar trabajo
- Thomas Schrowe (Autor), 1997, Kann die Schule ein zweites Zuhause darstellen?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102755