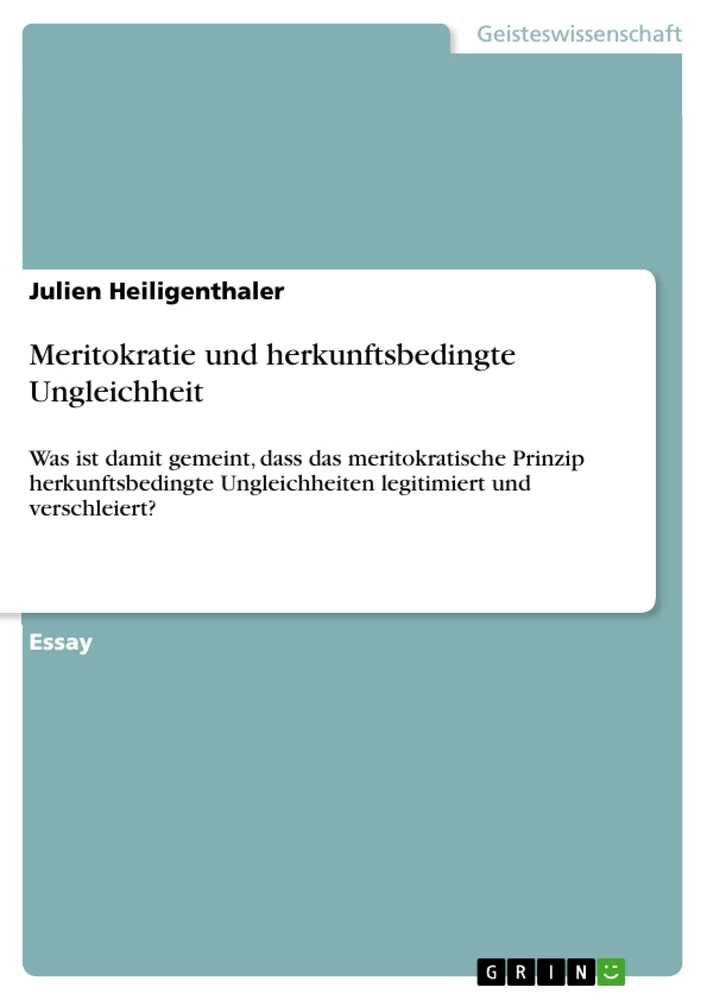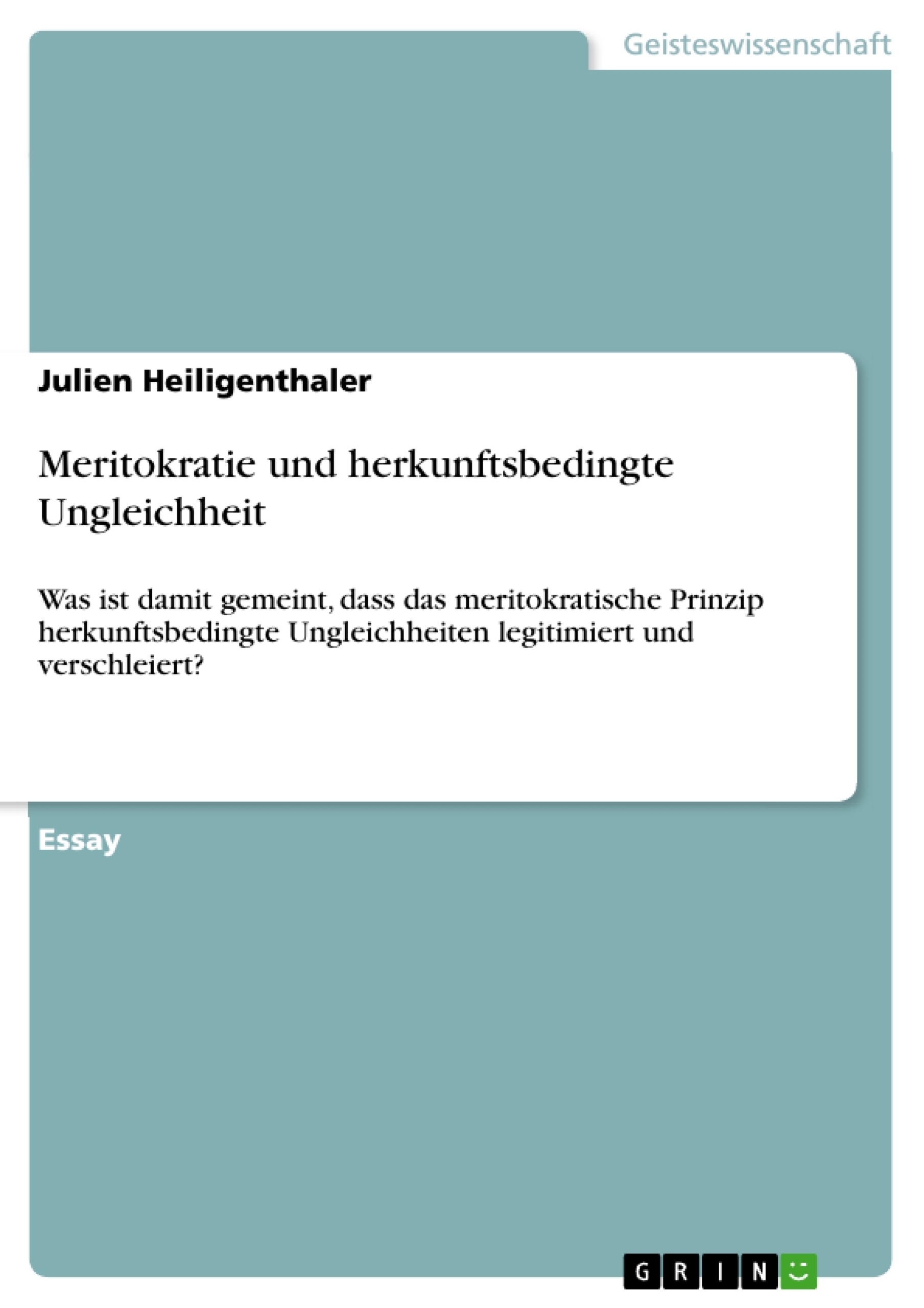Vom Tellerwäscher zum Millionär? Diese Redewendung scheint Einzug in den Köpfen der Menschen gefunden zu haben. Gerade wenn es um soziale Mobilität geht, scheint in modernen Gesellschaften alles möglich zu sein. Mit dieser Illusion angetrieben, scheinen Ungleichheiten zum Problem des Einzelnen zu werden, denn letztlich habe es jeder selbst in der Hand, über sein Schicksal zu bestimmen. Aber was genau steht hinter dieser Mantra-ähnlichen Aussage? Was für Auswirkungen könnte das Denken haben, sowohl für das Individuum als auch die Gesellschaft. Zentral soll es in diesem Essay um die Frage gehen, inwieweit meritokratische Prinzipien herkunftsbedingte Ungleichheiten verschleiert und legitimiert. Dazu wird sich das Essay zunächst thematisch auf die Meritokratie konzentrieren. Mit Ungleichheiten sind nachfolgend jene gemeint, „an den sozialen Positionen von Menschen und nicht ihren individuellen Persönlichkeiten hängen und […] daher nicht zufällig, sondern soziale strukturiert sind“.
Zunächst sollen, der Verständnis wegen, einleitende Worte zur Meritokratie den Weg ebnen. Dazu wird unteranderem eine kurze Definition von Young angeführt. Darauf folgen die Darstellung und Diskussion verschiedener Texte. Der Abschluss wird durch ein Fazit und abschließende Worte gemacht.
Zunächst folgt ein Gedankenexperiment, um die Kernproblematik des Essays zu verdeutlichen. Stellen wir uns eine Grundschulklasse vor. Die Klasse 4b. Der Lehrer der 4b stellt ihnen zum Abschluss des Jahres eine Aufgabe, die bis zum nächsten Tag erledigt sein soll. Die Aufgabe lautet in etwa lautet, schreibt drei Sätze über eure Hobbys, in der deutschen Sprache, ohne Rechtschreibfehler. Diese Aufgabe soll über den weiteren Bildungsweg der Kinder entscheiden. Nun erscheint diese Aufgabe für die Kinder kein Problem zu sein. Doch in dieser Klasse sitzen nicht nur Kinder, dessen Muttersprache die Deutsche ist, sondern auch Kinder, die mit einer anderen Muttersprache aufgewachsen sind und Kinder die an einer Lese- und Rechtschreibstörung leiden. An späterer Stelle wird dieser Sachverhalt nochmal aufgegriffen und erläutert, was genau eine vermeintlich simple gestellte Aufgabe für die Kinder der 4b bedeuten kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verschleierung und Legitimation durch meritokratische Prinzipien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht, inwieweit meritokratische Prinzipien herkunftsbedingte Ungleichheiten verschleiern und legitimieren. Er analysiert die Meritokratie als Konzept und diskutiert verschiedene Texte, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das Gedankenexperiment einer Grundschulklasse verdeutlicht die Kernproblematik.
- Meritokratie als Konzept und Idealisierung
- Einfluss askriptiver Merkmale auf soziale Ungleichheit
- Verschleierung und Legitimation von Ungleichheiten durch meritokratische Prinzipien
- Analyse der Forschung von Blau & Duncan und Featherman & Hauser
- Kritik am meritokratischen Prinzip und dessen gesellschaftliche Auswirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Zusammenhang zwischen meritokratischen Prinzipien und der Verschleierung/Legitimierung herkunftsbedingter Ungleichheiten. Sie präsentiert das Gedankenexperiment der Grundschulklasse, das die Problematik verdeutlicht, indem es zeigt, wie scheinbar einfache Aufgaben die Ungleichheit aufgrund unterschiedlicher sprachlicher und kognitiver Voraussetzungen offenbaren. Die Einleitung gibt einen Überblick über den Aufbau des Essays und die zu behandelnden Aspekte.
Verschleierung und Legitimation durch meritokratische Prinzipien: Dieses Kapitel analysiert den Zusammenhang zwischen Meritokratie und sozialer Ungleichheit. Es beginnt mit einer kurzen Definition der Meritokratie nach Young, die eine idealisierte Gesellschaftsform beschreibt, in der soziale Positionen allein durch Leistung bestimmt werden. Anschließend werden die Forschungsergebnisse von Blau und Duncan sowie Featherman und Hauser vorgestellt, welche den Einfluss askriptiver Merkmale auf den sozialen Aufstieg belegen. Die Ergebnisse zeigen, dass soziale Herkunft einen erheblichen Einfluss hat, auch wenn die eigene Leistung im späteren Verlauf an Bedeutung gewinnt. Das Kapitel diskutiert kritische Ansichten zu den Forschungsarbeiten und deren Grenzen. Es werden schließlich die Thesen von Becker und Hadjar vorgestellt, die argumentieren, dass die Meritokratie Ungleichheiten verschleiert und legitimiert, indem sie den Eindruck von Chancengleichheit erweckt, während soziale Herkunft weiterhin einen entscheidenden Einfluss hat. Das Kapitel betont, dass die Akzeptanz des Leistungsprinzips zur Stabilisierung sozialer Ungleichheit beiträgt.
Schlüsselwörter
Meritokratie, soziale Ungleichheit, herkunftsbedingte Ungleichheiten, askriptive Merkmale, Chancengleichheit, soziale Mobilität, Blau & Duncan, Featherman & Hauser, Becker & Hadjar, Legitimation, Verschleierung, Leistungsprinzip, Bildungssystem.
Häufig gestellte Fragen zum Essay: Verschleierung und Legitimation durch meritokratische Prinzipien
Was ist der zentrale Gegenstand des Essays?
Der Essay untersucht, inwieweit meritokratische Prinzipien herkunftsbedingte Ungleichheiten verschleiern und legitimieren. Er analysiert die Meritokratie als Konzept und diskutiert, wie scheinbare Chancengleichheit soziale Ungerechtigkeit verdeckt.
Welche Methoden werden im Essay verwendet?
Der Essay kombiniert konzeptionelle Analysen der Meritokratie mit der Auswertung empirischer Forschungsarbeiten von Blau & Duncan und Featherman & Hauser. Ein Gedankenexperiment einer Grundschulklasse veranschaulicht die Kernproblematik der ungleichen Voraussetzungen.
Welche Theorien und Forschungsarbeiten werden diskutiert?
Der Essay bezieht sich auf die Arbeiten von Blau & Duncan und Featherman & Hauser zur sozialen Mobilität und dem Einfluss askriptiver Merkmale. Kritische Ansichten zu diesen Forschungsarbeiten werden ebenfalls diskutiert. Zusätzlich werden die Thesen von Becker und Hadjar zur Verschleierung und Legitimierung von Ungleichheiten durch die Meritokratie behandelt.
Welche Schlüsselkonzepte werden im Essay behandelt?
Schlüsselkonzepte sind Meritokratie, soziale Ungleichheit, herkunftsbedingte Ungleichheiten, askriptive Merkmale, Chancengleichheit, soziale Mobilität, Leistungsprinzip und die kritische Auseinandersetzung mit dem Bildungssystem.
Wie ist der Essay aufgebaut?
Der Essay gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel ("Verschleierung und Legitimation durch meritokratische Prinzipien") und einen Schluss (implizit durch die Zusammenfassung der Kapitel). Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und das Gedankenexperiment vor. Das Hauptkapitel analysiert den Zusammenhang zwischen Meritokratie und sozialer Ungleichheit anhand der genannten Forschungsarbeiten und Theorien.
Was ist das Ergebnis des Gedankenexperiments der Grundschulklasse?
Das Gedankenexperiment illustriert, wie scheinbar einfache Aufgaben die Ungleichheit aufgrund unterschiedlicher sprachlicher und kognitiver Voraussetzungen offenbaren, selbst bei vermeintlich gleichen Chancen.
Welche Kritikpunkte an der Meritokratie werden angesprochen?
Der Essay kritisiert die Meritokratie dafür, dass sie Ungleichheiten verschleiert und legitimiert, indem sie den Eindruck von Chancengleichheit erweckt, während soziale Herkunft weiterhin einen entscheidenden Einfluss hat. Die Akzeptanz des Leistungsprinzips trägt zur Stabilisierung sozialer Ungleichheit bei.
Welche Schlussfolgerung lässt sich aus dem Essay ziehen?
Der Essay legt nahe, dass meritokratische Prinzipien die herkunftsbedingten Ungleichheiten nicht beseitigen, sondern eher verschleiern und legitimieren. Die scheinbare Chancengleichheit maskiert die anhaltende Bedeutung sozialer Herkunft für den sozialen Aufstieg.
- Quote paper
- Julien Heiligenthaler (Author), 2020, Meritokratie und herkunftsbedingte Ungleichheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1027521