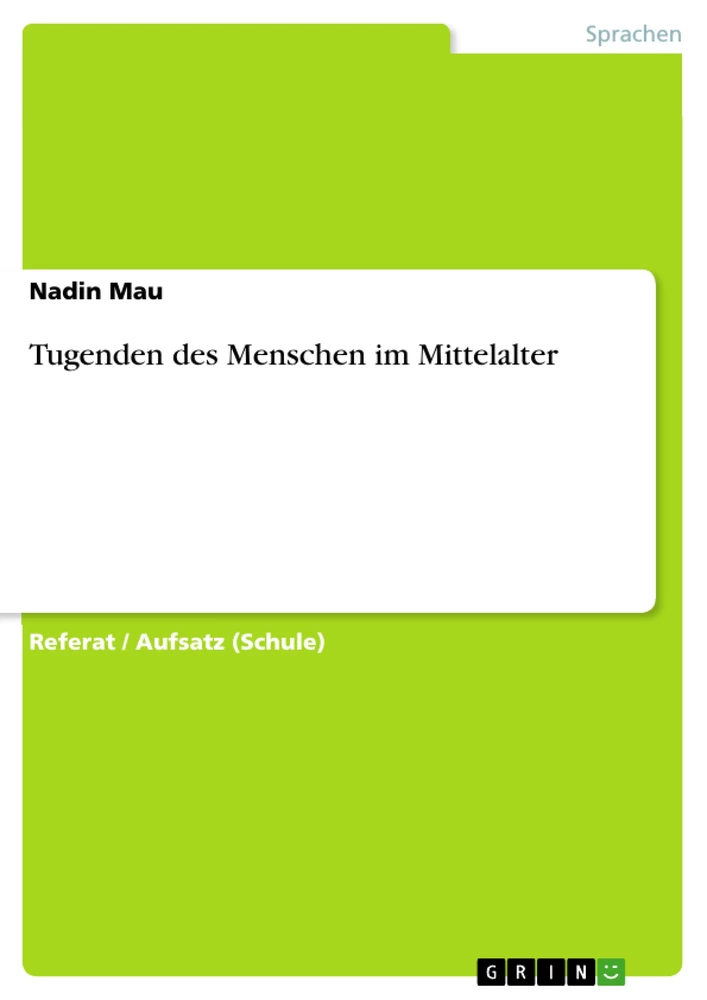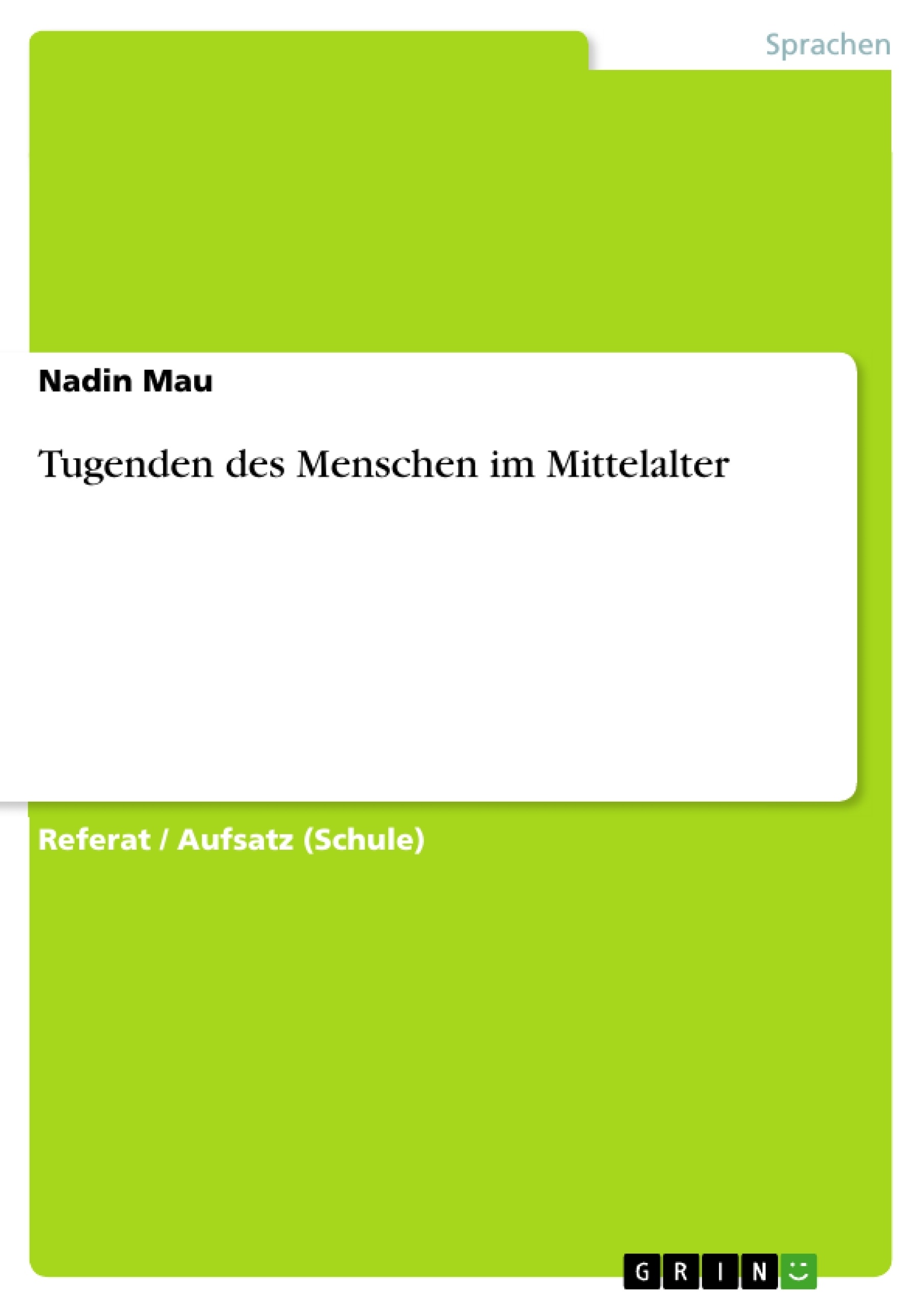Eine faszinierende Reise in die Welt des Mittelalters, in eine Zeit, in der Ritterlichkeit, Minne und gesellschaftlicher Umbruch das Leben prägten. Dieses Buch entführt den Leser in eine Epoche, die von strengen Tugendkatalogen und dem Ideal des edlen Menschen geprägt war, beleuchtet aber auch die Brüche und Widersprüche dieser Zeit. Tauchen Sie ein in die höfische Welt des Minnesangs, in dem die Liebe ein gesellschaftliches Ritual war, und entdecken Sie die Spruchdichtung, die mit satirischer Schärfe politische und moralische Zustände kritisierte. Von den geistlichen Gesängen der Karolingerzeit bis zur ritterlichen Dichtung der Hohenstaufen, von den bescheidenen Anfängen der deutschen Sprache bis zum Aufstieg der Fürstenhöfe als kulturelle Zentren – das Buch zeichnet ein facettenreiches Bild einer Epoche im Wandel. Erforschen Sie die Rolle der fahrenden Sänger und Spielleute, die Nachrichten und Traditionen verbreiteten, und die Bedeutung der christlichen Werte in Kunst und Literatur. Erleben Sie den Zerfall des höfischen Ideals durch Naturkatastrophen und soziale Umwälzungen, und begleiten Sie den Leser auf einer Entdeckungsreise durch die verschiedenen Formen mittelhochdeutscher Lyrik, von der Frauenstrophe bis zum Tagelied. Ein tiefgründiger Einblick in die mittelalterliche Kultur und Literatur, der die Ideale, Konflikte und Umbrüche dieser spannenden Zeit lebendig werden lässt und die Frage aufwirft, wie diese Werte unser heutiges Verständnis von Ehre, Liebe und Gesellschaft beeinflussen. Die Schwerpunkte liegen auf ritterlicher Lebensführung, Werten, Tugenden, Treue zu Gott, der höfischen Gesellschaft, Minnesang, höfischem Roman, Heldenepos, Heldendichtung, Heldenlied, politischem Umbruch, religiösem Umbruch, sozialem Umbruch, Naturkatastrophen, Seuchen, Zerfall des höfischen Ideals, Landesfürsten, Geldentwertung, veränderter Kriegstaktik, Feuerwaffen, Handel, Städten, Volksschichten, Kaufleuten, Patriziern, Handwerkern, Tagelöhnern, Hörigen, Hinwendung zum Weltlichen, Vagantendichtung,Volkslied, Liebeslyrik, Frauenstrophe, Mädchenlied, Kreuzlied, Kreuzzugsdichtung, Tagelied und Spruchdichtung.
Die Tugenden eines Menschen im Mittelalter
- Sinn für Scham
- edel sein
- hilfreich zu den Armen
- sparsam, aber nicht geizig
- gewählte, überlegte Sprache
- klug, reinlich, ordentlich, gütig
- im Besitz vieler Fähigkeiten
- mutig, aber auch emotional
- Frauen „gleichberechtigt“ behandeln, ehrlich zu ihnen sein
- nie Demut aufgeben
- rechtes Augenmaßzeigen
- nie Besitz verschleudern, aber Schätze auch nicht häufen
- Maßund Ziel halten
- vor dem Reden überlegen
- Mut und Mitleid gehören zusammen
- Leben lassen, wenn man das Ehrenwort erhält
Das Mittelalter
1.Frühes Mittelalter ( 750 - 1170 )
- geistlicher Stand war nach wie vor Träger der Dichtung
- Bauern und Adlige waren des Schreibens unkundig
- Mönche verwendeten lateinisch als Standessprache
- die Übermittlung der Lebenskultur und Tradition übernahmen fahrende Sänger und Spielleute
?
Überbringen von Neuigkeiten und Nachrichten
- in der Literatur der Karolingerzeit ( 780 - 900 ) sollte nur das überliefert werden, was im Sinne des Christententums war und zur Bekehrung der Heiden beitragen konnte
- zur Zeit der Sachsenkaiser ( 900 - 1050 ) wurde die deutsche Sprache unter Karl dem Großen gefördert, aber die Mönche verwendeten dann dennoch wieder die lateinische Sprache
- man wollte meist nur die Gelehrten ansprechen ? von Volksdichtung kann noch keine Rede sein
- die Literatur der Salier und der frühen Hohenstaufen ( 1050 - 1170 ) war geprägt von dem religiösen Anliegen der geistlichen Dichter, die versuchten mit Hilfe der Literatur auf interessiert Laien einzuwirken
1.2. Die ritterliche Dichtung ( 1170 - 1250 )
- die Formen und Inhalte der Literatur veränderten sich aufgrund der gewandelten sozialen Bedingungen und der Ausweitung des Lebensraums sowie durch Bekanntschaft mit fremden Kulturen
- jetzt treten weltliche Themen in den Mittelpunkt, obwohl diese noch an das Chris- tentum gebunden waren
- literarisches Zentrum ist nun der Fürstenhof
- die Literatur ist jetzt eine ritterlich
?
thematisiert die ritterlichen Lebensführungen, Werte und Tugenden, vor allem die Treue zu Gott
- Die Höfische Dichtung stellt einen Ritter in den Mittelpunkt, der sich im Leben bewähren muss, um ein akzeptiertes, würdiges Mitglied der Hofgesellschaft zu werden
?
- ist an die höfische Gesellschaft orientiert
- Fudaladel Europas entwickelte eigene Laienkultur und stand da- durch gegen die klerikale ( kirchliche ) Kultur
- Hauptformen sind :
Minnesang
Höfischer Roman
Heldenepos
Heldendichtung Heldenlied
2. Das Spätmittelalter ( 1250 - 1500 )
- das ausgehende Mittelalter gilt als eine Zeit des politischen, religiösen und sozia- len Umbruchs
- Naturkatastrophen und Seuchen beschleunigten den Zerfall des höfischen Ideals
- politischer Hintergrund
- Auflösung des Kaisertums seit dem Ende der Staufer
- Landesfürsten gewinnen immer mehr Selbständigkeit, bedacht auf Machtgewinn
- Hof als Zentrum und Förderer der Kultur existiert nicht mehr
- sozialer Hintergrund
- Ritterstand zerfällt aufgrund der Geldentwertung und veränderter Kriegstaktik ( Feuerwaffen )
- Sozialen Leben verlagert sich durch den Handel immer mehr in die Städte
- Bilden sich unterschiedliche Volksschichten heraus ( Kaufleute, Pat- rizier, Handwerker, Tagelöhner, Hörige )
- geistesgeschichtlicher Hintergrund
- Hinwendung zum Weltlichen
- Kirche stellt sich auf Verweltlichung des geistigen Lebens ein, wid- met sich mehr der praktischen Seelsorge und möchte den Laien in das Glaubensgeschehen mehr einbeziehen
Der Minnesang
- um 1200 entwickelt
- minne = Liebe
- aber es ist keine Liebesdichtung in unserem Sinne
- Dichter besingt eine Frau, aber die Liebe zu ihr ist keine persönliche
- es handelt sich dabei um ein gesellschaftlich, höfisches Ritual
- Minnesänger drückt durch den Gesang die Verehrung zur Dame aus
- oft widmen Sänger den Frauen ihrer Auftraggeber ein Lied
- es handelt sich dabei um ein fiktives Liebeswerben um eine sozial höher stehen- de Dame
- Erfüllung ist aus gesellschaftlichen Gründen schon nicht möglich
- erzählend und mimisch dargestellt
- hat mehrere Strophen
?
„ Hoher Minnesang“
- außerdem ist der Minnesang eine Sammelbezeichnung für verschiedene Formen mittelhochdeutscher Liebeslyrik
- neben der Vagantendichtung und dem Volkslied wichtigste Erscheinungsform
- über Ursprung und Herkunft gibt es keine wissenschaftliche Einigkeit
- Einflüsse kommen aus:
- teilweise aus lateinischer Vagantendichtung ( wurde von Studieren- den verbreitet, die Latein konnten und durch das Land zogen, um Spiel-, Liebes-, Bettel-, Trink-, Tanz-, Buhllieder zu verbreiten; war eine unbeschwerte, satirische, genussfreudige, gegen Autoritäten richtende Dichtung )
- auch aus arabischen Höfen in Spanien
- von französischen Troubadours ( übersetzt: Erfinder von Versen )
- antiker Liebeslyrik
- christlicher Marienverehrung
Formen und Gestaltungsmittel der Minnelieder
- Frauenstrophe
- Frau = lyrisches Ich
- Beschreiben der Einsamkeit, des Erwartens, der Sehnsucht
- Mädchenlied
- Sonderform des Minnesangs
- Gegensatz zum Ideal der Hohen Minne
- stellt Liebeserfüllung zwischen adligen Herrn und einfachem Mäd- chen dar
- Bsp. niedere Minne
- Kreuzlied
- Kreuzzugsdichtung
- Kreuzzüge = zentrales Thema
- Tagelied
- zeigt den Abschied, die Trennung nach einer Liebesnacht
- Illusionen, Scheinwirklichkeit stehen den unerbittlichen Forderungen der Tageswirklichkeit gegenüber = prägt die Haltung des Sprechers
- Unterschiede zum Hohen Minnesang ist die deutlich betonte Erotik und als gefährlich angedeutete Situationen
- Motive sind der Tagesanbruch, der Weckvorgang, die Abschieds- klage
Spruchdichtung
- mittelhochdeutsche Lieder und Gedicht, die sich von dem Minnesang abheben
- sind lehrhaft
- behandelt politische, religiöse, moralische Themen
- kritisieren weltliche und politische Zustände
- oft satirisch
- früher gesungen vorgetragen
- Melodien sind aber kaum erhalten
- wurden von nicht adligen, fahrenden Sängern gesungen
- nicht immer Ausdruck der persönlichen Meinung
- stellt sich in die Dienste eines Herrn
Häufig gestellte Fragen
Welche Tugenden wurden von einem Menschen im Mittelalter erwartet?
Ein Mensch im Mittelalter sollte Sinn für Scham haben, edel sein, hilfreich zu den Armen sein, sparsam, aber nicht geizig sein, eine gewählte und überlegte Sprache verwenden, klug, reinlich, ordentlich und gütig sein, im Besitz vieler Fähigkeiten sein, mutig, aber auch emotional sein, Frauen „gleichberechtigt“ behandeln, ehrlich zu ihnen sein, nie Demut aufgeben, rechtes Augenmaß zeigen, nie Besitz verschleudern, aber Schätze auch nicht häufen, Maß und Ziel halten, vor dem Reden überlegen, Mut und Mitleid zusammenhalten, und Leben lassen, wenn man das Ehrenwort erhält.
Wie war das frühe Mittelalter (750 - 1170) in Bezug auf Dichtung und Sprache geprägt?
Im frühen Mittelalter war der geistliche Stand weiterhin Träger der Dichtung. Bauern und Adlige waren des Schreibens unkundig. Mönche verwendeten Lateinisch als Standessprache. Fahrende Sänger und Spielleute übernahmen die Übermittlung der Lebenskultur und Tradition. In der Literatur der Karolingerzeit (780-900) sollte nur das überliefert werden, was im Sinne des Christentums war und zur Bekehrung der Heiden beitragen konnte. Zur Zeit der Sachsenkaiser (900-1050) wurde die deutsche Sprache gefördert, aber die Mönche verwendeten dennoch wieder Latein. Man wollte meist nur die Gelehrten ansprechen.
Was veränderte sich in der ritterlichen Dichtung (1170 - 1250)?
Die Formen und Inhalte der Literatur veränderten sich aufgrund der gewandelten sozialen Bedingungen, der Ausweitung des Lebensraums und der Bekanntschaft mit fremden Kulturen. Weltliche Themen traten in den Mittelpunkt, obwohl diese noch an das Christentum gebunden waren. Literarisches Zentrum war nun der Fürstenhof. Die Literatur war ritterlich und thematisierte die ritterlichen Lebensführungen, Werte und Tugenden, vor allem die Treue zu Gott. Die höfische Dichtung stellte einen Ritter in den Mittelpunkt, der sich im Leben bewähren musste, um ein akzeptiertes, würdiges Mitglied der Hofgesellschaft zu werden. Hauptformen waren Minnesang, höfischer Roman und Heldenepos.
Wie gestaltete sich das Spätmittelalter (1250 - 1500)?
Das ausgehende Mittelalter gilt als eine Zeit des politischen, religiösen und sozialen Umbruchs. Naturkatastrophen und Seuchen beschleunigten den Zerfall des höfischen Ideals. Politisch löste sich das Kaisertum seit dem Ende der Staufer auf, Landesfürsten gewannen immer mehr Selbstständigkeit. Sozial zerfiel der Ritterstand aufgrund der Geldentwertung und veränderter Kriegstaktik. Das soziale Leben verlagerte sich durch den Handel immer mehr in die Städte. Geistig wandte man sich dem Weltlichen zu, die Kirche widmete sich mehr der praktischen Seelsorge und wollte die Laien mehr in das Glaubensgeschehen einbeziehen.
Was ist der Minnesang?
Der Minnesang entwickelte sich um 1200. "Minne" bedeutet Liebe, aber es ist keine Liebesdichtung im modernen Sinne. Der Dichter besingt eine Frau, aber die Liebe zu ihr ist keine persönliche, sondern ein gesellschaftlich-höfisches Ritual. Der Minnesänger drückt durch den Gesang die Verehrung zur Dame aus, oft widmen Sänger den Frauen ihrer Auftraggeber ein Lied. Es handelt sich um ein fiktives Liebeswerben um eine sozial höher stehende Dame. Es ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene Formen mittelhochdeutscher Liebeslyrik. Einflüsse kamen aus lateinischer Vagantendichtung, arabischen Höfen in Spanien, französischen Troubadours, antiker Liebeslyrik und christlicher Marienverehrung.
Welche Formen und Gestaltungsmittel gab es im Minnesang?
Zu den Formen und Gestaltungsmitteln des Minnesangs gehören Frauenstrophe (Frau als lyrisches Ich, Beschreibung der Einsamkeit, des Erwartens, der Sehnsucht), Mädchenlied (Gegensatz zum Ideal der Hohen Minne, Liebeserfüllung zwischen adligen Herrn und einfachem Mädchen), Kreuzlied (Kreuzzugsdichtung, Kreuzzüge als zentrales Thema) und Tagelied (Abschied, die Trennung nach einer Liebesnacht, betonte Erotik und gefährlich angedeutete Situationen, Motive sind der Tagesanbruch, der Weckvorgang, die Abschiedsklage).
Was ist Spruchdichtung?
Spruchdichtung sind mittelhochdeutsche Lieder und Gedichte, die sich von dem Minnesang abheben. Sie sind lehrhaft, behandeln politische, religiöse und moralische Themen, kritisieren weltliche und politische Zustände und sind oft satirisch. Sie wurden früher gesungen vorgetragen, aber Melodien sind kaum erhalten. Sie wurden von nicht adligen, fahrenden Sängern gesungen und waren nicht immer Ausdruck der persönlichen Meinung. Der Sänger stellte sich oft in die Dienste eines Herrn und erhoffte sich von ihm Lohn.
- Quote paper
- Nadin Mau (Author), 1999, Tugenden des Menschen im Mittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102747