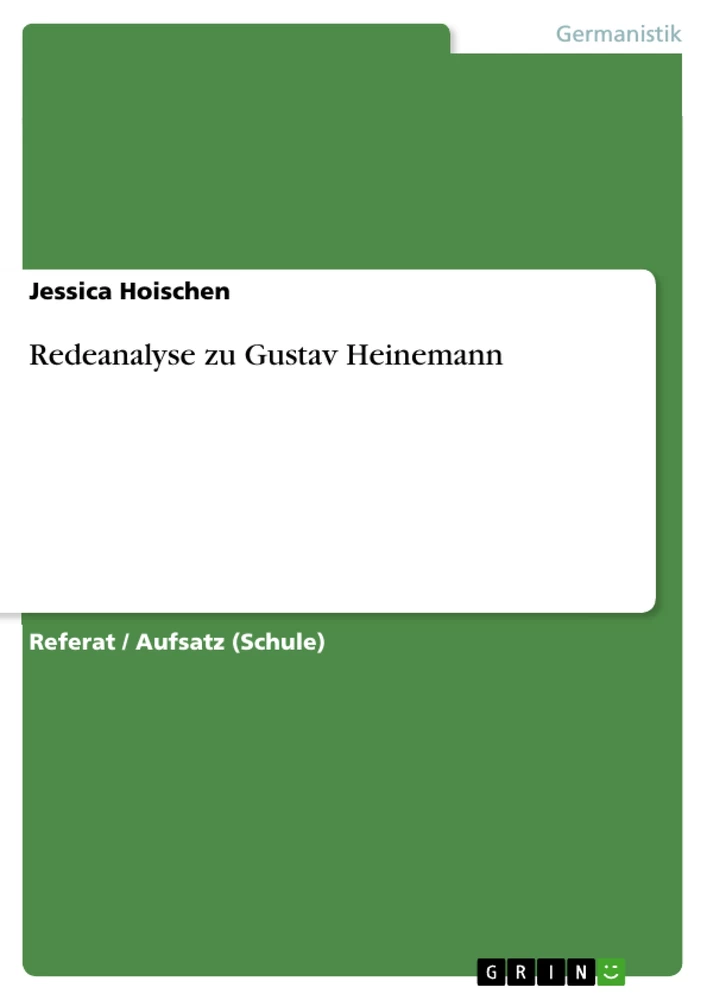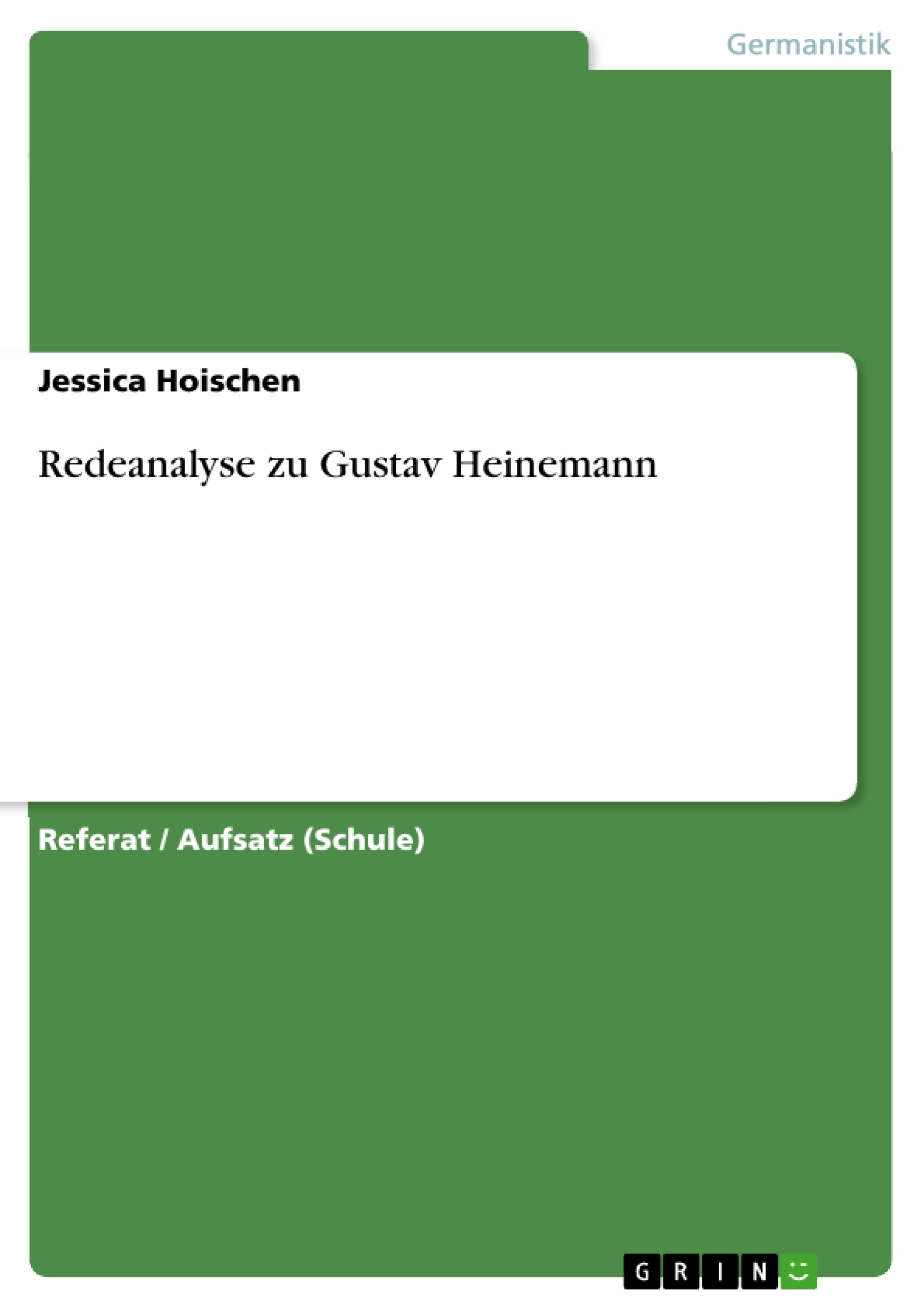In einer Zeit politischer Zerrissenheit und studentischer Proteste, die das Fundament der Bundesrepublik erschütterten, erhebt sich eine Stimme der Vernunft und des Dialogs. Gustav Heinemann, Justizminister in einer Ära des Umbruchs, stellt sich in dieser packenden Analyse den brennenden Fragen der Zeit: Wie konnte es zu Eskalationen kommen, die von Antikommunismus bis hin zu gewalttätigen Ausschreitungen reichten? War der Kontakt zur Jugend verloren gegangen, und welche Verantwortung trugen die älteren Generationen an der Entstehung dieser tiefen Kluft? Heinemanns Rede, gehalten inmitten der Unruhen des Jahres 1968 nach dem Attentat auf Rudi Dutschke und den darauffolgenden Demonstrationen gegen den Springer-Konzern, ist ein flammender Appell zur Selbstbeherrschung und Besinnung. Er fordert dazu auf, die Gesetze der Freiheit zu achten und gemeinsam nach Lösungen zu suchen, die den demokratischen Grundwerten entsprechen. Statt Schuldzuweisungen zu verteilen, analysiert Heinemann die tieferliegenden Ursachen der Konflikte und ruft zu einem Dialog zwischen den Generationen auf. Er betont das Recht auf freie Meinungsäußerung und Demonstration, mahnt aber gleichzeitig zur Gewaltlosigkeit und zur Achtung des Grundgesetzes. Diese Analyse einer Schlüsselrede der deutschen Nachkriegsgeschichte bietet nicht nur einen Einblick in die politischen und gesellschaftlichen Spannungen der 68er-Bewegung, sondern regt auch zur Reflexion über die Bedeutung von Demokratie, Verantwortung und Dialog in unserer heutigen Gesellschaft an. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für politische Reden, Zeitgeschichte, Studentenproteste, die 68er Bewegung, Kommunismus, Antikommunismus und die deutsche Nachkriegszeit interessieren. Entdecken Sie die bewegende Kraft seiner Worte und die zeitlose Relevanz seiner Botschaft für eine Gesellschaft im Wandel. Tauchen Sie ein in die Vergangenheit, um die Herausforderungen der Gegenwart besser zu verstehen und die Zukunft aktiv mitzugestalten. Erleben Sie, wie eine Rede zur Brücke zwischen den Generationen werden kann.
Redeanalyse Gustav Heinemann
Information:
Seit dem Sommer 1967 rebellierte die studentische Jugend in der Bundesrepublik und in Westberlin, es kam zu harten Auseinandersetzungen zwischen der Staatsmacht und den protestierenden und demonstrierenden Studenten. In dieser Situation äußerster Anspannung, die die Regierung der Großen Koalition kaum zu bewältigen wußte, unternahm der Anstreicher Josef Bachmann am Gründonnerstag, 11. April 1968, ein Attentat auf den SDS - Führer Rudi Dutschke und verletzte ihn schwer.
Daraufhin begannen dessen Anhänger und tausende sich mit ihnen solidarisierender Jugendlicher an den Osterfeiertagen in Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, Köln, Kiel Göttingen, Kassel, Stuttgart und Esslingen mit gewaltsamen Aktionen gegen den Springer - Zeitungskonzern, dessen Blätter in den Monaten vorher die Studentenunruhen für sensationelle Artikel gegen die Studenten genutzt hatten.
Justizminister Gustav Heinemann (SPD) am 14. 4. 1968:
Verehrte Mitbürger!
Diese Tage erschütternder Vorgänge und gesteigerten Unruhe rufen uns alle zu einer Besinnung. Wer mit dem Zeigefinger allgemeiner Vorwürfe auf den oder die vermeintlichen Anstifter und Drahtzieher zeigt, sollte daran denken, daßin der Hand mit dem ausgestreckten Zeigefinger zugleich drei andere auf ihn zurückweisen.
Damit will ich sagen, daßwir uns alle zu fragen haben, was wir selber in der Vergangenheit dazu beigetragen haben könnten, daßein Antikommunismus sich bis Mordanschlag steigerte, und daßDemonstranten sich in Gewalttaten der Verwüstung bis zur Brandstiftung verloren haben.
Sowohl der Attentäter, der Rudi Dutschke nach dem Leben trachtete, als auch die elftausend Studenten, die sich an den Demonstrationen vor den Zeitungshäusern beteiligten, sind junge Menschen.
Heißt das nicht, daßwir Älteren den Kontakt mit Teilen der Jugend verloren haben oder ihnen unglaubwürdig wurden? Heißt das nicht, daßwir Kritik ernst nehmen müssen, auch wenn sie aus der jungen Generation laut wird?
Besserungen hier und an anderen Stellen können nur dann gelingen, wenn jetzt von keiner Seite neue Erregung hinzugetragen wird. Gefühlsaufwallungen sind billig, aber nicht hilfreich - ja sie vermehren die Verwirrung.
Nichts ist jetzt so sehr geboten, wie Selbstbeherrschung - auch an den Stammtischen oder wo immer sonst dieser Tage diskutiert wird.
Das Kleid unserer Freiheit sind die Gesetze, die wir uns selber gegeben haben. Diesen Gesetzen die Achtung und Geltung zu verschaffen, ist die Sache von Polizei und Justiz. Es besteht kein Anlaßzu bezweifeln, daßPolizei und Justiz tun, was ihre Aufgabe ist.
Wichtiger aber ist es, uns gegenseitig zu dem demokratischen Verhalten zu verhelfen, das den Einsatz von Polizei und Justiz erübrigt.
Zu den Grundrechten gehört auch das Recht zu demonstrieren, um öffentliche Meinung zu mobilisieren. Auch die junge Generation hat einen Anspruch darauf, mit ihren Wünschen und Vorschlägen gehört und ernst genommen zu werden.
Gewalttat aber ist ein gemeines Unrecht und eine Dummheit obendrein. Es ist eine alte Erfahrung, daßAusschreitungen und Gewalttaten genau die gegenteilige öffentliche Meinung schaffen, als ihre Urheber wünschen. Das sollten - so meine ich - gerade politisch bewegte Studenten begreifen und darum zur Selbstbeherrschung zurückfinden.
Unser Grundgesetz ist ein großes Angebot. Zum ersten Mal in unserer Geschichte will es in einem freiheitlich - demokratischen und sozialen Rechtsstaat der Würde des Menschen volle Geltung zu verschaffen. In ihm ist Platz für eine Vielfalt der Meinungen, die es in offener Diskussion zu klären gilt.
Uns in diesem Grundsatz zusammenzufinden und seine Aussagen als Lebensform zu verwirklichen, ist die gemeinsame Aufgabe. Die Bewegtheit dieser Tage darf nicht ohne guten Gewinn bleiben.
REDEANALYSE ZU GUSTAV HEINEMANN
[Oberstufenklausur (überarbeitet); Note: 2]
Der Justizminister Gustav Heinemann hielt am 14.4.1968 eine Rede um die Situation in diesem Jahr ein wenig zu entspannen. Dieser Rede waren ein Attentat auf den Studentenführer Rudi Dutschke und Aktionen gegen den Springer - Konzern vorangegangen.
Heinemann beginnt seine Rede, indem er zur Besinnung aufruft und die Bevölkerung bittet von Anklagen abzusehen. Er weist darauf hin, daßdie Schuld für die vorangegangenen Aktionen nicht nur bei einer Partei zu suchen ist. "Wer mit [...] dem Zeigefinger [...] zeigt, sollte daran denken, daß[...] zugleich drei andere Finger auf ihn selbst zurückweisen." Vielmehr sucht Heinemann in seiner Rede nach den Ursachen, die zu diesen Gewalttaten geführt haben. Um allen die Ausmaße der Situation klar zu machen, benutzt er eine Klimax "[...] und daßDemonstranten sich in Gewalttaten der Verwüstung bis zur Brandstiftung verloren haben." In dem vorangegangenen Satz, in dem Heinemann die Ursachen auch bei den älteren Mitmenschen, nicht nur bei der Jugend sucht, sind eine indirekte rhetorische Frage, ein Parallelismus und ein Appell vorhanden "[...] daßwir uns alle zu fragen haben, was wir [...] dazu beigetragen haben könnten [...]" Der Redner verstärkt die Aussage dieses Absatzes durch Epiphern "[...] zu fragen haben, [...] beigetragen haben, [...] verloren haben."
Auch im übernächsten Absatz benutzt Heinemann wieder rhetorische Fragen (Z. 16 ff.), in denen er seine Mitbürger auffordert auch junge Menschen und deren Kritik wahr und ernst zu nehmen. Um dies zu unterstreichen benutzt er eine Anapher : „Heißt das nicht ...haben? Heißt das nicht ...wird?“ Anschließend betont er , daßBesserungen nur gelingen können, wenn beide Seiten sich beruhigen. Diese Aussage wird durch eine Correctio stark betont: „Gefühlsaufwallungen sind billig, aber nicht hilfreich - ja sie vermehren die Verwirrung.“ Heinemann verweist darauf, daßnichts so sehr geboten ist wie Selbstbeherrschung - bei allen (Z. 24).
Mit dem nächsten Absatz beginnt auch neuer Teil der Rede. Im vorherigen Teil geht Heinemann mit Verständnis auf die Menschen und ihre Gefühle ein. Im nachfolgenden Teil befasst er sich mit der Gesetzesgrundlage und die dringende Notwendigkeit eine Lösung zu finden, während er versucht den Studenten andere Möglichkeiten aufzuzeigen. Den ersten Satz dieses zweiten Teils beginnt Heinemann mit einer Personifikation, die gleichzeitig auch eine Metapher ist: „Das Kleid der Freiheit ...“ [Im nächsten Satz gibt es ein Heniadyoin. (Anmerkung des Lehrers: Würde ich nicht sagen: Die Begriffe gehören zwar zusammen, sind aber nicht synonym!).] Die Repetitio von Polizei und Justiz im nächsten Satz verweist der Redner verstärkt darauf, wessen Aufgabe es ist, die Gesetze durchzusetzen. Der folgende Satz hätte durch einen Chiasmus statt des hier vorhandenen Parallelismus eine Verstärkung erfahren können (Z. 32 -34). Noch einmal verweist der Sprecher auf die Sinnlosigkeit der Gewalt. Heinemann betont wiederholt auf das Recht auf Demonstration und freie Meinungsäußerung, jedoch auch, daßdies friedlich ablaufen sollte.
Diese Aussage unterstreicht er wieder mit einer Antiklimax, bzw. Klimax: „... gemeines Unrecht und eine Dummheit...“, „Ausschreitungen und Gewalttaten...“ Heinemann verweist die nun direkt angesprochenen Studenten darauf, daßgerade sie, die politisch bewegt sind, dies begreifen müßten und darum zur Selbstbeherrschung zurückfinden sollten. Hier fällt wieder das Stichwort Selbstbeherrschung. Der Justizminister führt das Grundgesetz an und betont, daßes genug Raum gibt, für alle Meinungen, die in friedlicher Diskussion zu besprechen sind. Der nächster Satz zeigt die Intention des Redners deutlich auf: „Uns in diesem Grundgesetz zusammenzufinden und seine Aussagen als Lebensform zu verwirklichen, ist die gemeinsame Aufgabe.“ Dieser Appell zeigt besonders deutlich, wie viel dem Redner daran liegt, eine friedliche, gemeinsame Lösung zu finden und gemeinsam einen freiheitlich - demokratischen Staat aufzubauen. Das Wort „gemeinsam“ prägt sich besonders ein, da vorher die Studenten immer als einzelne Gruppe betrachtet wurden. Heinemann zeigt jedoch ein gemeinsames Ziel auf, das nur zu erreichen ist, wenn die Gewalt aufhört. Der letzte Satz („Die Bewegtheit dieser Tage darf nicht ohne guten Gewinn bleiben“) ist ein stärkerer Appell als die vorangegagenenen. Ein Gewinn wäre eine gemeinsame Lösung, mit der alle zufrieden wären. Dieser Appell zeigt noch einmal überdeutlich, wie wichtig es ist, daßeine Einigung erzielt wird.
Zum Aufbau der Rede ist zu sagen, daßsie zweigeteilt ist. Teil eins geht von Zeile 1 bis 26, der zweite Teil von Zeile 26 bis 54. Die letzten ¾ (ab Zeile 32) des zweiten Teils bestehen fast ausschließlich aus Appellen. Diese Appelle unterstützen die Aussage der gemeinsamen Aufgabe. Auch die Rede endet mit einem Appell, der wieder deutlich auf die Intention des Redners eine Veränderung hinweist.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Rede von Gustav Heinemann vom 14. April 1968?
Die Rede von Justizminister Gustav Heinemann am 14. April 1968 thematisiert die angespannte politische Lage in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Attentat auf den Studentenführer Rudi Dutschke und den darauf folgenden gewaltsamen Protesten gegen den Springer-Konzern. Heinemann ruft zur Besinnung und Selbstbeherrschung auf, sowohl bei der älteren Generation als auch bei den protestierenden Studenten. Er betont die Bedeutung des Grundgesetzes und die Notwendigkeit, in einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat gemeinsam Lösungen zu finden.
Welche Ereignisse gingen der Rede von Heinemann voraus?
Der Rede gingen das Attentat des Anstreichers Josef Bachmann auf Rudi Dutschke am 11. April 1968 sowie gewaltsame Demonstrationen und Aktionen von Studenten gegen den Springer-Konzern in verschiedenen Städten der Bundesrepublik voraus. Diese Aktionen waren eine Reaktion auf die aus Sicht der Studenten hetzerische Berichterstattung der Springer-Zeitungen über die Studentenbewegung.
Welche zentralen Forderungen stellt Heinemann in seiner Rede?
Heinemann fordert zur Besinnung und Selbstbeherrschung auf. Er appelliert an alle Bürger, die Schuld für die Eskalation nicht einseitig zu suchen, sondern die Ursachen in der Vergangenheit zu hinterfragen. Er betont die Wichtigkeit, die Kritik der jungen Generation ernst zu nehmen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Er unterstreicht das Recht auf freie Meinungsäußerung und Demonstration, verurteilt aber gleichzeitig Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung.
Welche rhetorischen Mittel setzt Heinemann in seiner Rede ein?
Heinemann verwendet verschiedene rhetorische Mittel, um seine Botschaft zu vermitteln. Dazu gehören rhetorische Fragen, Appelle, Anaphern, Epiphern, Klimax, Antiklimax, Correctio, Parallelismen und Personifikationen. Diese Mittel dienen dazu, die Zuhörer emotional anzusprechen, zum Nachdenken anzuregen und die zentralen Botschaften der Rede zu verstärken.
Wie ist die Rede von Gustav Heinemann aufgebaut?
Die Rede lässt sich grob in zwei Teile gliedern. Im ersten Teil (Z. 1-26) ruft Heinemann zur Besinnung auf und sucht nach den Ursachen für die Eskalation. Er zeigt Verständnis für die Gefühle der Menschen. Im zweiten Teil (Z. 26-54) thematisiert er die Gesetzesgrundlage und die Notwendigkeit einer friedlichen Lösung. Der zweite Teil besteht hauptsächlich aus Appellen, die die Bedeutung einer gemeinsamen Aufgabe unterstreichen. Die Rede endet mit einem Appell, der auf die Notwendigkeit einer Veränderung hinweist.
Welche Bedeutung hat die Rede von Gustav Heinemann im historischen Kontext?
Die Rede von Gustav Heinemann ist ein wichtiger Beitrag zur politischen Auseinandersetzung in der Zeit der Studentenrevolte in der Bundesrepublik Deutschland. Sie zeigt einen Versuch, die angespannte Lage zu deeskalieren und einen Dialog zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zu fördern. Heinemanns Appell zur Besinnung und zur Wahrung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist auch heute noch relevant.
- Quote paper
- Jessica Hoischen (Author), 2001, Redeanalyse zu Gustav Heinemann, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102743