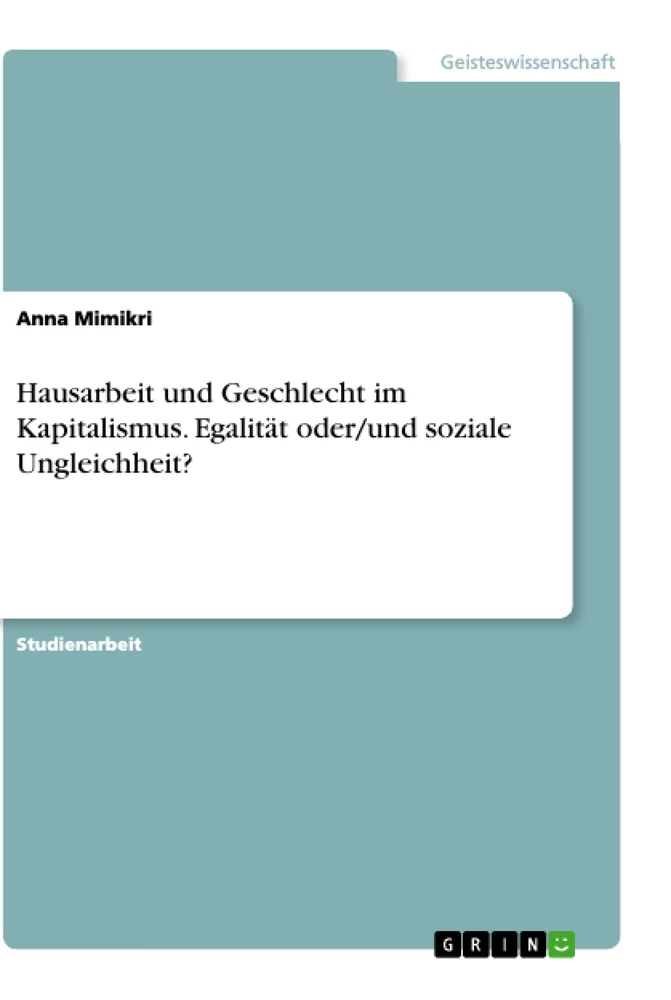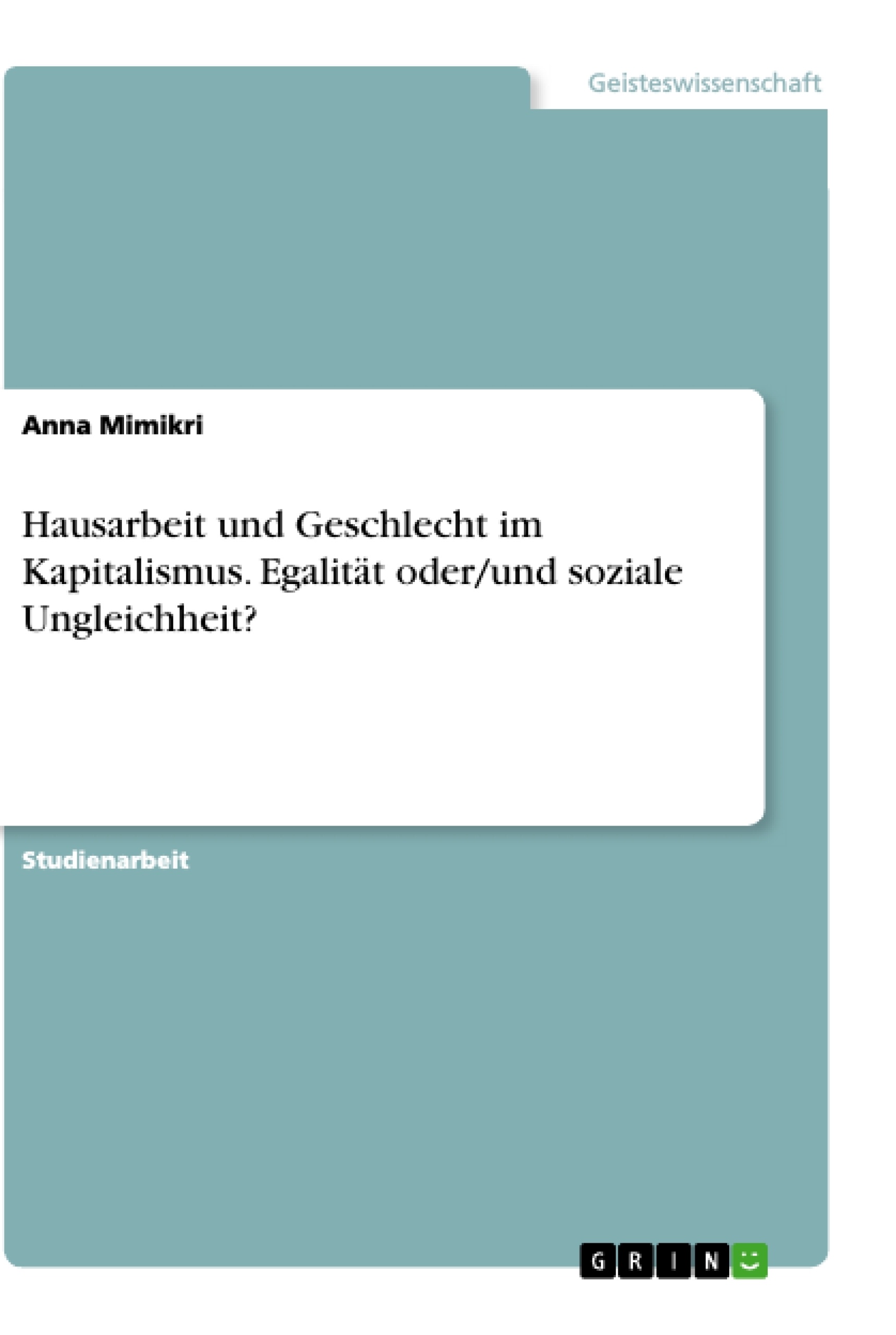Die Arbeit widmet sich der Analyse des Zusammenhangs zwischen Geschlecht, Hausarbeit und Gesellschaftsordnung. Die These lautet dabei, dass Geschlecht ein Strukturierungsprinzip von Arbeit sowie der kapitalistischen Arbeitsgesellschaft darstellt und mit sozialen Ungleichheiten verbunden ist. Wie Paare das Putzen, Kochen und Waschen untereinander aufteilen – all das sind vermeintlich private Angelegenheiten, gleichzeitig erfährt Haushaltsarbeit kaum die Bedeutung eines gesellschaftlich hoch relevanten Tätigkeitsbereichs. Neben der Unsichtbarkeit und der gesellschaftlichen Marginalisierung von Hausarbeit bildet die starke geschlechtsspezifische Kategorisierung einen Anlass diese soziologisch näher zu betrachten.
Zur intersubjektiven Nachvollziehbarkeit der Arbeit werden zunächst einige der zentralen Begrifflichkeiten dargelegt. Anschließend wird auf die historischen Wurzeln von Arbeit und Geschlecht im Sinne von vergeschlechtlichter Arbeit eingegangen sowie die Entwicklung dieses Zusammenspiels bis in den Industriekapitalismus nachvollzogen. Darauffolgend werden die Ausformungen von Arbeits- und Geschlechterverhältnissen in der neoliberalen Gegenwart betrachtet. Im Anschluss werden Ursachen für die bis in die Gegenwart anhaltende ungleiche Arbeitsteilung von Frauen und Männern im Privaten aus Handlungs- und Diskursperspektive dargelegt. Den Abschluss der Arbeit bildet ein Fazit zu den Haupterkenntnissen der Arbeit und zur Ungleichzeitigkeit von egalitärer Modernisierung und anhaltender sozialer Ungleichheit.
Die Sängerin Johanna von Koczian singt in ihrem Schlagerhit von 1977 "Das bisschen Haushalt macht sich von allein – sagt mein Mann" und thematisiert damit auf ironische Weise die Unsichtbarkeit und Geringschätzung der damals hauptsächlich von Frauen verrichteten Hausarbeit in Paarhaushalten. Über 40 Jahre später konstatiert das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, dass der Anteil der unbezahlten Arbeit, die Männer im Haushalt übernehmen, seit den 1990er-Jahren größer geworden sei – allerdings herrscht auch in der Gegenwart keine paritätische Aufteilung der Hausarbeit hinsichtlich Inhalt und Zeitaufwand.
Inhaltsverzeichnis
- ,,Das bisschen Haushalt“ – Einleitung
- Geschlecht und Arbeit - Begrifflichkeiten und Vorbemerkungen
- Geschlecht
- Arbeit
- Hausarbeit
- Historische Ursprünge und Folgen geschlechtlicher Arbeitsteilung
- Geschlechternormen und Arbeitsteilung in der Ständegesellschaft
- Geschlechternormen und Arbeitsteilung in der kapitalistischen Gesellschaft
- Von der Differenz zur Hierarchie: Geschlechtliche Arbeitsteilung und soziale Ungleichheit
- (Haus-)Arbeit und Geschlechterverhältnis in der Gegenwartsgesellschaft
- Neoliberale Restrukturierung von Arbeitsverhältnissen
- Persistenz des Geschlechterverhältnisses
- Erklärungsansätze für bestehende Ungleichheiten
- De-Thematisierung von Geschlecht
- Rhetorische Modernisierung der Geschlechterverhältnisse: Die Diskrepanz zwischen Diskurs und Praxis
- Das Konzept der Rhetorischen Modernisierung
- Uminterpretation von Ungleichheit
- Individualisierung von Ungleichheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Geschlecht, Hausarbeit und Gesellschaftsordnung. Sie analysiert, wie Geschlecht als Strukturierungsprinzip von Arbeit und der kapitalistischen Arbeitsgesellschaft fungiert und mit sozialen Ungleichheiten verbunden ist.
- Historische Entwicklung von Arbeit und Geschlecht im Kontext von vergeschlechtlichter Arbeit
- Auswirkungen der neoliberalen Restrukturierung von Arbeitsverhältnissen auf das Geschlechterverhältnis
- Persistenz von Ungleichheiten in der Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern im Privatbereich
- Analyse von Handlungs- und Diskursperspektiven zur Erklärung der anhaltenden Ungleichheit in der Hausarbeit
- Zusammenhang zwischen egalitärer Modernisierung und anhaltender sozialer Ungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
,,Das bisschen Haushalt“ – Einleitung
Die Einleitung stellt den Ausgangspunkt der Arbeit dar und greift das Thema der Hausarbeit in Paarhaushalten auf. Sie verdeutlicht die Unsichtbarkeit und Geringschätzung dieser Arbeit, die traditionell von Frauen verrichtet wurde. Die Einleitung führt den Leser in das Thema ein und skizziert die zentrale These der Arbeit.
Geschlecht und Arbeit - Begrifflichkeiten und Vorbemerkungen
Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie Geschlecht und Arbeit und grenzt deren Geltungsbereich ab. Es beleuchtet die soziale Konstruktion von Geschlecht und die historische Entwicklung des Zweigeschlechtermodells. Der Fokus liegt dabei auf gesellschaftlichen Normen und Zuweisungen im Kontext von unbezahlter Hausarbeit.
Historische Ursprünge und Folgen geschlechtlicher Arbeitsteilung
Dieses Kapitel zeichnet die historische Entwicklung von Geschlechterrollen und Arbeitsteilung nach, beginnend mit der Ständegesellschaft und der Entwicklung bis in den Industriekapitalismus. Es untersucht die Entstehung und Persistenz von geschlechtsspezifischen Normen und die daraus resultierende soziale Ungleichheit.
(Haus-)Arbeit und Geschlechterverhältnis in der Gegenwartsgesellschaft
Dieses Kapitel analysiert die Ausprägung von Arbeits- und Geschlechterverhältnissen in der neoliberalen Gegenwart. Es geht auf die Restrukturierung von Arbeitsverhältnissen und die anhaltende Diskrepanz zwischen dem Anspruch auf geschlechtliche Gleichberechtigung und der Praxis ein.
Erklärungsansätze für bestehende Ungleichheiten
Dieses Kapitel untersucht verschiedene Erklärungsansätze für die anhaltende Ungleichheit in der Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern im privaten Bereich. Es beleuchtet die De-Thematisierung von Geschlecht, die rhetorische Modernisierung der Geschlechterverhältnisse und die Individualisierung von Ungleichheit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Geschlecht, Hausarbeit, soziale Ungleichheit, Geschlechterrollen, Arbeitsteilung, Reproduktionsarbeit, Neoliberalismus, Diskursperspektive, Handlungsperspektive und egalitäre Modernisierung.
- Arbeit zitieren
- Anna Mimikri (Autor:in), 2020, Hausarbeit und Geschlecht im Kapitalismus. Egalität oder/und soziale Ungleichheit?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1027268