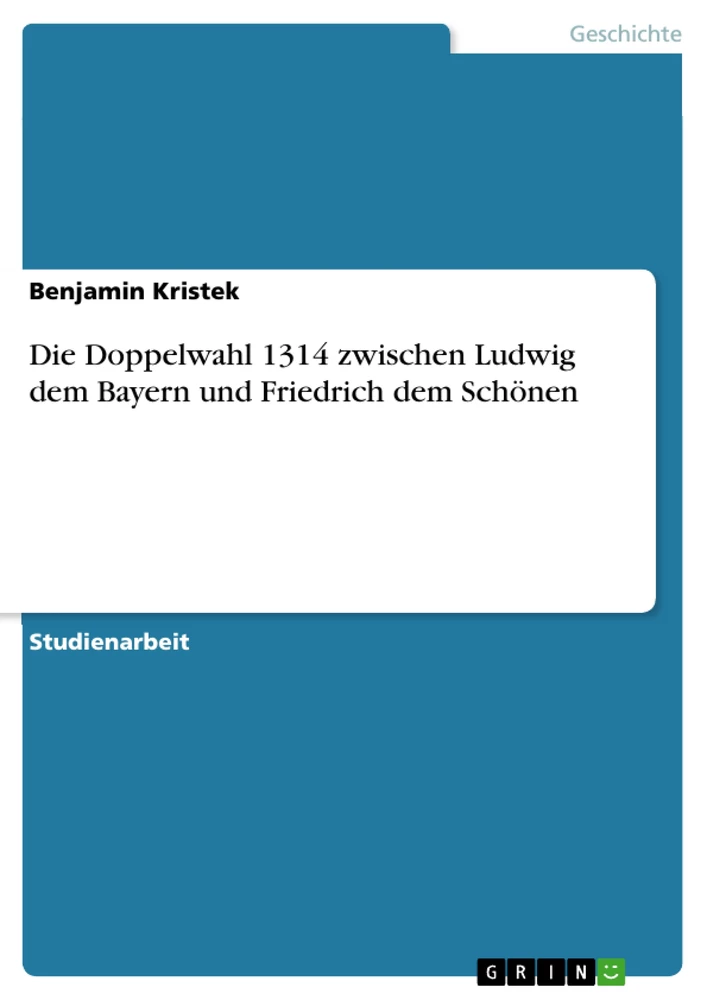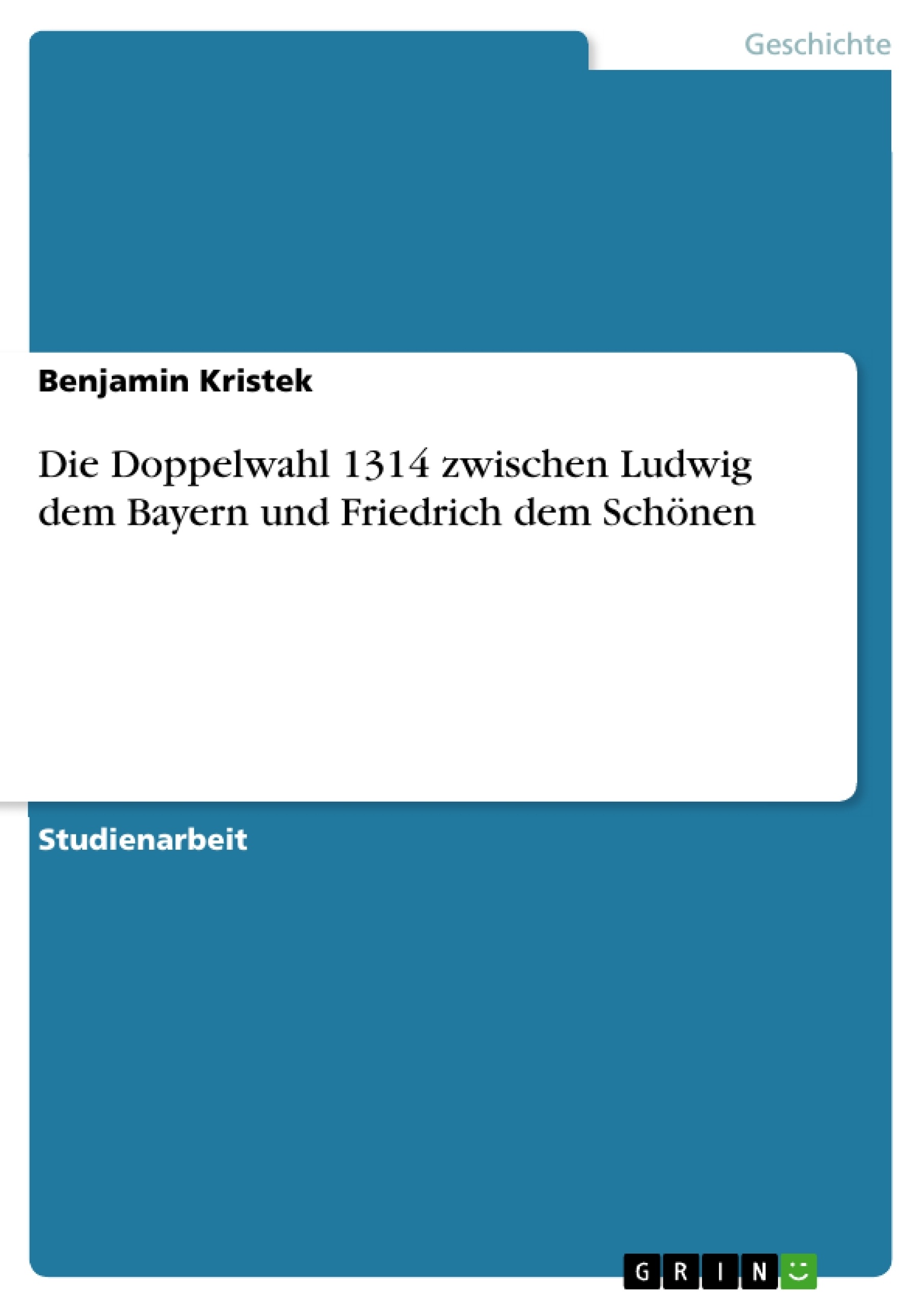Mit der Doppelwahl 1314, und der sich daraus ergebenden Niederlage der habsburgischen Dynastie, sollten die Habsburger über hundert Jahre von der höchsten Würde des „Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation“ ausgeschlossen werden, bis sie mit König Albrecht II. (R 1438-1439) wieder einen deutschen König stellten. Es soll gezeigt werden, welche Bedingungen zur Doppelwahl 1314 führten, daß nämlich die vier rheinischen Kurfürsten die Initiative bei der Suche und Unterstützung der Königskandidaten innehatten, daß verschiedenartige Bündnisabsprachen schon im Vorfeld der Wahl auf eine zwiespältige Wahl schließen lassen. Außerdem soll ersichtlich werden, warum der Kandidatenwechsel von König Johann von Böhmen aus dem Hause Luxemburg zu Herzog Ludwig von Oberbayern aus dem Hause Wittelsbach erfolgte, und schließlich findet man, daß die Uneinigkeit im Recht die Kurstimmen auszuführen, wie im Falle Sachsens und Böhmens, einen mehr als marginalen Anteil an der Doppelwahl 1314 hatte. Aus der Untersuchung ausgeschlossen werden die Einflüsse ausländischer Mächte auf die Wahl von 1314, da sie keine zentrale Bedeutung hatten. Desweiteren stellen die ausgewählten Quellen aus der „Monumenta Germaniae Historica“ keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn es gab der Wahlabsprachen sehr viele. Es wurde mehr wert auf exemplarische, den größeren Rahmen verdeutlichende Quellen gelegt.
Inhaltsverzeichnis
I EINLEITUNG
II HAUSMACHTPOLITIK IM VORFELD DER WAHL
II.1 DIE HABSBURGER DYNASTIE
II.2 DIE LUXEMBURGER DYNASTIE
II.3 DIE WITTELSBACHER DYNASTIE
III WAHLVERHANDLUNGEN
III.1 DIE THRONKANDIDATEN
III.2 DIE BÜNDNISPOLITIK DER THRONANWÄRTER
III.3 DER RÜCKTRITT JOHANNS VON BÖHMEN ZUGUNSTEN HERZOG LUDWIGS VON BAYERN
IV DIE DOPPELWAHL 1314
IV.1 DIE KRÖNUNG DER GEGENKÖNIGE
V SCHLUß
VI LITERATURVERZEICHNIS
I Einleitung
Mit der Doppelwahl 1314, und der sich daraus ergebenden Niederlage der habsburgischen Dynastie, sollten die Habsburger über hundert Jahre von der höchsten Würde des „Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation“ ausgeschlossen werden, bis sie mit König Albrecht II. (R 1438-1439) wieder einen deutschen König stellten. Es soll gezeigt werden, welche Bedingungen zur Doppelwahl 1314 führten, daß nämlich die vier rheinischen Kurfürsten die Initiative bei der Suche und Unterstützung der Königskandidaten innehatten, daß verschiedenartige Bündnisabsprachen schon im Vorfeld der Wahl auf eine zwiespältige Wahl schließen lassen. Außerdem soll ersichtlich werden, warum der Kandidatenwechsel von König Johann von Böhmen aus dem Hause Luxemburg zu Herzog Ludwig von Oberbayern aus dem Hause Wittelsbach erfolgte, und schließlich findet man, daß die Uneinigkeit im Recht die Kurstimmen auszuführen, wie im Falle Sachsens und Böhmens, einen mehr als marginalen Anteil an der Doppelwahl 1314 hatte. Aus der Untersuchung ausgeschlossen werden die Einflüsse ausländischer Mächte auf die Wahl von 1314, da sie keine zentrale Bedeutung hatten. Desweiteren stellen die ausgewählten Quellen aus der „Monumenta Germaniae Historica“ keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn es gab der Wahlabsprachen sehr viele. Es wurde mehr wert auf exemplarische, den größeren Rahmen verdeutlichende Quellen gelegt.
II Hausmachtpolitik im Vorfeld der Wahl
Als nach dem großen Interregnum (1256-1273) mit Rudolf I. von Habsburg (R 1273-1291) wieder ein deutscher Fürst zum König gewählt wurde, da hatten sich bereits die sieben Kurfürsten als Wähler durchgesetzt1, auch wenn dies erst in der „Goldenen Bulle“ Kaiser Karls IV. 1356 rechtlich festgelegt werden sollte. Die sieben Kurfürsten waren: die Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier auf der geistlichen Seite und der Pfalzgraf bei Rhein, der Herzog von Sachsen, der Markgraf von Brandenburg und der König von Böhmen auf der weltlichen Seite. Bei der Königswahl hatten diese nicht mehr das Geblütsrecht zu berücksichtigen und wählten dementsprechend Könige aus wechselnden Dynastien, um zum Einen ihre eigene Machtposition zu festigen, und zum Anderen eine Machtkonzentration nur einer Herrscherfamilie im Reich zu unterbinden. Den Königen des Spätmittelalters ging zunehmend das Reichskammergut als materielle Machtgrundlage verloren2. Alle deutschen Könige, ob Habsburger, Luxemburger oder Wittelsbacher, waren seitdem darauf angewiesen sich eine starke Hausmacht zu schaffen3.
II.1 Die Habsburger Dynastie
Den Grundstein zum Aufstieg des habsburgischen Hauses legte Rudolf I., als er 1278 seinen Rivalen den Böhmenkönig Ottokar II. besiegte und die Länder Österreich, die Steirmark, Kärnten und Krain seinen Söhnen zum Lehen gab4. Rudolfs Sohn, Albrecht I. von Habsburg, kam erst 1298-1308, nach einem Zwischenspiel von Adolf von Nassau, wieder an die deutsche Königswürde. Auch Albrecht I. vermachte seinen Söhnen Österreich, Steiermark, Krain, die Windische Mark und desweiteren Pordenone5. Von Friedrich, dem mittlersten seiner Söhne, wird noch zu sprechen sein. Man kann also davon ausgehen, daß die Habsburger, durch den zweimaligen Genuß der Königswürde und die damit verbundenen Gebietserweiterungen, auch weiterhin an der Königswürde interessiert sein werden6.
II.2 Die Luxemburger Dynastie
Neben den Habsburgern und oftmals in Konkurrenz mit ihnen schufen sich die Luxemburger eine Hausmacht, nämlich als es König Heinrich VII. (R 1308- 1313) gelang, Böhmen in luxemburgischen Besitz zu bringen. Einen großen Anteil am Aufstieg des Hauses Luxemburg hatte allen voran der Bruder Heinrichs VII., der Erzbischof Balduin von Trier7. Heinrich ließ seinen Sohn Johann, der bei der Doppelwahl 1314 auch noch eine gewichtige Rolle spielen sollte, zum böhmischen König krönen und sicherte seiner Familie mit diesem Schritt ein umfassendes Territorium. Als Heinrich VII. am 24. August 1313 auf seinem Italienzug verstarb, durfte sich die luxemburgische Dynastie, gestützt auf ihre starke Hausmacht, durchaus Hoffnungen auf eine weitere Kandidatur machen.
II.3 Die Wittelsbacher Dynastie
Probleme unter den Söhnen des Pfalzgrafen Otto II. hatten 1255 zur ersten Teilung der wittelsbachischen Territorien geführt. Ludwig der Strenge erhielt Oberbayern und die Pfalzgrafschaft bei Rhein, sein Bruder Heinrich XIII. erhielt Niederbayern8. Nach dem Tode Ludwigs des Strengen bekam sein Sohn Rudolf die Pfalzgrafschaft und Ludwig erhielt Oberbayern.
Pfalzgraf Rudolf versuchte in der Folgezeit immer wieder den Anschluß an die herrschende Königsdynastie, verkrachte sich allerdings mit Albrecht I. und der Habsburgerdynastie im Allgemeinen9, was sich zur Wahl 1314 noch ändern sollte. Ludwig war am habsburgischen Hof zusammen mit oben genanntem Friedrich von Habsburg erzogen worden, was ihm wiederum eine habsburgfreundliche Tendenz einbrachte, bis er im Vormundschaftsstreit um Niederbayern gegen Friedrich militärisch vorgehen mußte10. So gesehen war Ludwig nicht von vorneherein auf den Königsthron fixiert, sondern an der Erweiterung seiner bayerischen Vormachtstellung interessiert. Allein mit dem Tode Heinrich VII. und den dadurch entstandenen Wirren um einen akzeptablen Thronkandidaten, kam Herzog Ludwig durch die Überlegung der Erzbischöfe von Mainz und Trier ins Spiel, um dem Thronanwärter König Johann von Böhmen nicht einen Kampf um zwei Reiche zuzumuten.
III Wahlverhandlungen
Wenn es galt einen neuen König des „Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation“ zu wählen wurde dessen Herrscherschicht mobil11 und verbreitete eine bienenartige Geschäftigkeit im Suchen von Wahlbündnissen. Die Wahlpolitik lag vornehmlich in den Händen der Erzbischöfe von Köln, Trier und Mainz, sowie dem Pfalzgrafen bei Rhein, denn schon „der Ort (Rhens - Anm. des Verf.) der Wahlverhandlungen von 1308,1314 und 1346 zeigt die Dominanz der rheinischen Kurfürsten“12.
Rhens, der Ort, an dem dreimal über die Thronkandidaten verhandelt wurde, lag zentral zwischen trierischen, pfälzischen und mainzischen Besitzungen und näher an Köln, als an den östlichen Kurfürstentümern Sachsen, Brandenburg und dem Königreich Böhmen13.
III.1 Die Thronkandidaten
König Johann von Böhmen waren, nach dem Aufbruch seines Vaters Heinrich VII. nach Italien, die Reichsgeschäften in Deutschland übertragen worden. Er bewarb sich folgerichtig als erster um die deutsche Königskrone14. Mitte September schickte Johann zwei Gesandte zum Erzbischof Peter von Mainz, um ihn zu einer Unterredung nach Würzburg zu laden. Dieser war augenscheinlich auch bereit die Kandidatur Johanns zu unterstützen, denn er übernahm die Regierungsgeschäfte in Böhmen, damit Johann im Westen des Reiches weitere Unterstützungsbündnisse suchen konnte15. Balduin von Trier, der Onkel Johanns und Inhaber der Kurstimme des Erzbistums Trier, war an einem weiteren König luxemburgischer Abstammung interessiert, entstammte er doch selbst dieser Linie und durfte Vorteile zugunsten seines Hochstifts erwarten, wenn der König seiner Verwandtschaft entstammte.
Gleich nach dem Tode Heinrichs VII. begannen die Habsburger für die Erhebung Friedrichs, des ältesten noch lebenden Sohnes Albrechts I., zu arbeiten16.
Auch Rudolf, Pfalzgraf bei Rhein, liebäugelte mit dem deutschen Königthron, sah aber im Verlauf der Verhandlungen davon ab und schloß sich gegen Geld - und Landabsprachen der habsburger Partei an.
Der Kölner Erzbischof Heinrich von Virneburg ermunterte Ludwig von Nevers sich um das Königtum zu bemühen, was wiederum Graf Wilhelm von Hennegau veranlaßte, ebenfalls als Thronkandidat aufzutreten17. Jedoch sollten auch die beiden niederdeutschen Thronbewerber ihre Chancenlosigkeit bald einsehen. Die Kandidatur mußte also zwischen dem Haus Luxemburg und dem Haus Habsburg entschieden werden.
III.2 Die Bündnispolitik der Thronanwärter
Auf der luxemburgischen Seite fanden sich die Stimmen der Erzbischöfe von Trier und Mainz, sowie des Königs von Böhmen selbst. Die Habsburger konnten auf die Kurstimme des Pfalzgrafen bei Rhein zählen18 und wußten auch Erzbischof Heinrich von Köln schließlich auf ihre Seite zu ziehen19, da dieser einer luxemburgischen Thronfolge von vorneherein skeptisch bis ablehnend gegenüberstand und sich von seinen Kollegen aus Mainz und Trier in den Verhandlungen von Rhens nicht umstimmen lassen konnte20.
Ab diesem Zeitpunkt sollte es den beiden Parteien darum gehen, die verbleibenden Kurstimmen von Sachsen und Brandenburg für ihre Politik zu gewinnen. Hier tat sich nun das Problem auf, das die Doppelwahl 1314 mitbestimmte. Denn im sächsischen Haus stritten eine lauenburgische und eine wittenbergische Linie um das Vorrecht zur Ausübung der Kurstimme. In Brandenburg machte Markgraf Heinrich von Landsberg dem Markgraf Woldemar von Brandenburg die Kurstimme streitig. In den folgenden Verhandlungen schloß sich Rudolf von Sachsen-Wittenberg der habsburgischen Partei an, während Johann von Sachsen- Lauenburg in Bündnisse mit den Erzbischöfen von Mainz und Trier (indirekt also mit der luxemburgischen Seite) eintrat21. Oben genannter Markgraf Heinrich verpflichtete sich am 1. Mai 1314 in Speyer entweder Herzog Friedrich von Österreich oder dessen Bruder Leopold zu wählen22, allerdings übte er sein Recht auf die Kür des deutschen Königs, auf Grund territorialer und finanzieller Zusagen Markgraf Woldemars und Peter von Mainz nicht aus. Obwohl Markgraf Woldemar von Brandenburg am 18.November 1313 dem Erzbischof von Köln versprochen hatte, in der zukünftigen Königswahl mit ihm gemeinsam zu stimmen23, so erreichte Erzbischof Peter von Mainz im März 1314 einen Wechsel des Bündnisses, indem er Woldemar konkrete Unterstützung in der Frage des Kurstimmenstreites und finanzielle Vergütung versprach24. Woldemar brach nicht offiziell die Absprache mit Erzbischof Heinrich von Köln, sondern beteuerte in einer Urkunde vom 4.Juni 1314, daß er diesen Schritt nur tat, um einer zwiespältigen Wahl vorzubeugen25, was ihm allerdings nicht gelang.
Wenngleich auch inoffiziell feststand, daß die sieben Kurfürsten das Recht besaßen, den deutschen König zu wählen, so konnte sich trotzdem eine Doppelwahl ereignen, wenn nicht auszumachen war, wer denn das Recht zur Ausübung der Kurstimme de iure wahrnehmen durfte.
III.3 Der Rücktritt Johanns von Böhmen zugunsten Herzog Ludwigs von Bayern
Eine dritte Tagung in Rhens am 5.Juni 1314 brachte keine Annäherung zwischen den beiden Parteien26. Heinrich von Köln plädierte nach wie vor für Herzog Friedrich von Österreich, während Peter von Mainz und Balduin von Trier an der Kandidatur König Johanns von Böhmen festhielten. Lediglich der Wahltag wurde von Peter von Mainz, dem als Erzkanzler das Recht der Einberufung zur Wahl oblag, auf den 19.Oktober 1314 festgelegt27. Danach trennte man sich.
Ab dem 4.August 1314 wurde nun Ludwig der Bayer als neuer Thronprätendent in den Verhandlungen geführt28. Was veranlaßte diesen Kandidatenwechsel? König Johann von Böhmen sollte angeblich zu jung gewesen sein, um zum deutschen König gewählt zu werden29. Diese These widerlegt Huber, der den achtzehnten Geburtstag, und somit die Mündigkeit Johanns, auf den 10.August 1314 festlegt30. Schubert meint die Erklärung unter anderem darin zu finden, daß dem luxemburgischen Haus zu diesem Zeitpunkt noch keine Nachfolger beschert worden waren, die zu etwaigen „Eheabsprachen“31 und Bündnissen hätten herangezogen werden können.
Die stichhaltigste These liefert jedoch Thomas, wenn er davon ausgeht, daß man auf der luxemburgischen Seite Gefahr lief, „das gerade erst erworbene Königreich Böhmen“32 wieder zu verlieren. König Johann konnte nicht gleichzeitig um Böhmen und das Deutsche Reich kämpfen. Und das es zu einer Doppelwahl, die durch Kampf entschieden werden mußte, kommen sollte, war allen Beteiligten zweieinhalb Monaten vor dem Wahltag ersichtlich. Herzog Ludwig von Oberbayern schien dafür prädestiniert zu sein, hatte er doch bereits in der Schlacht bei Gammelsdorf 1313 seinen Rivalen Herzog Friedrich von Österreich besiegt und sich die Vormundschaft über Niederbayern erstritten33.
Es ist auch anzunehmen, daß man „brüderliche Gefühle“34 beim Pfalzgrafen Rudolf, dem Bruder Ludwigs, wecken und somit eine weitere Kurstimme auf Ludwig vereinen wollte. Also verständigte man sich auf Seiten der Erzbischöfe von Mainz und Trier auf Ludwig und erneuerte die Wahlbündnisse in seinem Namen.
IV Die Doppelwahl 1314
Am vereinbarten Wahltermin, dem 19.Oktober 1314 bezogen die Wähler und die Gefolgschaft um Herzog Ludwig das linke Mainufer, welches sie, im Wahldekret an den Papst, den rechten Ort dafür nannten35. Unter den Versammelten befanden sich die Erzbischöfe von Trier und Mainz, König Johann von Böhmen und Polen, Woldemar, Markgraf von Brandenburg, Johann, Herzog von Sachsen und selbstverständlich der Thronanwärter Herzog Ludwig von Bayern. Die Gegenpartei um Herzog Friedrich hatte ihr Königslager auf dem gegenüberliegenden Mainufer aufgeschlagen. Ein erstes Zeichen, das man es auf eine zwiespältige Wahl abgesehen hatte. Zudem waren beide Prätendenten mit stark bewaffneter Gefolgschaft angerückt36. In der Gefolgschaft Friedrichs fanden sich der Erzbischof von Köln, Rudolf, der Pfalzgraf bei Rhein, Rudolf, Herzog von Sachsen, sowie Heinrich von Kärnten, der zwar als böhmischer König 1307 abgesetzt worden war, jetzt aber wieder in Erscheinung trat, um für Friedrich die böhmische Kurstimme zu vergeben37.
Der Erzbischof von Trier unternahm einen letzten Versuch die Wahl zusammen zu bestreiten und schickte einen Boten mit der Nachricht zum Erzbischof von Köln, daß dieser sich mit allen die es sonst noch angeht, am nächsten Tag, dem 20.Oktober, im Lager Ludwigs einfinden möchte38. Allein, man hatte bereits Friedrich zum neuen König gewählt. Auf Seiten des Wittelsbachers wartete man vergebens bis zum 20.Oktober, bis schließlich auch Ludwig von den Anwesenden Kurfürsten gewählt wurde. Das Reich besaß somit zwei rechtmäßig gewählte Könige. Sicherlich hatte Ludwig auf seiner Seite fünf Stimmen für sich, während Friedrich derer nur vier aufweisen konnte, allerdings galt das Mehrheitswahlrecht in diesen Zeiten noch nicht39. Mögen auch nur die Stimmen des Pfalzgrafen und die des Erzbischofs von Köln unanfechtbar für Friedrich stehen, während Ludwig die unangreifbaren Kurstimmen der Erzbischöfe von Mainz und Trier, des Königs von Böhmen und des Markgrafen von Brandenburg besaß - es gab de facto zwei erwählte Könige. Da der höchste apostolische Stuhl in Rom vakant war, so konnte auch nicht auf eine Entscheidung des Papstes gewartet werden. Ein Waffengang der beiden Könige schien zwangsläufig kommen zu müssen. Ersteinmal kam es jedoch zur Krönung der beiden Könige und zu einem weiteren Kuriosum.
IV.1 Die Krönung der Gegenkönige
Am 25.November 1314 wurden beide Gegenkönige feierlich gesalbt. Seit Generationen war es das Privileg des Kölner Erzbischof den gewählten König in Aachen zu krönen und zu salben. Zwar wurde Friedrich nun vom rechtmäßigen Coronator, dem Erzbischof Heinrich von Köln, zum König gekrönt, allerdings in St.Cassius bei Bonn, weil Ludwig am rechtmäßigen Ort, also Aachen, gekrönt wurde, jedoch vom Erzbischof Peter von Mainz. Zudem hatte Friedrich die echten Reichskleinodien zur Krönung verfügbar40. Keiner der beiden Gegenkönige konnte sich also auf eine Krönung berufen, wie sie der Tradition entsprach, aber beide konnten ihre Wahl als rechtmäßig darstellen.
Die Frage, welcher der beiden gewählten und gekrönten Gegenkönige der rechtmäßige sei, mußte schon für die Zeitgenossen unentschieden gewesen sein, zumindest bis ein Gottesurteil einen der beiden Könige im Kampf als Sieger hervorgehen lies.
V Schluß
Der Thronstreit war mit der Krönung der Gegenkönige noch lange nicht abgeschlossen und sollte sich erst am 28.September 1322 in der Schlacht bei Mühldorf zugunsten Ludwigs entscheiden41. Aber die Doppelwahl 1314 hat gezeigt, daß den rheinischen Kurfürsten erste Priorität in der „königsmachenden“ Politik zukam.
Auf Grund des eingeschränkten Umfanges wurden die machtpolitischen und territorialen Zusagen der Gegenkönige in den Wahlverhandlungen nicht deutlicher angesprochen. Aber man kann sich vorstellen, das sich die Kurfürsten ihre Kurstimme teuer bezahlen ließen. Desweiteren ist die Ursache des Kandidatenwechsel von Johann von Böhmen zu Ludwig von Bayern zwar komplex und multikausal, aber hauptsächlich bedingt durch die unsichere Herrschaftslage des Böhmenkönigs in seinen Landen. Man konnte weiterhin erkennen, daß die „offene Verfassung“42 des Spätmittelalters zwar schon eine Beschränkung auf sieben Kurfürsten kannte, aber nicht verhindern konnte, daß dieselbe Kurstimme von mehr als einer Person beansprucht wurde, und somit die Möglichkeit zu Doppelwahlen herausforderte. Dieses Problem sollte erst in der Goldenen Bulle 1356 geklärt werden, indem den Kurfürstentümer der Status der Unteilbarkeit zugesprochen wurde.
Interessant ist, daß die Habsburger nach der Niederlage im Thronkampf für mehr als hundert Jahre vom deutschen Königsthron ausgeschlossen waren. Vielleicht lag in der Kränkung, die dieser Ausschluß zweifelsohne gebracht hatte, der Grund für den späteren unaufhaltsamen Aufstieg Habsburgs zur allumfassenden Weltmacht?
Literaturverzeichnis
1.Quellen
Monumenta Germaniae Historica (MGH), Legum Sectio IV, Constitutiones et Acta Publica Imperatorum et Regum, Tomus 3, Tomus 5, ed. Schwalm, Jakob, Hannover 1981 (unveränderter Nachdruck).
Regesten der Markgrafen von Brandenburg aus askanischem Hause, ed. Krabbo, Hermann, Winter, Georg, Berlin-Dahlem 1955.
Regesten der Erzbischöfe von Mainz von 1289-1396, Bd.1: 1289-1328, ed. Vogt, Ernst, Leipzig 1913.
Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter, Bd.4: 1304-1332, ed. Kisky, Wilhelm, Bonn 1915.
2. Darstellungen
Huber, Alexander, Das Verhältnis Ludwigs des Bayern zu den Erzkanzlern von Mainz, Köln und Trier (1314-1347), Regensburg 1983.
Krieger, Karl-Friedrich, Die Habsburger im Mittelalter, Stuttgart Berlin Köln 1994.
Krieger, Karl-Friedrich, König, Reich und Reichsreform im Spätmittelalter (Enzyklopädie deutscher Geschichte Bd.14), München 1992.
Lhotsky, Alphons, Geschichte Österreichs. Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts (1281-1358), Graz Wien Köln 1967.
Moraw, Peter, Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung. Das Reich im späten Mittelalter 1250 bis 1490, Frankfurt a.M. Berlin 1989.
Riezler, Siegmund von, Geschichte Bayerns II (1180-1347), Gotha 1880 (Allgemeine Staatengeschichte, Geschichte der europäischen Staaten 20), Reprint Aalen 1964.
Schoos, Jean, Die Familie der Luxemburger. Geschichte einer Dynastie, in: Heyen, Franz-Josef, Balduin von Luxemburg. Erzbischof von Trier - Kurfürst des Reiches (1285-1354) (Festschrift aus Anlaß des 700. Geburtsjahres), Mainz 1985.
Schubert, Ernst, Die deutsche Königswahl zur Zeit Johanns von Böhmen, in: Pauly, Michel, Johann der Blinde. Graf von Luxemburg - König von Böhmen (1296-1346), Luxembourg 1997.
Ders., Kurfürsten und Wahlkönigtum. Die Wahlen von 1308, 1314 und 1346 und der Kurverein von Rhens, in: Heyen, Franz-Josef, Balduin von Luxemburg. Erzbischof von Trier - Kurfürst des Reiches (1285-1354) (Festschrift aus Anlaß des 700. Geburtsjahres), Mainz 1985.
Ders., Königswahl und Königtum im spätmittelalterlichen Reich, in: ZHF hrsg. v. Kunisch, Johannes, Luig, Klaus, Moraw, Peter u.a., Bd 4 1977, S.257-338.
Schütz, Alois, Ludwig der Bayer, in: Heyen, Franz-Josef, Balduin von Luxemburg. Erzbischof von Trier - Kurfürst des Reiches (1285-1354) (Festschrift aus Anlaß des 700. Geburtsjahres), Mainz 1985.
Schrohe, Heinrich, Der Kampf der Gegenkönige Ludwig und Friedrich um das Reich, Berlin 1902 Vaduz 1965.
Thomas, Heinz, Ludwig der Bayer (1282-1347). Kaiser und Ketzer, Regensburg 1993.
[...]
1 Vgl. Schütz, Alois, Ludwig der Bayer, in: Heyen, Franz-Josef (Hg), Balduin von Luxemburg. Erzbischof von Trier - Kurfürst des Reiches (1285-1354), Mainz 1985, S.55.
2 Vgl. Krieger, Karl-Friedrich, König, Reich und Reichsreform im Spätmittelalter, München 1992, (Enzyklopädie deutscher Geschichte 14), S.31f.
3 Vgl. ebd., S.34.
4 MGH Constit. 3 Nr.339, S.325; vgl. auch Lhotsky, Alphons, Geschichte Österreichs. Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts (1281-1358), Wien 1967, S.53.
5 Ebd., S.101.
6 Ebd., S.223.
7 Vgl. Huber Alexander, Das Verhältnis Ludwigs des Bayern zu den Erzkanzlern von Mainz, Köln und Trier (1314-1347), Regensburg 1983, S.7f. ; Schoos, Jean, Die Familie der Luxemburger. Geschichte einer Dynastie., in: Heyen, Franz-Josef (Hg.), Balduin von Luxemburg. Erzbischof von Trier - Kurfürst des Reiches (1285-1354), Mainz 1985, S.134.
8 Vgl. Riezler, Sigmund von, Geschichte Bayerns II (1180-1347) , Gotha 1880 (Allgemeine Staatengeschichte, Geschichte der europäischen Staaten 20), Reprint Aalen 1964, S.105f, 113ff.
9 Vgl. Spindler Max und Kraus, Andreas, Grundlegung und Aufbau 1180-1314, in: Kraus, Andreas (Hg.), Handbuch der Bayerischen Geschichte II, 2.Aufl., München 1988, S.139-143.
10 Siehe Seite 7.
11 Auch auswärtige Mächte zeigten großes Interesse an den deutschen Königswahlen, besonders Phillip der Schöne von Frankreich in den Jahren 1308 und 1314.
12 Schubert, Ernst, Die deutsche Königswahl zur Zeit Johanns von Böhmen, in: Pauly, Michel (Hg), Johann der Blinde. Graf von Luxemburg - König von Böhmen (1296-1346), Luxembourg 1997, S.140, vgl. auch ebd., S.150.
13 Vgl. Thomas, Heinz, Ludwig der Bayer (1282-1347). Kaiser und Ketzer, Regensburg 1993, S.43.
14 Vgl. Schrohe, Heinrich, Der Kampf der Gegenkönige Ludwig und Friedrich um das Reich, Berlin 1902 Vaduz 1965, S.30f.
15 Vgl. Huber, Das Verhältnis, S.11
16 Lhotsky, Alphons, Geschichte, S.223ff.
17 Vgl. Krieger, Karl-Friedrich, Die Habsburger im Mittelalter, Stuttgart Berlin Köln 1994, S.115f. und Huber, Alexander, Das Verhältnis, S.12.
18 MGH Constit. 5 Nr.23, S.22f.
19 MGH Constit. 5 Nr.25ff, S.23ff, §8.
20 Vgl. Huber, Das Verhältnis, S.12ff.
21 Vgl. ebd., S.13ff.
22 MGH Constit. 5 Nr.24, S.23.
23 MGH Constit. 5 Nr.11, S.8.
24 MGH Constit. 5 Nr.20, S17f.
25 MGH Constit. 5 Nr.38, S39.
26 MGH Constit. 5 Nr.39, S.39f.
27 Ebd.,Vgl. auch Huber, Das Verhältnis, S.15.
28 Vgl. ebd.
29 Vgl. Lhotsky, Geschichte, S.224.
30 Vgl. Huber, Das Verhältnis, S.16.
31 Schubert, wie Anm.11, S.142.
32 Thomas, Ludwig der Bayer, S.52f.
33 Lhotsky, Geschichte, S.221 und Riezler, Geschichte Bayerns, S.290ff.
34 Krieger, Die Habsburger, S.116.
35 MGH Constit. 5 Nr.102, S.98-103, §2.
36 Vgl. Schubert, Ernst, Kurfürsten und Wahlkönigtum. Die Wahlen von 1308, 1314 und 1346 und der Kurverein von Rhens, in: Heyen, Franz-Josef (Hg), Balduin von Luxemburg. Erzbischof von Trier - Kurfürst des Reiches 1285-1354, Mainz 1985, S.110.
37 MGH Constit. 5 Nr.95, S.91-93.
38 MGH Constit. 5 Nr.102, S.98-103, §2.
39 Vgl. Schubert, wie Anm.11, S.298ff.
40 Vgl. Lhotsky, Geschichte, S.226f.
41 Ebd., S.271-278.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine Analyse der Doppelwahl von 1314 im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Es untersucht die politischen Hintergründe, die beteiligten Dynastien (Habsburger, Luxemburger, Wittelsbacher), die Wahlverhandlungen, die Thronkandidaten und die Umstände, die zur Wahl von zwei Königen führten. Es wird auch die Krönung der Gegenkönige und die anschließenden Ereignisse bis zur Schlacht von Mühldorf im Jahr 1322 betrachtet.
Welche Dynastien spielten eine wichtige Rolle bei der Königswahl von 1314?
Die Habsburger, Luxemburger und Wittelsbacher waren die bedeutendsten Dynastien im Vorfeld der Wahl. Jede Dynastie versuchte, ihre Hausmacht zu festigen und ihren Kandidaten auf den Thron zu bringen.
Wer waren die Hauptkandidaten für den Thron im Jahr 1314?
Zunächst bewarb sich König Johann von Böhmen aus dem Hause Luxemburg um die Königskrone. Später wurde Herzog Ludwig von Oberbayern aus dem Hause Wittelsbach als Kandidat aufgestellt. Friedrich von Habsburg war der Hauptgegenkandidat.
Warum kam es zur Doppelwahl im Jahr 1314?
Die Doppelwahl resultierte aus Uneinigkeiten zwischen den Kurfürsten, insbesondere den Erzbischöfen von Köln, Mainz und Trier, sowie dem Pfalzgrafen bei Rhein. Es gab auch Streitigkeiten über die Rechtmäßigkeit der Ausübung der Kurstimme durch Sachsen und Brandenburg.
Wer wählte Ludwig von Bayern zum König?
Ludwig wurde von den Erzbischöfen von Trier und Mainz, König Johann von Böhmen und Polen, Woldemar, Markgraf von Brandenburg, und Johann, Herzog von Sachsen gewählt.
Wer wählte Friedrich von Habsburg zum König?
Friedrich wurde vom Erzbischof von Köln, Rudolf, dem Pfalzgrafen bei Rhein, Rudolf, Herzog von Sachsen, und Heinrich von Kärnten (der die böhmische Kurstimme beanspruchte) gewählt.
Wo und von wem wurden die Gegenkönige gekrönt?
Friedrich wurde vom rechtmäßigen Coronator, dem Erzbischof Heinrich von Köln, in St. Cassius bei Bonn gekrönt. Ludwig wurde vom Erzbischof Peter von Mainz in Aachen gekrönt.
Wie endete der Konflikt zwischen Ludwig und Friedrich?
Der Thronstreit wurde erst am 28. September 1322 in der Schlacht bei Mühldorf zugunsten Ludwigs entschieden.
Welche Bedeutung hatten die rheinischen Kurfürsten bei der Königswahl?
Die rheinischen Kurfürsten (Erzbischöfe von Köln, Trier und Mainz, sowie der Pfalzgraf bei Rhein) spielten eine zentrale Rolle bei der Wahlpolitik und den Verhandlungen. Der Ort der Wahlverhandlungen (Rhens) verdeutlicht die Dominanz der rheinischen Kurfürsten.
Welche Konsequenzen hatte die Doppelwahl für die Habsburger?
Nach der Niederlage im Thronkampf waren die Habsburger für mehr als hundert Jahre vom deutschen Königsthron ausgeschlossen.
- Arbeit zitieren
- Benjamin Kristek (Autor:in), 1999, Die Doppelwahl 1314 zwischen Ludwig dem Bayern und Friedrich dem Schönen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102717