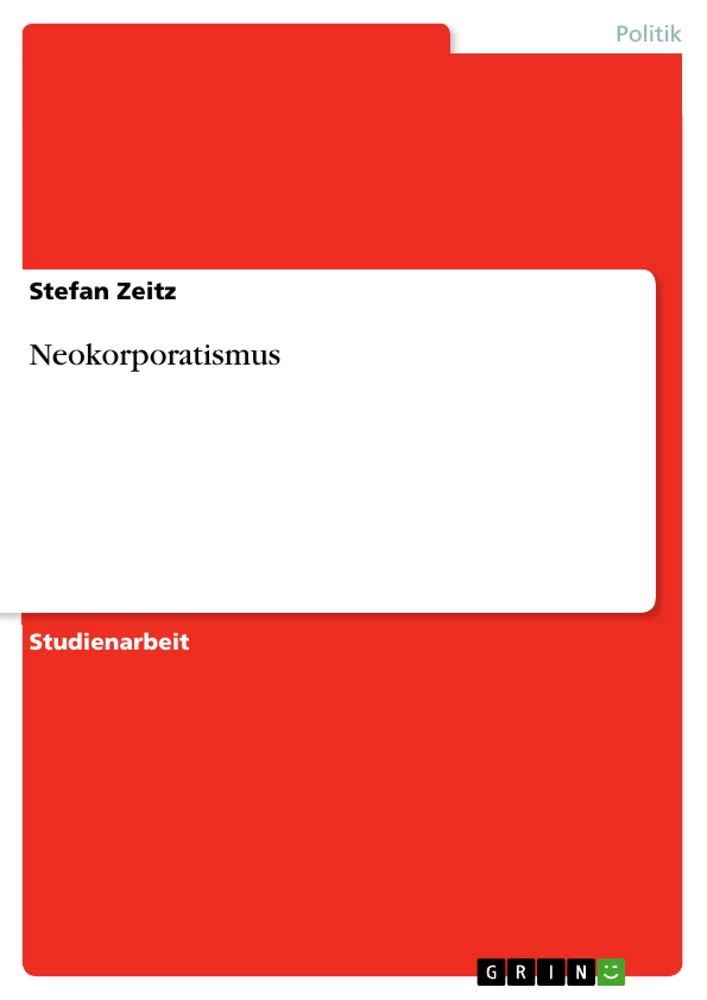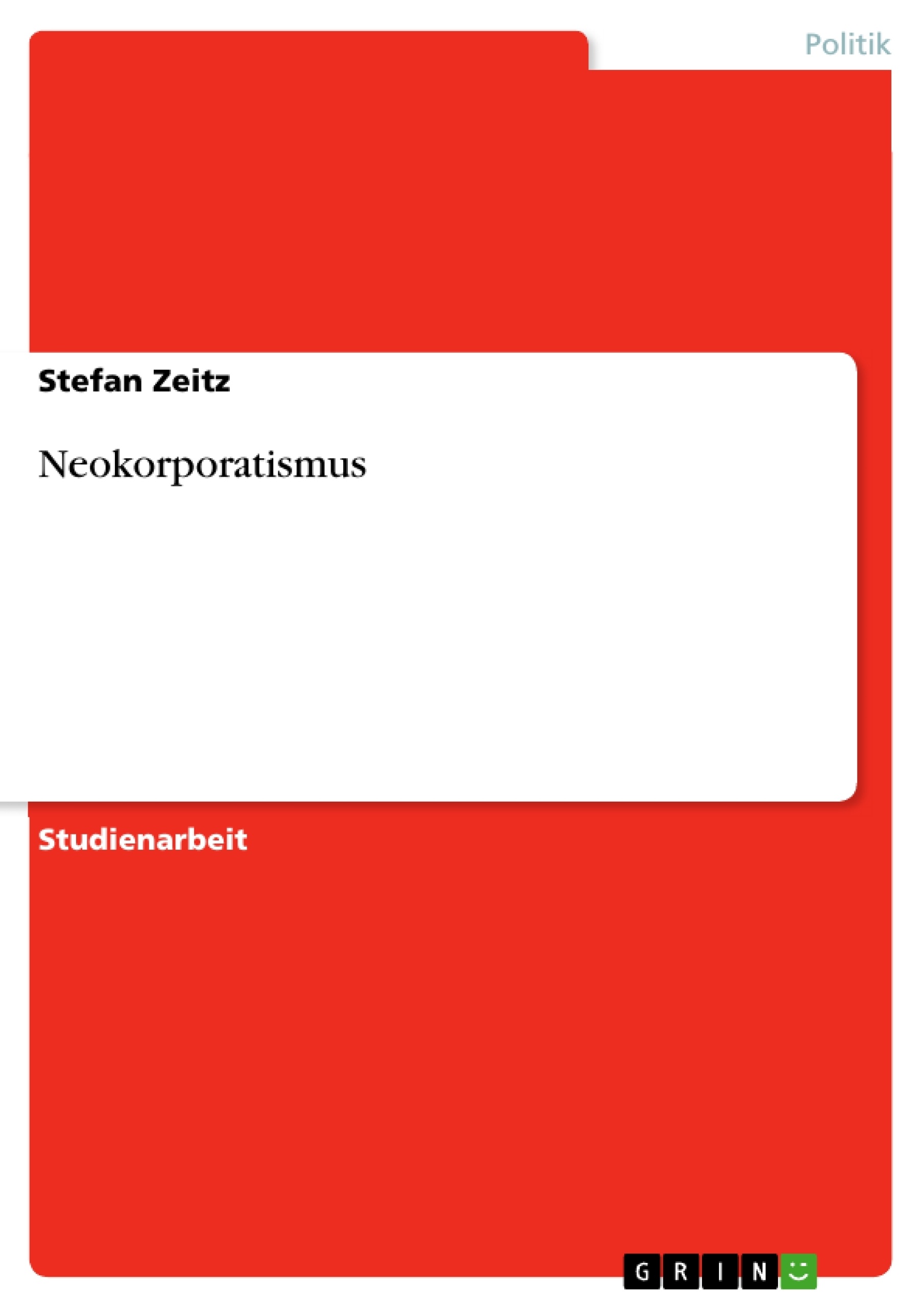Inhalt:
1. Korporatismusbegriff
2. Neokorporatismus
3. Voraussetzungen für korporatistische Strukturen
4. Akteure
5. Ziele
a) Allgemein
b) Der Regierung
c) Der Verbände
6. Pluralismus versus Korporatismus?
7. Probleme
1. Begriffsdefinition
Der Begriff Korporatismus geht ursprünglich zurück auf den Begriff Korporation (lat corporatio = Körperschaft). Dahinter verbirgt sich der „[...] Zusammenschluss von Personen aus gleichem Stand oder Beruf.“1 Im korporativen Staat sind Korporationen die Grundorganisation von Staat und Gesellschaft. Die politische Willensbildung wird von den ständischen Berufs- und Volksgruppen getragen und findet nicht mehr im demokratisch gewählten Parlament statt. In der katholischen Soziallehre sind Korporativsysteme die Antwort auf die soziale Frage. Demnach soll die Gesellschaft in Stände gegliedert sein, „[...] deren Gruppen trotz gleicher Menschenwürde verschiedene Aufgaben haben [...]“2. Soziale Gegensätze sollen durch eine politische und wirtschaftliche Ordnung überwunden werden. Daher wird eine enges Zusammenwirken von privaten und staatlichen Wirtschaftsaktivitäten gefordert. In diesem Jahrhundert hat der Begriff eine Veränderung erfahren. Die Begriffe Staatskorporatismus oder autoritärer Korporatismus standen für die Zwangseinbindung von Verbänden in den Staat. Beispiele hierfür waren die Diktatur in Portugal unter Salazar oder der Faschismus in Italien unter Mussolini.
2. Neokorporatismus
Der Begriff Neokorporatismus tauchte zuerst 1974 in dem Aufsatz von Schmitter „Still the Century of Corporatism?“ auf. Schmitter machte die Beobachtung, „[...] dass Verbände in starkem Maße in Entscheidungsprozesse eingebunden sind und den Staat durch ihre Beteiligung an der Erfüllung öffentlicher Aufgaben entlasten.“3 Die Beteiligung der Verbände ist freiwillig und langfristig ausgelegt. Durch Aushandlung „[...] ergeben sich spezifische Austauschbeziehungen [...]“4 die zu einem abgestimmten Handeln der beteiligten Verbände und des Staates führen. Damit dieses Handeln erfolgreich sein kann müssen verschiedene Kriterien erfüllt sein, auf die ich später noch eingehen werde. Der Begriff Neokorporatismus wurde bewußt gewählt um eine Abgrenzung vom verpönten Staatskorporatismus zu erreichen.
3. Bedingungen
Die idealtypische Struktur des Neokorporatismus ist tripartistisch, d.h. es nehmen Staat, Verband und Gegenverband an den Gesprächen teil. Die beteiligten Verbände müssen zentralistisch organisiert sein und Monopolcharakter haben, d.h. sie benötigen einen hohen Organisationsgrad und eine große Mitgliederzahl, um eine umfassende Durchsetzung der Vereinbarungen zu gewährleisten. Sie müssen hierarchisch strukturiert sein und über hinreichende Sanktionsmöglichkeit gegenüber den Mitgliedern verfügen, damit die Abmachungen auch von der Mitgliedschaft durchgeführt werden.
Die Verbandsspitzen benötigen ein hohes Maß an Führungsfähigkeit, um in ihrer Organisation die unterschiedlichen Interessen zu „kollektiven Gruppeninteressen“5 zu vereinen und somit einen „einheitlichen“ Willen herstellen zu können. Darüber hinaus benötigen die Führungsspitzen das Vertrauen ihrer Mitglieder, um deren Interessen ohne große Rücksprachen halten zu müssen, in den tripartistischen Gesprächen entsprechend einbringen und durchsetzen.
Eine weitere Aufgabe der Verbandsspitzen ist es, die erzielten Ergebnisse den Mitgliedern zu vermitteln. Somit wird den Verbänden „[...] eine intermediäre Stellung zwischen ihren Mitgliedern und dem Staat [...]“ zugewiesen.6 Die Verbände müssen sowohl an der Formulierung als auch Erfüllung staatlicher Politiken beteiligt sein.
Ein weiterer wichtiger Faktor für das Gelingen einer gemeinsamen Konzertierungspolitik ist, daß die teilnehmenden Verbände davon überzeugt sind,daß sie einen gemeinsamen Nutzen aus den Verhandlungen ziehen können.
Unabdingbar für ein Gelingen von korporatistischen Vereinbarungen ist „[...] die Verpflichtungsfähigkeit der Verbände gegenüber ihren Mitgliedern [...]“7. Demzufolge müssen sich die Mitglieder an die Vereinbarungen gebunden fühlen.
4. Akteure
Beteiligter an korporatistischen Strukturen ist das politisch- administrative System (besonders die Regierung, Parlamentsauschüsse, Ministerialverwaltung). Das Besondere daran ist, daß die Regierung nicht mehr nur den Rahmen für die Verhandlungen der Verbandsvertreter setzt oder nur den Schlichterposten übernimmt, sondern aktiv an den Verhandlungen teilnimmt, Einfluss auf das Ergebnis nimmt und auch selbst bereit ist Leistungen zu erbringen.8.Die anderen Beteiligten sind verschiedene Interessengruppen, meist große Verbände, welche die oben genannten Kriterien erfüllen müssen.
5. Ziele
a) Allgemeine Ziele
Die Kernbereiche von korporatistischen Strukturen sind Wirtschaft und Arbeit. Diese Strukturen sind auf „[...] nationaler, zentralstaatlicher Ebene angesiedelt [...]“.9 Dabei sollen makroökonomische Probleme wie Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum und Inflationsrate positiv beeinflußt werden. Mögliche Themenfelder, in denen Vereinbarungen getroffen werden, sind die Bereiche Löhne, Investitionen, Arbeits- und Ausbildungsplätze und politische Rahmenbedingungen.
Aufgrund der Globalisierung der Märkte durch den technisch- wirtschaftlichen Fortschritt im Bereich der Kommunikation und des Transports ist es notwendig geworden, daß die Unternehmen einen Strukturwandel vollziehen. Dieser ist häufig nur mit der Anpassung an die neuen technischen Produktionsmethoden möglich. Dazu bedarf es z.B. Rationalisierungsmaßnahmen, der Abspaltung von Unternehmensteilen und Verlagerung von Produktionsstätten. Durch diese Maßnahmen kann es zu Beschäftigungsproblemen kommen, auf der einen Seite durch Entlassungen und auf der anderen Seite durch einen Fachkräftemangel aufgrund der Vernachlässigung von Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen. Aufgabe von korporatistischen Institutionen oder Bündnissen muss es daher sein, den Spagat hin zubekommen, der das freie Wirken der Marktkräfte nicht behindert und gleichzeitig die Anpassungsprobleme der Gesellschaft abmildert bzw. löst. Durch die Absprachen in solchen Systemen ist es gewährleistet, daß Konflikte, die normalerweise durch Demonstrationen oder Streiks zu lösen versucht werden, in konsensualen Gesprächen gelöst werden. Dies wirkt sich positiv auf den Wirtschaftsstandort eines Landes aus, da Produktionsausfälle niedrig gehalten werden und der soziale Friede gesichert wird.
b) Ziele der Regierung
In den Augen der Öffentlichkeit erscheint eine Regierung, die Verhandlungen zwischen den Interessengruppen vorantreibt als gute Regierung, die bemüht ist die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Probleme des Staates zu lösen. Dies wird aber nur befürwortet, „[...] wenn die Chance besteht, daß solche Verhandlungen einen unbefriedigenden Status quo in mehrheitsfähiger Form, z.B. einem großen Sozialkontrakt, auflösen.“10
Durch die enge Zusammenarbeit mit den Verbänden bekommt die Regierung mehr Informationen, z.B. über gesellschaftliche Stimmungslagen. Sie kann ihre Einflußmöglichkeiten erweitern und erhält weitreichendere Verhandlungsspielräume. Dies gibt ihr „[...] die Möglichkeit [...] übergeordnete Interessen in Gruppenverhandlungen durchzusetzen.“11
Selbst wenn sich gesellschaftliche oder wirtschaftliche Zustände nicht oder nur unwesentlich verändern kann die Regierung dem Wähler vorgaukeln eine „[...] aktive Rolle in korporatistischen Verhandlungen [...]“12 einzunehmen.
In Krisenzeiten ermöglichen korporatistische Institutionen ein Problem genau zu erfassen. Durch den gegenseitigen Austausch wird offensichtlich welche Auswirkungen eventuelle Steuerungsmaßnahmen der Regierung haben könnten. Die Regierung erfährt, wie die einzelnen Partner die gegenwärtige Problemlage interpretieren und was die beteiligten Parteien als Ursache der Schwierigkeiten sehen. Nur wenn es der Regierung gelingt die verschiedenen Interpretationen abzugleichen, kann es zu Einigungen kommen. Weiterhin erhält die Exekutive die Möglichkeit sog. Pakete auszuhandeln, die „[...] die kurzfristig erforderlichen Besitzstandsopfer auf alle verteilt.“13
Die Regierung erhält auch eine größere Manövriermöglichkeit, da sie auch Einzelgespräche führen kann, bei denen schon Vorabeinigungen erzielt werden können. Zeigt sich ein Verband nicht interessiert, kann die Regierung ohne weiteres den anderen Verband ansprechen und dort neue Verhandlungsrahmen aushandeln, denen der andere Verband dann folgen muß.
Die Interessenverbände haben meistens das Anliegen, daß das korporatistische Verhandlungssystem weiterbesteht, da sie ja häufig schon Geld und Arbeit investiert haben und sie durch ihr Mitwirken Legitimationsvorteile erhalten. Dadurch werden die Verhandlungspartner berechenbarer und für staatliche Steuerungswünsche empfänglicher. Wenn organisierte Verbandsinteressen ohne staatliches Mitwirken durchgesetzt werden, geschieht dies häufig auf Kosten außenstehender Dritter. Durch gemeinsame Verhandlungen ist es der Regierung möglich „[...] das von ihr so verstandene Gemeinwohl in die Verhandlungen [...] einzubringen.“14
Auch für eine persönliche Profilierung eines einzelnen Politikers oder Beamten können solche Institutionen dienen. Durch erfolgreiche Verhandlungsführung oder häufiges Auftreten in der Öffentlichkeit, erhält der Einzelne unter Umständen einen „[...] Gewinn an Prestige und an Einfluß in anderen Angelegenheiten [...]“15.
c) Ziele der Verbände
Im Rahmen der Globalisierung und der dadurch möglichen Internationalisierung des Wirtschaftslebens verlieren nationale Verbände, sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerverbände, immer mehr an Macht und Einflußmöglichkeiten. Daher ist ein korporatistisches System eine gute Plattform für Interessenverbände ihre Besitzstände zu wahren und den Status quo zu erhalten. Dies ist oft auch im Sinne der Mitglieder, da diese sich von ihren Errungenschaften ungern trennen wollen bzw. keine Einschnitte hinnehmen wollen. Diese „[...] Status-quo-Interessen [...]“16 sind sehr leicht organisierbar. In den Interessenverbänden dominieren sowohl die etablierten Unternehmer als auch die Arbeitsplatzbesitzer. Es ist weitaus schwieriger die Interessen der Konsumenten zu organisieren. Nahezu unmöglich ist es die Interessen zukünftiger Arbeitnehmer und Unternehmer wahrzunehmen und ihnen Beachtung zu schenken.
Innerorganisatorisch ist es notwendig, daß die Verbandsspitze einen ausreichenden Verhandlungsspielraum besitzt. Ebenso muß die Verbandsspitze in der Lage sein die unterschiedlichen Meinungen und Interessen innerhalb des Verbandes zu „[...] einer einheitlichen Position zu aggregieren.“17 Durch die Beteiligung der Verbandsspitzen an korporatistischen Verhandlungen erhalten sie in ihrer Organisation eine zusätzliche Legitimität, auch aufgrund ihrer scheinbaren Unentbehrlichkeit, da ja korporatistische Institutionen auf längere Zeit angelegt sind und deswegen eine gewisse Personalkontinuität gewährleistet sein muß.
In den Verhandlungen können Interessengruppen der Regierung auch häufig ganz konkrete finanzielle Zuwendungen oder Zugeständnisse bei Gesetzesvorhaben abringen.
6. Pluralismus versus Korporatismus
Im Pluralismus gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Interessengruppen, die ihre jeweils eigene Interessen vertreten. Diese beeinflussen den Staat nur, wollen aber keine gesellschaftliche Macht ausüben. Deshalb können sie ihre Klientel offen vertreten und müssen die Partikularinteressen nicht am Gemeinwohl orientieren. Die Verbände unterhalten keine strukturierten Beziehungen zum Staat, „[...] sondern wirken nur punktuell auf staatliche Entscheidungen ein [...]“18.
Im pluralistischen System fordern die Verbände nur einseitig vom Staat, wohingegen im Neokorporatismus diese auch Aufgaben vom Staat übernehmen. Dadurch müssen sie ihre Interessen auch am Gemeinwohl ausrichten.
Im Pluralismus stehen die verschiedenen Verbände eines gleichen Sektors in Konkurrenz zueinander. Dies läßt sich mit wirtschaftlichem Marktgeschehen vergleichen. Diejenigen Verbände, die am geschicktesten ihre Interessen vertreten und ihre Möglichkeiten und Mittel am effizientesten nutzen, verzeichnen die größten Erfolge ihre Anliegen durchzusetzen. Die anderen Verbände haben dementsprechend kaum Einflußmöglichkeiten. Dies steht im Gegensatz zu neokorporatistischen Strukturen bei denen quasi Monopolverbände, d.h. „[...] Dachverbände, die möglichst alle Interessengruppen eines Sektors integrieren [...]“19, die massgeblichen Akteure sind.
Trotz aller neokorporatistischen Tendenzen kann nicht gesagt werden, daß der Pluralismus verdrängt werden würde. Es bestehen nach wie vor pluralistische Verbändestrukturen und die Verbände treten weiterhin für die Interessen ihrer Mitglieder ein. Nur die Art und Weise wie versucht wird seine Interessen durchzusetzen hat sich dahingegen verändert, daß nicht mehr nur reine „pressure politics“ erfolgt, sondern auch versucht wird mit dem Staat gemeinsam im Konsens eine an den Interessen orientierte Politik zu betreiben. Es gibt Politikfelder, die durch ein institutionales Beziehungsgeflecht gekennzeichnet sind. In diesen kooperiert der Staat mit Verbänden, die ein Repräsentationsmonopol innehaben. Dies läßt sich eher als Neokorporatismus bezeichnen. In anderen Politikfeldern gibt es viele konkurrierende „Pressure Groups“, die eine Vielzahl von Interessen vertreten und auch in ihren Organisations- und Aktionsformen vollkommen unterschiedlich sind. Hier ist eher der Pluralismusbegriff anzuwenden. Da es diese Mischformen gibt, läßt sich sagen, daß der Korporatismus den Pluralismus nicht verdrängt, sondern lediglich erweitert. In der unten stehenden Tabelle sind die Unterschiede der beiden Verbändebegriffe noch einmal dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Übersicht: Pluralismus und Neokorporatismus (Reutter, S. 73)20
7. Probleme
Verbände agieren immer in dem Spannungsfeld zwischen „[...] der Lebenswelt ihrer Mitglieder einerseits und den institutionellen Bedingungen andererseits.“21 Die Interaktionen eines Verbandes folgen einer gewissen Logik, sowohl nach außen als auch nach innen. Diese beiden Logiken sind nur schwer zu vereinbaren. Die Mitgliedschaftslogik bezeichnet das Verhältnis des Verbandes zu seinen Mitgliedern. Dazu gehören Ziel- und Prioritätenfestlegung, „[...] die Erzeugung von Solidarität, die Bereitstellung von Serviceleistungen [...]“22, im Gegenzug aber auch die interne Verpflichtungsfähigkeit und die Kontrolle. Auf der anderen Seite herrscht die Einflußlogik. Dort werden die aggregierten Mitgliederinteressen nach außen repräsentiert und versucht durch gesellschaftlichen Druck durchzusetzen. Noch hinzu kommt „[...] der Austausch mit den politischen Instanzen bzw. anderen Verbänden.“23 Das Mittel mit dem sich die Verbände Gehör verschaffen können sind, neben finanziellen Mitteln und Informationen, das Versprechen des Wohlverhaltens der Mitglieder in wichtigen Auseinandersetzungen. In neokorporatistischen Interessensvermittlungen dominiert, im Gegensatz zu pluralistischen, die Einflußlogik. Daraus ergibt sich für die Verbandsspitzen in neokorporatistischen Systemen ein kaum zu überbrückender Zwiespalt. Werden die Mitgliederinteressen in den Vereinbarungen nicht ausreichend berücksichtigt, könnte es zu Protestaustritten kommen. Werden sie zu stark verfochten, ist ein Konsens in den Verhandlungen nur sehr schwer möglich. Damit eine Vereinbarung stabil ist, müssen alle Beteiligten mit ihr zufrieden sein. Wenn die Verbandsspitzen in ständiger Sorge sein müssen, ihre Basis zu verlieren, kann kein korporatistisches Arrangement stabil sein.
Die Bindungsfähigkeit von Beschlüssen ist ein weiteres Problemfeld. Diese sind im Grunde nur Absprachen und unterliegen somit nicht dem Recht, weshalb sich die Erfüllung nicht einklagen läßt. Diese Vereinbarungen haben „[...] allenfalls eine politische Bindungskraft.“24 Die Bindung kann auch im Höchstfall nur alle Mitglieder umfassen. Die Bindungswirkung von Absprachen ist aufgrund zweier Tatsachen nicht komplett gewährleistet. Zum einen leiden Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerverbände in den letzten Jahren an massiven Mitgliederverlusten. Zum anderen sind die Gewerkschaften in tripartistischen Bündnissen schwächer als die Unternehmerverbände. Die Gewerkschaften haben eine bessere Möglichkeit ihre Mitglieder auf die Vereinbarungen zu verpflichten als die Gegenseite. Deshalb sind sie steuerbarer. Wenn niedrigere Lohnzuwächse vereinbart werden um neue Arbeitsplätze zu schaffen, so kann die Gewerkschaftsführung ohne große Probleme die Mitglieder von der Notwendigkeit der Zurückhaltung überzeugen. Die Unternehmensverbände haben diese Einwirkung auf ihre Mitglieder nicht. Die einzelnen Mitglieder können nicht gezwungen werden neue Arbeitsplätze zu schaffen, „[...] sofern Auftragslage und Gewinnsituation das nicht hergeben.“25 Diese Argumentation beruht auf der Tatsache, daß Unternehmen ihre ökonomischen Interessen hauptsächlich über den Markt durchsetzen und sich auch nur an der Marktsituation orientieren. Der Verband spielt nur eine nachgeordnete Rolle.
Eine weitere Gefahr ist die Verzögerung von marktkonformen Lösungen, die eine Antwort auf den technischen Wandel und die neuen wirtschaftlichen Herausforderungen geben. Dazu wäre es erforderlich Errungenschaften einzuschränken. Dies ist den Verbänden aber nicht möglich, da den Verbandsspitzen ansonsten das Vertrauen entzogen würde. Dies führt zu einem Festhalten am Status quo und bewirkt somit auch eine Reformunfähigkeit. Da die neokorporatistischen Strukturen auf Dauer angelegt sind und sehr starre Interaktionsmuster aufweisen ist auch ein flexibles Reagieren auf neue Begebenheiten schwierig. Auch wenn Vereinbarungen getroffen werden gehen diese häufig zu Lasten Dritter. Sei es bei der Vorruhestandsregelung, die zukünftige Generationen belasten wird oder Schaffung von geförderten Arbeitsplätzen, die den Steuerzahler belasten. Häufig sind die Teilnehmer, ganz besonders Regierungen kurz vor Wahlen, an schnellen Erfolgen interessiert. Dadurch können Regierungen aufzeigen, was sie alles für die Gesellschaft getan haben, auch wenn die längerfristigen Folgen nicht komplett durchdacht waren. Verbände können durch schnelle Abmachungen ihre Stärke demonstrieren und erhalten dadurch ein besseres Ansehen in der Öffentlichkeit und eine neue Legitimität bei ihren Mitgliedern.
Zuletzt kann auch eine Gefahr für die demokratisch- politische Grundordnung bestehen. Obwohl die Verbände lediglich „Interessengemeinschaften“ ohne jegliche demokratische Legitimation sind, treffen sie annähernd verbindliche Vereinbarungen mit der Regierung, die aber dann nicht nur ihre Mitglieder betreffen, sondern die ganze Bevölkerung. Die Regierung gerät „[...] unter Druck, direkt oder indirekt Befugnisse an Interessengruppen abzugeben.“26
Da an den Verhandlungen häufig nur der Fachminister mit seinen dazugehörigen Ministerialbeamten teilnimmt, können nicht alle Abmachungen mit dem Regierungschef, der die Richtlinienkompetenz besitzt, abgesprochen werden. Somit gehen solche Beschlüsse sowohl am Kabinett als auch am Parlament vorbei und entbehren jeglicher demokratischer Kontrolle, die in der Verfassung eigentlich vorgesehen ist. „Die formale Legitimation des Parlaments wird ersetzt durch die faktische Legitimität korporatistischer Arrangements.27 “
Literaturverzeichnis:
Alemann, Ulrich. von., Vom Korporatismus zum Lobbyismus? in ApuZ B 26/27, 2000, S.3-6.
Alemann, Ulrich. von.(Hrsg.),Neokorporatismus, Frankfurt/ New York 1981
Drechsler, Hanno (u. a., Hrsg.), Gesellschaft und Staat. Lexikon der Politik. Baden- Baden 71989. Matuschek, Gerald, Neokorporatismus als Form politischer Steuerung. Eine Hausarbeit im Rahmen des Hauptseminars „Theorien politischer Steuerung“. Leiter: Prof. Dr. H. Wiesenthal, Berlin 1998. Münchow, Andreas, von, Funktion von Verbänden und Medien in demokratischen Systemen. Eine Hausarbeit im Rahmen des Proseminars „Einführung in die politische Wissenschaft“. Leiter: Herr Schünemann, Kiel 1999
Möschel, Wernhard (u.a., Hrsg.), Aktuelle Formen des Korporatismus. Ein Gutachten des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Berlin 2000.Veröffentlicht auf der Web- site:
http://www.bmwi.de/Homepage/Das%20Ministerium/Beir%e4te/beirat_publikationen.jsp#korp
Reutter, Werner, Organisierte Interessen in Deutschland, in ApuZ B 26/27, 2000, S.7- 15.
Schmid, J., Verbände: Interessenvermittlung und Interessenorganisation. München1999. S. 38ff.. Zitiert nach: http://www.uni-tuebingen.de/pol/kd98s.htm.
Weßels, Bernhard, Die Entwicklung des deutschen Korporatismus, in: ApuZ B 26/27, 2000, S. 16-21. http://www.verbaende.com/Management/sozialkapital.htm
[...]
1 Neumann, Franz, Korporatismus. In: Drechsler, Hanno (u. a., Hrsg.), Gesellschaft und Staat. Lexikon der Politik. Baden- Baden 71989. S. 407.
2 Hilligen, Wolfgang, Katholische Soziallehre. In: Drechsler, Hanno (u. a., Hrsg.), Gesellschaft und Staat. Lexikon der Politik. Baden- Baden 71989. S.370f. .
3 Kirberger, Wolfgang, Staatsentlastung durch Verbände. Baden-Baden. 1978. O. S. .Zitiert nach: Weßels, Bernhard, Die Entwicklung des deutschen Korporatismus. In: ApuZ B 26/27, 2000, S.17
4 Weßels, Bernhard, Die Entwicklung des deutschen Korporatismus. In: ApuZ B 26/27, 2000, S.17
5 Matuschek, Gerald, Neokorporatismus als Form politischer Steuerung. Eine Hausarbeit im Rahmen des Hauptseminars „Theorien politischer Steuerung“. Leiter: Prof. Dr. H. Wiesenthal, Berlin 1998.
6 ebd.
7 Weßels, Bernhard, Die Entwicklung des deutschen Korporatismus. In: ApuZ B 26/27, 2000, S.20
8 Möschel, Wernhard (u.a., Hrsg.), Aktuelle Formen des Korporatismus. Ein Gutachten des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Berlin 2000.
9 Matuschek, Gerald, Neokorporatismus als Form politischer Steuerung. Eine Hausarbeit im Rahmen des Hauptseminars „Theorien politischer Steuerung“. Leiter: Prof. Dr. H. Wiesenthal, Berlin 1998.
10 Möschel, Wernhard (u.a., Hrsg.), Aktuelle Formen des Korporatismus. Ein Gutachten des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Berlin 2000.
11 ebd.
12 ebd.
13 ebd.
14 Möschel, Wernhard (u.a., Hrsg.), Aktuelle Formen des Korporatismus. Ein Gutachten des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Berlin 2000.
15 ebd.
16 ebd.
17 ebd.
18 Matuschek, Gerald, Neokorporatismus als Form politischer Steuerung. Eine Hausarbeit im Rahmen des Hauptseminars „Theorien politischer Steuerung“. Leiter: Prof. Dr. H. Wiesenthal, Berlin 1998.
19 Matuschek, Gerald, Neokorporatismus als Form politischer Steuerung. Eine Hausarbeit im Rahmen des Hauptseminars „Theorien politischer Steuerung“. Leiter: Prof. Dr. H. Wiesenthal, Berlin 1998.
20 ebd.
21 Matuschek, Gerald, Neokorporatismus als Form politischer Steuerung. Eine Hausarbeit im Rahmen des Hauptseminars „Theorien politischer Steuerung“. Leiter: Prof. Dr. H. Wiesenthal, Berlin 1998.
22 ebd.
23 ebd.
24 Möschel, Wernhard (u.a., Hrsg.), Aktuelle Formen des Korporatismus. Ein Gutachten des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Berlin 2000.
25 Möschel, Wernhard (u.a., Hrsg.), Aktuelle Formen des Korporatismus. Ein Gutachten des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Berlin 2000.
26 Möschel, Wernhard (u.a., Hrsg.), Aktuelle Formen des Korporatismus. Ein Gutachten des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Berlin 2000.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Korporatismus laut dieser Analyse?
Der Korporatismus, ursprünglich aus dem Begriff Korporation abgeleitet, bezeichnet den Zusammenschluss von Personen aus gleichem Stand oder Beruf. Im korporativen Staat bilden Korporationen die Grundorganisation von Staat und Gesellschaft, wobei die politische Willensbildung von ständischen Berufs- und Volksgruppen getragen wird. In der katholischen Soziallehre ist er eine Antwort auf die soziale Frage, die eine Gliederung der Gesellschaft in Stände vorsieht, um soziale Gegensätze zu überwinden. Im 20. Jahrhundert entwickelte sich der Begriff weiter, wobei Staatskorporatismus und autoritärer Korporatismus für die Zwangseinbindung von Verbänden in den Staat standen.
Was versteht man unter Neokorporatismus?
Der Neokorporatismus, erstmals 1974 von Schmitter erwähnt, beschreibt die starke Einbindung von Verbänden in Entscheidungsprozesse, wodurch der Staat bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben entlastet wird. Die Beteiligung ist freiwillig und langfristig angelegt, wobei Aushandlungen zu spezifischen Austauschbeziehungen führen, die ein abgestimmtes Handeln von Verbänden und Staat bewirken. Der Begriff wurde bewusst gewählt, um sich vom Staatskorporatismus abzugrenzen.
Welche Bedingungen sind für korporatistische Strukturen erforderlich?
Die idealtypische Struktur des Neokorporatismus ist tripartistisch, d.h. Staat, Verband und Gegenverband nehmen an den Gesprächen teil. Die Verbände müssen zentralistisch organisiert sein und Monopolcharakter haben, d.h. einen hohen Organisationsgrad und eine große Mitgliederzahl aufweisen. Sie müssen hierarchisch strukturiert sein und über hinreichende Sanktionsmöglichkeiten gegenüber den Mitgliedern verfügen. Die Verbandsspitzen benötigen Führungsfähigkeit und das Vertrauen ihrer Mitglieder.
Wer sind die Akteure im Korporatismus?
Beteiligte sind das politisch-administrative System (besonders Regierung, Parlamentsausschüsse, Ministerialverwaltung) und verschiedene Interessengruppen, meist große Verbände, die bestimmte Kriterien erfüllen müssen. Die Regierung nimmt aktiv an den Verhandlungen teil, beeinflusst das Ergebnis und ist bereit, Leistungen zu erbringen.
Welche Ziele verfolgt der Korporatismus allgemein?
Die Kernbereiche sind Wirtschaft und Arbeit auf nationaler Ebene. Ziel ist die positive Beeinflussung makroökonomischer Probleme wie Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum und Inflation. Vereinbarungen können in den Bereichen Löhne, Investitionen, Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie politische Rahmenbedingungen getroffen werden.
Welche Ziele verfolgt die Regierung im Korporatismus?
Die Regierung profitiert von einer positiven Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, erhält mehr Informationen und kann ihre Einflußmöglichkeiten erweitern. Sie kann auch in Krisenzeiten durch den Austausch mit den Verbänden Probleme genauer erfassen und Maßnahmen besser abstimmen. Die Regierung kann Pakete aushandeln, die kurzfristige Opfer auf alle verteilen.
Welche Ziele verfolgen die Verbände im Korporatismus?
Verbände können im Rahmen der Globalisierung ihre Besitzstände wahren und den Status quo erhalten. Die Verbandsspitzen erhalten eine zusätzliche Legitimität in ihrer Organisation und können finanzielle Zuwendungen oder Zugeständnisse bei Gesetzesvorhaben abringen.
Worin unterscheiden sich Pluralismus und Korporatismus?
Im Pluralismus gibt es eine Vielzahl von Interessengruppen, die ihre eigenen Interessen vertreten und nur punktuell auf staatliche Entscheidungen einwirken. Im Neokorporatismus übernehmen die Verbände auch Aufgaben vom Staat und müssen ihre Interessen am Gemeinwohl ausrichten. Im Pluralismus konkurrieren die Verbände, während im Neokorporatismus Monopolverbände die massgeblichen Akteure sind. Korporatismus erweitert den Pluralismus, verdrängt ihn aber nicht.
Welche Probleme können im Korporatismus auftreten?
Verbände agieren im Spannungsfeld zwischen den Interessen ihrer Mitglieder und den institutionellen Bedingungen. Die Bindungsfähigkeit von Beschlüssen ist oft gering, und es besteht die Gefahr der Verzögerung von marktkonformen Lösungen. Vereinbarungen können zu Lasten Dritter gehen, und die demokratisch-politische Grundordnung kann gefährdet werden, da Verbände ohne demokratische Legitimation Vereinbarungen treffen, die die ganze Bevölkerung betreffen.
- Arbeit zitieren
- Stefan Zeitz (Autor:in), 2000, Neokorporatismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102665