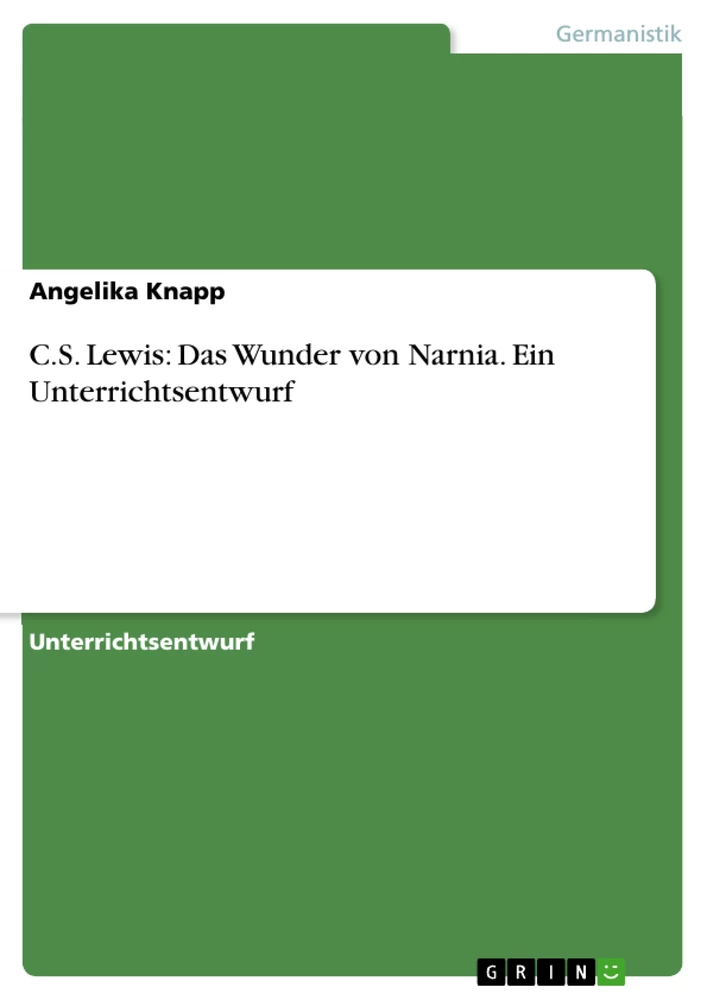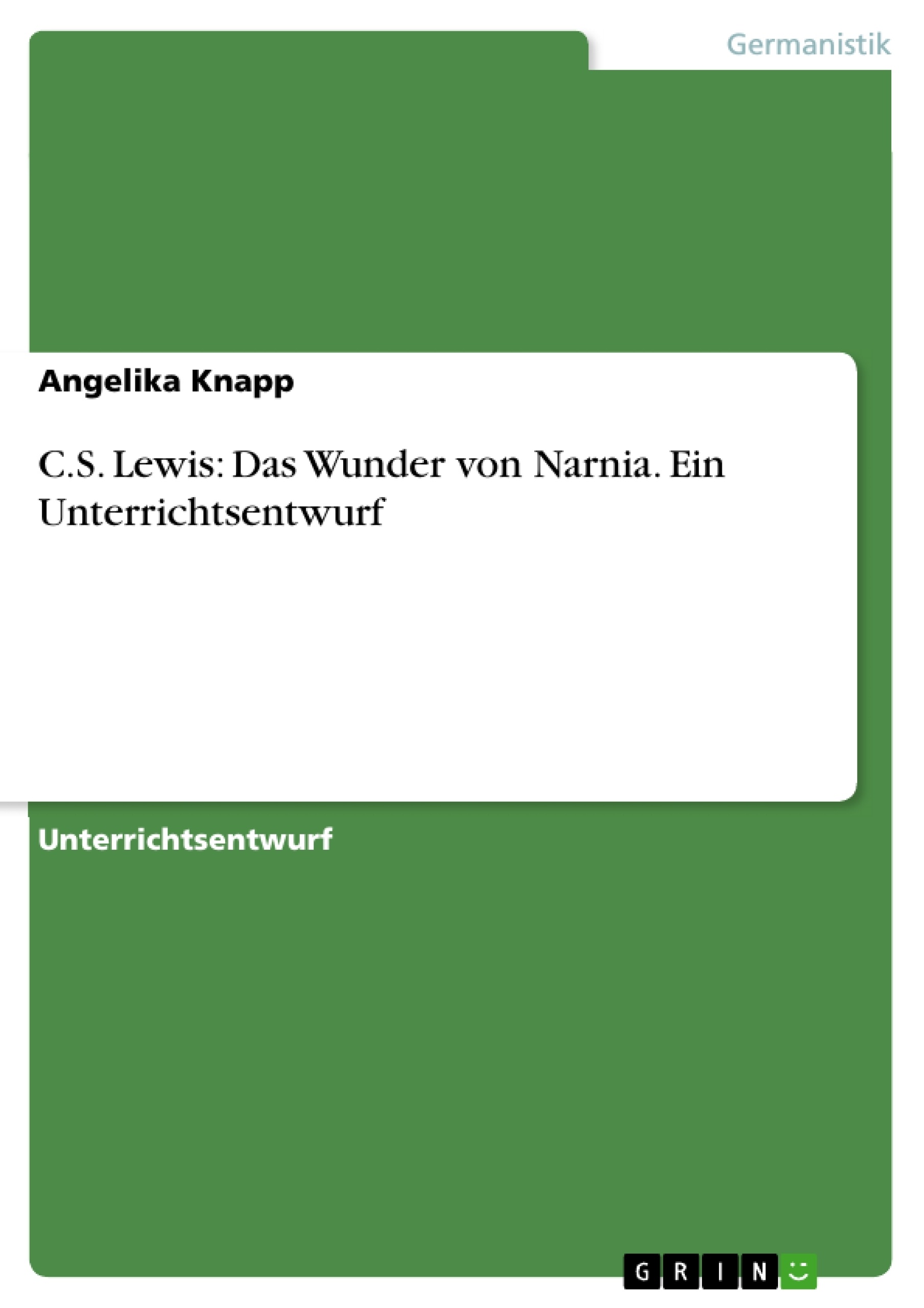Inhaltsverzeichnis
I) Begründung der Textwahl
II) Lokalisation der Lerngruppe
II.1) Baden-Württemberg
II.2) England
III) Die Schulsysteme in Baden-Württemberg (BRD) und England
III.1) Baden-Württemberg
III.2) England
IV) Lerngruppenspezifische Zielsetzung
IV.1) Baden-Württemberg
IV.2) England
V) Die Unterrichtsreihe
V.1) Baden-Württemberg
V.1.0) Mögliche hinleitende Themen
V.1.1) Einführung des Buches
V.1.2) Das Feld „Kinder- und Jugendliteratur“
V.1.3) Adressatenorientierung
V.1.4) Übersetzungsproblematik
V.1.5) Abschluss, weiterleitende Themen
V.2) England
V.2.0) mögliche hinleitende Themen
V.2.1)Einführung des Buches
V.2.2) KJL und Literaturübersetzung
V.2.3) Abschluss, weiterleitende Themen
VI) Anhang: Materialien, Quellen, Dokumente
VI.1) Inhalt des Primärtextes
VI.2) Bildungsplan Baden-Württemberg 9./10. Klasse Gymnasium
VI.3) Auszug aus Framework for teaching English, Years 7, 8 and 9
VI.4) Quellenverzeichnis
I) Begründung der Textwahl
Text: Lewis. C.S.: Das Wunder von Narnia. Moers, 19953
Um auf möglichst jeder Ebene eine Verknüpfung zweier Kulturen (bezüglich der englischen Schulklasse v.a. der beiden im Sprachlernprozess beteiligten) zu thematiesieren, habe ich die deutsche Übersetzung des Werkes eines britischen Autors gewählt.
Den englischen Schülern wird durch die affektive Nähe zu diesem (und der möglichen Kenntnis des Originaltextes) der Zugang zur deutschen Sprache erleichtert. Gleichzeitig erhalten sie die Möglichkeit, mittels der Auseinandersetzung mit der Übersetzung eines englischen Textes sich eine neue E- bene muttersprachlicher Literatur zu erschließen.
Die deutschen Schüler können, ohne zuvor hinderliche Sprachbarrieren ü- berwinden zu müssen, Einblick in die literarische Kultur des europäischen Auslandes gewinnen. Das kann zum Anreiz werden, die vorgestellte oder eine andere Lektüre in der Originalsprache zu lesen. Zudem wird ein Blick auf die deutsche Sprache als Übersetzungsprache und die damit einher ge- hende Problematik gewährt.
Es mag unpassend erscheinen, im Literaturunterricht höherer Klassen (s. Kap. II) der Sekundarstufe ein Kinder- und Jugendbuch zu besprechen. Doch wurde auch diese Entscheidung bewusst getroffen.
Kinderliteratur ist in der gegenwärtigen und vergangenen Literaturwissenschaft kaum beachtet worden. Allenfalls wurde sie im Rahmen von Pädagogik und Fachdidaktik herangezogen. Im schulischen Bereich sollen mittels ihrer Schüler der ersten Jahre der Sekundarstufe an Ganztexte heran- oder linguistische Fachtermini eingeführt werden.
Ein Kinderbuch mit den Werkzeugen zur Erschließung sog. „hoher“ Litera- tur zu bearbeiten, es also mit diesen Werken gleichrangig zu behandeln, er- möglicht Einblicke in die sprachlichen und stilistischen Gesetze, die diesem
Literatursektor zugrunde liegen. Gleichzeitig wird ein Anknüpfungspunkt für die Thematik des Adressatenbezugs eines geschriebenen Textes geboten. Kinder stehen kognitiv und bezüglich der unausgesprochenen Übereinkünfte innerhalb einer Gesellschaft (Konventionen, Normen, Traditionen) auf einer anderen Ebene als Erwachsene oder die Schüler, für welche die Unterrichts- reihe konzipiert wird. Mit eigenen sprachlichen Mitteln eine kommunikative Brücke zu bauen, um ihr Verständnis zu erreichen, ist vergleichbar mit den Interaktionen, die zwischen Personen verschiedener Kulturkreise stattfin- den. Die Problematik der Verständigung zwischen unenbenbürtigen Kom- munikationspartnern (wie es Personen versch. Kulturen, die sich in der Heimatkultur des einen befinden, sind) wird dadurch bewusst gemacht. Ge- setzmäßigkeiten, auf denen eine ungleiche Kommunikation fußt, können evaluiert werden.
Die Bücher von C. S. Lewis (v.a. die Narnia-Reihe) wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und erreichten z.T. hohe Auflagen. Das macht ihn m.E. zu einem geeigneten Vertreter britischer Gegenwartsliteratur für den Bereich der vergleichenden Pädagogik und Didaktik.
Um keine weiteren Vorkenntnisse vorhergehender Bände voraussetzen zu müssen, habe ich das erste Buch der inhaltlich aufeinander aufbauenden Reihe gewählt.
II) Lokalisation der Lerngruppe
II.1) Baden-Württemberg
Für Baden-Württemberg wurde als Lerngruppe die 9. oder 10. Klasse eines Gymnasiums (alternativ einer Realschule) vorausgesetzt.
In dieser Altersgruppe ist davon auszugehen, dass zumindest ein Teil der Lerngruppe noch zum Rezipientenkreis von Kinder- und Jugendliteratur ge- hört. Gleichzeitig wächst mit dem Eintritt in die Pubertät das Bedürfnis, sich einen neuen Platz in der Gesellschaft anzueignen und sich zu diesem Zweck von den Erfahrungen der Kindheit abzulösen. Das eröffnet m.E. Ansatz- punkte für die Analyse sprachlicher Gesetzmäßigkeiten von Kinder- und Ju- gendliteratur (KJL). So wird den Schülern ermöglicht herauszufinden, was KJL zu KJL macht. Die Lehrkraft kann auf diesem Weg an das Bedürfnis der Selbstfindung und des Positionsbezuges im Generationengefüge an- knüpfen.
Da die Jugendlichen in ihrem (freiwilligen) literarischen Lebenslauf zwi- schen ersten Erfahrungen mit Erwachsenenliteratur und Kinder- und Ju- gendbüchern stehen, ist davon auszugehen, dass sie kreativ-produktiv aus der Rezepientenperspektive an die Lektüre anknüpfen können. Dagegen ist anzunehmen, dass wesentlich ältere Schüler in ihrer Freizeit keine Kinder- und Jugendliteratur mehr konsumieren, und der Zugang somit schwieriger wird.
Parallel zum im-Text-Sein-Können befinden sich die Jugendlichen schon in der Lage (zumal unter Hilfe und Anleitung einer Fachkraft), einen kritisch- distanzierten Beobachterstandpunkt einzunehmen, um die Gesetzmäßigkei- ten des Textes - gerade in punkto seiner Klassifikation als KJL - zu evaluie- ren. Dazu erscheinen frühere Jahrgänge wegen der aktuellen Gegenwart kindlicher Erfahrungs- und Handlungsschemata noch nicht in der Lage. (Zudem ist zu befürchten, dass jüngere Schüler sich abqualifiziert fühlen, wenn sie einen Vertreter der Klasse ihrer eigenen gegenwärtigen Lektüre unter der Rubrik „Kinderbuch“ bearbeiten sollen.)
In der Pubertät, in der die Jugendlichen eine Gesellschaftsschicht darstellen, die zwischen zwei anderen steht und sich ständig mit der Frage der Zugehö- rigkeit zur einen oder anderen konfrontiert sieht, erscheinen Fragen der In- terkulturalität, der Identitätsfindung im Rahmen von Konventionen und Normen zwischen Kulturen und der daraus entstehenden Kommunikations- problematik wegen der Aktualität im Leben der Schüler besonders leicht vermittelbar.
II.2) England
In Bezug auf die englische Lerngruppe müssen Belange der sprachlichen Fähigkeiten im Vordergrund stehen. Daher wurde mit dem 12. Unterichtsjahr in einer Grammar oder Comprehensive School das höchstmögliche schulische Lernniveau einer Fremdsprache angesetzt.
In diesem Alter ist davon auszugehen, das ein Teil der Schüler erste Auslandserfahrungen gemacht und z.B. durch einen Schüleraustausch Einblick in den Alltag einer fremden Kultur gewonnen hat.
Für die Konzeption einer Unterrichtsreihe aus einer Position außerhalb briti- scher Schulrealität (und deshalb ohne wirkliche Kenntnis derselben) schien es ratsam, die Möglichkeiten weit zu fassen. Je nach Fähigkeiten und Leis- tungsniveau der Schüler kann die distanzierte Betrachtung des Textes unter den bisher erwähnten Aspekten gegenüber der unmittelbaren inhaltlichen Textbearbeitung Vorrang gewinnen oder zurück treten. So kann eine für den Lernprozess befriedigende Herausforderung gewährleistet werden. Auf je- den Fall wird jedoch die Überforderung allein durch das Textniveau und damit eine Reduktion auf rein inhaltliche Aspekte und die Problematik des Wort- und Grammatikverständnisses vermieden. Bei einer Behandlung in früheren Altersstufen ist gerade das wahrscheinlich.
III) Die Schulsysteme in Baden-Württemberg und England
III.1) Baden-Württemberg
Das Schulwesen in der Bundesrepublik Deutschland untersteht den einzelnen Landesregierungen. Entsprechend der allgemeinen Politik der verschiedenen Länder ergeben sich große Differenzen im Rahmen dessen, was im Klassenzimmer überhaupt möglich ist, und damit im schulischen Alltag. Um eine höchstmögliche Anpassung des Unterrichtskonzeptes an reale Gegebenheiten zu gewährleisten, ist es notwendig, sich auf ein Bundesland und das dortige Bildungswesen zu konzentrieren.
Die Ordnungsstruktur des baden-württembergischen Schulwesens gliedert sich in drei (bei Grund-, Haupt, Real- und Sonderschulen vier) hierarchi- schen Ebenen. An höchster Stelle steht das Ministerium für Jugend, Kultus und Sport in Stuttgart. Ihm obliegt jede Gesetzgebung im Hinblick auf alle Schulen des Landes. Es übt die Aufsicht über Einrichtungen der Lehreraus- bildung, Oberschulämter (OSA) und Schulämter und zusammen mit letzte- ren über die Schulen des Landes aus.
Das Ministerium legt die Schulformen fest, und zwar wie folgt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Als Neuerung sind zu den gängigen neunjährigen Gymnasien eine Anzahl achtjähriger hinzugekommen. In diesen wird der Stoff der Klassen 5-11 in den ersten sechs Jahren (5-10) absolviert. In den letzten beiden Jahre erfüllen Schüler beider Züge das gleiche Lernpensum.
Des weiteren wird für alle allgemein bildenden Gymnasien ab dem Schul- jahr 2001/2002 eine Oberstufenreform gültig, nach der die Trennung von Grund- und Leistungskurs wegfällt. Deutsch, Mathematik und eine Fremd- sprache nach Wahl sind für alle Schüler mit vier Wochenstunden verpflich- tend. In diesen Fächern müssen alle Schüler das zentral organisierte Abitur ablegen.
Im Rahmen der Bildungspläne gibt das Ministerium via OSA den Deutschlehrern der Grund- und Leistungskurse Deutsch drei bis vier verpflichtende Lektüren bzw. Autoren vor. Zwei bzw. drei werden Thema des Abituraufsatzes sein, hinzu kommt ein freies Thema.1
Die Oberstufenreform beschneidet zwar nicht die Zeit, die einem Deutsch- lehrer für die einzelne Lektüre oder Themen freier Wahl zur Verfügung steht. Da er nun jedoch alle Schüler eines Jahrgangs auf das gleiche Leis- tungsniveau heben muss, um jedem eine möglichst gute Ausgangslage für das Abitur zu verschaffen, ist davon auszugehen, das freie Zeitintervalle stärker als bisher zum Wiederholen, Üben und Aufarbeiten von Defiziten genutzt werden müssen.
Die Einführung der achtjährigen Gymnasien dagegen bringt mit der Straffung der Lern- und Arbeitszeit notwendigerweise eine Konzentration auf obligatorische Stoffe auf Kosten der fakultativen mit sich.
Das Ministerium für Jugend, Kultus und Sport erstellt die verbindlichen
Bildungspläne (einschließlich der Anzahl der Wochenstunden für jedes Fach innerhalb einer Jahrgangsstufe), legt die Unterrichtsorganisation fest, gibt Leistungsstandards für Schulabschlüsse und die (zentral gestellten) Prüfungen vor und organisiert und koordiniert Lehreraus- und -weiterbildung, Schulhausbau und Schulbetreuung außerhalb des Unterrichtes. Freie Schulen unterstehen direkt dem Ministerium.
Die vier OSA beufsichtigt die Schulämter und üben zusammen mit diesen Dienst- und Fachaufsicht über alle Schulenaußer den dem Miniterium unter- stellten aus. Gymnasien sind direkt der Kontrolle des OSA subordiniert. Es ist als Mittelbehörde zwischen Lehrern, Schülern und Eltern auf der ei- nen und Ministerium auf der anderen Seite direkter Ansprechpartner für Erstere. Es stellt die Schulpsychologischen Beratungsstellen und besorgt die Umsetzung verwalterischer Direktiven. Außerdem obliegt ihm die Förde- rung und Beratung von Schulen und schulischen und Reformprojekten. In- nerhalb der Lehrerausbildung nimmt es Anmeldungen zum Referendariat entgegen und ist für personalrechtliche Belange während der zweiten Phase der Lehrerausbildung zuständig.
Insgesammt verbleiben lokalen Behörden oder den Schulen selbst wenig Möglichkeiten einer individuellen Profilierung. Die wesentlichen Direktiven gehen direkt vom Landesministerium aus und werden durch Standardset- zung der Leistungskontolle wiederum von diesem überwacht. Eigene Entfal- tung ist nur da möglich, wo das Erreichen das von oben gesetzten Niveaus nicht gefährdet ist.
III.2 England
Im Gegensatz zu Deutschland ist das Schulwesen in England der Staatsregierung unterstellt. Demzufolge sind Schulprofile landeseinheitlich. Neben den allgemein gängigen Comprehensive Schools, die von den meisten britischen Jugendlichen besucht werden, spielen Grammar Schools und Secondary Modern Schools eine untergeordnete Rolle.
In der Regel wechseln die Schüler nach sechs Jahren von der Primary in die Secondary School. In einigen Fällen besuchen sie jedoch nach dem dritten Jahr die Middle School, und wechseln nach dem zehnten Jahr auf die Comprehensive oder Grammar School.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Hierarchie der Schulorganisation ist dreigegliedert. An der Spitze steht das Department of Education and Empleoyment (DfEE) und dessen Vorstand, der Secretary of State. Er ist für das öffentliche Bildungswesen und die Universitäten zuständig, übt Kontrolle über die lokalen Behörden, die Local Education Authority (LEA) aus und leitet sie an.
Das DfEE setzt Mindeststandards für das Bildungsangebot, bestimmt die Verteilung der einzelnen Schularten im Land, kontrolliert die Lehrerausbil- dung und ist für die Streitschlichtung zwischen Schulen, LEAs und Eltern zuständig. Die White bzw. Green papers, Gutachten, die das DfEE bei Sachverständigen (z.B entsprechenden Abteilungen in Universitäten) in
Auftrag gibt, dienen als Vorlage für Parlamentsdiskussionen und Entschei- dungen. 2
Den LEAs obliegt die Einrichtung und Verwaltung der Schulen. Sie stellen Lehrer ein und bezahlen sie, richten Schulen ein und verwalten sie, indem sie Gebäude, Materialien, Einrichtung, Förder- und Beratungsdienste zur Verfügung stellen. Sie haben für eine ausreichende Schuldichte in ihrem Bezirk zu sorgen und zu gewährleisten, dass an den Schulen eine an den Bedürfnissen der Bevölkerung und den Fähigkeiten der Schüler orientierte Ausbildung stattfindet.
Im letzten Punkt hat sich mit dem Education Reform Act (ERA) von 1988 allerdings eine Verschiebung der Kompetenzen ergeben. Im Education Act von 1944 war den LEAs die inhaltliche und organisatorische Kontrolle über das nationale Curriculum übertragen worden. 1986 wurde diese Regelung aufgehoben. Nunmehr war der head teacher für die Gestaltung und Umset- zung des Lehrplans auf der Basis des Curriculums verantworlich. Mit dem ERA von 1988 wurde diese Kompetenz zwar nicht zurückgenommen, doch stark eingeschränkt, so dass Fragen bezüglich des Lehrplans nun in Händen des Secretary of State stehen. Er kann die Liste der für staatliche Schulen verbindlichen Haupt- und Nebenfächer modifizieren, gesetzliche Vorgaben hinsichtlich einzelner Schulen oder generell außer Kraft setzen und durch Richtlinien auf die Arbeit der LEAs und der Schulen Einfluss nehmen. Die- se Richtlinien haben in der Regel keinen zwingenden, doch stark anleiten- den Charakter und werden im Großen und Ganzen von den Schulen befolgt.
Die Verwaltung der einzelnen Schulen, die school governing bodies, sind mit umfassenden Befugnissen und Freiheiten ausgestattet. Sie setzen sich aus Vertretern der Elternschaft (2-5), der zuständigen LEA (2-5), der Lehrerschaft (1-2), dem Schuldirektor sowie co-opted members (3-6, v.a. Vertreter der örtlichen Wirtschaft) zusammen.
Bei Schulen unter kirchlicher Trägerschaft bilden 6-7 Vertreter der Kirchen- leitung, je 1 Elternvertreter, Lehrer, LEA-Vertreter und der Schuldirektor den school governing body. Der school governing body hat das Recht, über die finaziellen Belange der Schule zu entscheiden. In großen Teilen (je nach Art der Trägerschaft der Schule) geht damit das Recht einher, Lehrerpersonal einzustellen und zu entlassen. Für die Bezahlung sind die LEAs als formeller Arbeitgeber zu- ständig.
Die school governing bodies entscheiden über die Verteilung der Wochenstunden, die Länge von Schultag und Ferien, die Einrichtung von Sexualkundeunterricht und disziplinarische Maßnahmen.
Dadurch, dass die staatlichen Stellen v.a. Rahmenbedingungen stellen, bleibt den Lehrern bei der Gestaltung des Unterrichtes ein relativ großer Freiraum. Doch es sind Tendenzen zu beobachten, dass das DfEE versucht, ein einheitliches Leistungsniveau an allen Schulen einer Stufe zu erreichen (Schlagwort: „Excellence in Schools“). So werden im Rahmen der National Literacy Strategie für das siebte bis neunte Jahr (Key Stage 3) für jeden Be- reich der MTE (Word, Sentence, Text Level (innerhalb des Text Levels: Reading, Writing, Speaking an Listening) die zu unterrichtenden Themen angegeben. Dabei bleibt offen, an welchen Inhalten und mit welchen Me- thoden die Lehrer ihr Ziel vermitteln, doch wird zu einer Vielfalt und Ver- knüpfung von beidem geraten.
Die angesprochenen Schulsysteme wurden u.a. wegen ihrer Unterschiedlichkeit ausgewählt. Schule ist in Baden-Württemberg zentral organisiert und an zentral aufgestellte Kriterien rückgebunden. Dies erstreckt sich bis in inhaltliche Direktiven (Zentralabitur, Zentrale Klassenarbeit in der 10. Klasse). Das Schulsystem in England dagegen bietet dem einzelnen Lehrer große Freiheiten in Hinblick auf inhaltliche und methodologische Schwerpunkte. Dies wird durch die National Literacy Strategie nicht tangiert.
VI) Lerngruppenspezifische Zielsetzung
Bei der allgemeinen Zielsetzung kann es nicht darum gehen, konkrete Lernziele für eine nicht definierte Gruppe vorzuschreiben. Vielmehr soll auf der Basis der vorgestellten Schulsysteme eine allgemeine Richtung angegeben werden, in die der Unterricht geführt werden sollte.
Interkulturalität im schulischen Umfeld kann nur sich nur dann in allen Be- reichen positiv auswirken, wenn sie in die zentralen Punkte Eingang findet. Das heißt, Organisation des Schulwesens, zentrale und örtliche Schulver- waltung sowie der konkrete Unterricht müssen sich für Impulse anderer Bil- dungssysteme öffnen und diese Impulse als Strukturelemente integrieren. Das bedeutet für jedes Schulsystem eine andere Zielsetzung; Schulsysteme, die den Schulen einen hohen Grad an Autonomie einräumen (wie etwa die USA oder in Teilen England) bedürfen möglicherweise einer für einzelne Regionen oder einzelne Schulen ausdifferenzierter Zielsetzung. Eine Alter- native hierzu ist, an staatliche, d.h. überregionale Kompetenzbereiche be- züglich des konkreten Unterrichtes anzuknüpfen (im Fall England an die Li- teracy Strategie). Ob und wie dies möglich, muss der Einzelfall zeigen.
Bei allen Rahmenbedingungen, die durch Curricula und Schulsysteme gegeben werden, soll die Behandlung des Buches unter dem Gesichtspunkt KJL und damit der Adressatenorientierung in beiden Lerngruppen einen großen Raum einnehmen.
IV.1) Baden-Württemberg
Einen Unterrichtsentwurf für Baden-Württemberg zu erstellen, konfrontiert den Planer mit mehreren Problemen.
In Baden-Württemberg muss in der 9. Und 10. Klasse des Gymnasiums mindestens 50% der verfügbaren Unterrichtszeit für Literatur aus dem Lek- türeverzeichnis verwendet werden (s. Bildungsplan im Anhang). Der Lektü- rekanon setzt sich aus deutscher Literatur verschiedener Gattungen und E- pochen zusammen. Ausländische Autoren in deutscher Übersetzung sind nicht aufgenommen, es wird lediglich im Anhang empfehlend eine Auswahl angegeben und auf die Zusammenarbeit mit Fremdsprachenlehrern verwie- sen. Die Unterrichtseinheiten zur Bearbeitung dieser Werke sind jedoch nicht unter der Rubrik „Literatur aus dem Lektüreverzeichnis“ zu fassen.
Das bedeutet, dass die Zeit, die für die hier vorgestellte Unterrichtseinheit nötig ist, auf Kosten anderer Bereiche (etwa dem Bereich „Journalismus“) aufgebracht wird. Wo möglich, sollte das Konzept für BadenWürttemberg daher mit dem außerliterarischen Aufgabenfeld des Deutschunterrichtes verknüpft werden. Damit wird gewährleistet, dass das Jahresziel der entsprechenden Klasse erreicht wird und der nachfolgende Deutschlehrer auf den Unterricht aufbauen kann.
Anhand des Schulsystemes und des Lehrplanes wird ersichtlich, dass Schule in Baden-Württemberg einen inhaltszentrierten Unterricht und lehrerzent- rierte Methoden fördert. Handlungs- und Produktionsorientierung, die zu ei- ner Zunahme von Fähigkeiten führen, haben in der Praxis meist eine quanti- tative Abnahme des auswendig gelernten gemeinsamen Wissens zur Folge. Nach Bewertungsmethoden, die dieses zum Kriterium des Leistungsniveaus erheben, befinden sich Schüler, die über lange Zeit einen produktions- und handlungsorientierten Unterricht genossen haben, auf einem niedereren Ni- veau als die nach herkömmlichen Methoden unterrichteten.
Gerade weil auf intellektuell-analytischen Wissens- (nicht unbedingt Er- kenntnis-!) -zuwachs ausgerichtete Methoden dominieren, soll der für Ba- den-Württemberg entworfene Unterrichtsplan viel Platz für praktische Erar- beitung seitens der Schüler, Handlung und Produktion bieten. Vom Lehr-plan geforderte Unterrichtsziele werden auf diesem Wege in den Unterricht integriert, ohne Mittelpunkt des Unterrichtes zu sein.
IV.2) England
Ein Unterrichtsmodell auf der Basis staatlicher Vorgaben zu entwerfen, ges- taltet sich als schwierig. Die National Literacy Strategie, die den staatlichen Einfluss auf Unterricht erhöht, hat bisher nur Konzepte für die Primary school und Key Stage 3 (7. - 9. Schuljahr) vorgestellt. In Bezug auf Key Stage 4 (10. - 12. Schuljahr), die für uns relevante Bildungsstufe, existieren für den Teilbereich Literatur im Muttersprachunterricht nur vage Vorgaben (s. Anhang). Zudem erstrecken sich diese über Key Stage 3 und 4, so dass Fälle möglich sind, in denen aus dem curricularen Soll in einer Jahrgangs- stufe überhaupt nichts behandelt wird. Des weiteren ist nicht bekannt, in wieweit sich Vorgaben aus dem Muttersprachunterricht auf den Fremd- sprachunterricht übertragen lassen.
Von Vorteil ist, dass der Rahmen der Möglichkeiten, Unterrichtsentwürfe zu erstellen, relativ weit gefasst ist. Ein Nachteil ist darin zu sehen, dass das hohe Maß an Lehrer- und Schulautonomie es dem Lehrer leicht und in der Praxis wahrscheinlich macht, auf seine eigenen, bewährten Methoden zu- rück zu greifen. Einer angestrebten interkulturellen Erweiterung der Lehr- methoden und Lernziele wird so paradoxerweise durch bereits vorhandene Freiheiten der Weg erschwert.
Der Unterrichtsentwurf für die englische Schulklasse soll daher seinen Schwerpunkt in der Vermittlung des Aspektes Kinderliteratur haben. So soll gewährleistet werden, dass die Problematik der Verständigung zwischen unebenbürtigen Kommunikationspartnern auf dem in Kap. I evaluierten Weg Eingang in den Unterricht findet.
Primäre Lernziele sind:
- Die Schüler sollen KJL als eigenständigen Literatursektor kennen lernen
- sie sollen Vorstellungen von KJL zu Grunde liegenden Gesetzmäßigkeiten haben
- sie sollen Begriff und Relevanz der Adressatenorientierung eines Textes kennen
- sie sollen erkennen, dass die Form eines Textes bei Beibehaltung des In- haltes in Bezug auf Gattung und Adressatenbezug modifiziert werden kann
- sie sollen zwischen Inhalt und Darbietung eines Textes unterscheiden kön- nen
- sie sollen einen Einblick in die Problematik der Literaturübersetzung und - übertragung gewinnen
V) Die Unterrichtsreihe
Die Reihen werden in verschiedene hier aufeinander aufbauende Stufen gegliedert. Nach Modifikation ist ein Austausch der Stufen möglich (z.B. die Behandlung der Übersetzungsproblematik vor der KJL-Frage). Den einzelnen Stufen ist keine Zeitbegrenzung zugewiesen.
V.1) Baden-Württemberg
V.1.0) Mögliche hinleitende Themen
In der 9./10. Klasse ist ein Drama von Goethe oder Schiller verpflichtend. Als vorausgehendes Thema ist eine Behandlung von Auszügen aus Goethes Faust I möglich, v.a. die Beschwörung des Erdgeistes, die Szene in der He- xenküche oder die Erscheinung Mephistos, wegen des inhaltlichen Bezuges zur Hexerei (v. 430 - 521; 1178 - 1529; 1530 - 1865; 2336 - 2604) Zwar ist dies nicht zentrales Thema der Szenen, doch können die Schüler durch Er- innerung und Vergleich einen inhaltlichen Bezug zwischen den beiden Un- terrichtseinheiten herstellen.
Aus dem selben Grund kann Goethes Erlkönig behandelt werden.
Wegen der phantastischen Elemente (verschiedene Welten, sprechende Tie- re, Magie) ist auch ein vorausgehender Komplex „Märchen“, „Sagen und Legenden“ (Nibelungenlied o.ä.) oder die Lektüre eines Buches aus der Romatik denkbar (z.B. ETA Hoffmann: Der Goldene Topf). Bei Behand- lung eines historischen Romanes / einer historischen Kurzgeschichte, die im
20. Jh. entstanden und deren Handlung ins 19. Jh. verlegt ist, bieten sich Anknüpfungspunkte für den Vergleich von „Erwachsenenliteratur“ und „Kinderliteratur“.
Eine vorhergehende Schwerpunktsetzung auf den Teilbereich „Fach-“ und „Gruppensprachen“ im Arbeitsbereich 3 (Sprachbetrachtung und Gramma- tik) in der 9. Klasse bietet sich im Hinblick auf die Adressatenorientierung an. Fachsprachen schließen automatisch die Behandlung des eingegrenzten Sender-Empfänger-Feldes ein (so wird Jugendsprache von Jugendlichen nur innerhalb ihrer eigenen Altersgruppe akzeptiert, Wissenschaftssprache ist auf entsprechend Gebildete ausgelegt, Gebrauchsanweisungen dagegen setzen eine Übertragung von Fachwissen in Laiensprache voraus).
V.1.1) Einführung des Buches
Die Lektüre des Buches wird im Voraus angekündigt. Zu Beginn der Unterrichtseinheit wird das Buch als gelesen vorausgesetzt. Als Vorbereitung auf die erste Stunde der Unterrichtseinheit sollen sich die Schüler kreativ mit dem Text auseinandersetzen, z.B.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Es ist davon auszugehen, dass die Schüler beim Verfassen ihrer Arbeiten keinen Adressatenkreis bewusst im Blick haben. Daher werden sie - unbe- wusst - für die eigene Altersstufe oder die der Erwachsenen ausgelegt sein. Für die eigene Altersgruppe wird der Text dann ansprechend sein, wenn der Schüler unreflektiert aus seinem eigenen Erfahrungshorizont schreibt und sich in diesem bewegt. An literarischen Formen z.B. bewusstem Gebrauch von Stilmitteln sollte dagegen eine Auseinandersetzung mit Literatur er- kennbar sein. In solchen Fällen versucht der Schüler, seinen Text auf ein „höheres“ Niveau anzuheben, d.h. der Hochliteratur anzugleichen. Durch Vergleich der Schülerarbeiten mit dem Text wird anhand der sprach- lichen und stilistischen Distanz offensichtlich, dass der Autor für einen an- deren Adressatenkreis schreibt, als dies bei den Schülern intendiert werden kann, dass es sich um das Produkt der einen Gesellschaftsschicht für eine andere handelt. Diese Erkenntnis kann gefördert werden, wenn man die Schüler einen Zeitungsartikel zu einem (schon bekannten) Roman des 20. Jh. schreiben lässt. In diesem Fall werden Schülertext und literarisches Vor- bild sprachlich einander mehr ähneln, als in o. genanntem.
V.1.2) Das Feld „Kinder- und Jugendbuch“
Die Lese- / Schreibeindrücke sollten auf jeden Fall gesammelt und verwertet werden, um
a) Schüler zu ermutigen, weiter zu schreiben
b) eine bestätigende Rückmeldung über die geleistete Arbeit zu geben
c) dem Lehrer einen Einblick in das Textverständnis der Schüler zu gewäh- ren.
Dies kann geschehen durch
- vorlesen lassen
- einsammeln und ein Textheft zusammenstellen
- Austausch der Arbeiten in Kleingruppen (2-3), Gespräch darüber
Die Schüler sollen dafür sensibel werden, dass es sich bei dem Text um ein für Kinder und Jugendliche geschriebenes Buch handelt. Dies kann gesche- hen durch
- eine Gruppendiskussion: die Schüler berichten über eigene Leseer- fahrungen in der 1.-6. Klasse. Ein Kinderbuch, das möglichst viele gelesen haben, wird zum Mittelpunkt der Diskussion gemacht. Leit- fragen können sein:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bei aller Suche nach Offenheit im Diskussionsklima sollen die Schüler sich bemühen, Kritik sachlich zu äußern und Vorlieben / Zustimmung zu begründen. Der Lehrer oder ein Schüler fungiert als Diskussionsleiter. Das Ergebnis des Gesprächs wird protokolliert.
Nachdem den Schülern bewusst geworden ist, dass es sich um KJL handelt, sollen gemeinsam Passagen des Textes besprochen werden. Ziel ist, den Schülern einen Einblick darin zu gewähren, dass KJL zu ihrem Leserkreis auf eine ähnliche Weise in Bezug tritt, wie dies bei „hoher“ Literatur der Fall ist. Geeignete Passagen für eine Besprechung sind
- Polly und Digory in Onkel Andrews Arbeitszimmer
S. 14 - 31: Vom Baulichen her ... Ufer eines kleinen Teichs.
- Jadis in Charn und London
S. 48 - 65: Aber Digory interessierte sich dagegen eher Sie sausten
aufwärts, auf das warme grüne Licht zu, das immer näher kam.
S. 68 - 78: Und da gab es einiges zu starren um zu sehen, wie die Tür hinter den beiden zufiel.
S. 83 - 91: Zuerst kam die Droschke Beim dritten Versuch klammerte ... „Los, Polly!“
- Verhältnis zur geschilderten Zeit (19. Jh.)
S. 7: Diese Geschichte ... ein Mädchen namens Polly Plummer.
S. 74: Er schenkte sich ein zweites Glas ein ... betrachtete sich im Spie- gel.
S. 80 - 81: Darüber musste er lange nachdenken ... roch es ständig nach Hammelfleisch.
S. 83 - 90: Digory vergaß ganz und gar ... die Zügel seines Pferdes zu packen.
- literarische Symbole und Motive
S. 14 - 18 / S. 23 - 25: das Studierzimmer des Zauberers, die Zau-
berringe, die Gestalt Onkel Andrews (Aussehen), die Schatulle aus
Atlantis
S. 36 - 42: der Wald zwischen den Welten, der Teich als Durch-
gangsort > phantastische Literatur
S. 43 - 48: die ausgestorbene Stadt
S. 50: Hammer und Glocke
S. 82, 104 - 108, 135f, 147ff, 151: das Land der Jugend, der Baum
des Lebens, der Garten, Lebensapfel > christliche Symbolik
S. 97, 99, 112 134 - 137: das geflügelte Pferd, Sagengestalten,
sprechende Tiere, der Löwe > Antike, Fabeln
Anhand der Textbesprechung kann deutlich gemacht werden, dass sich KJL unter den gleichen Gesichtspunkten behandeln lässt, wie Literatur für Er- wachsene. In einer Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses, der eige- nen kreativen Arbeit und der Textbesprechung sollte deutlich werden, dass KJL versucht, den Ansprüchen einer Leserschaft zu genügen, die - auf ihrer Ebene - nach genau den gleichen Kriterien verlangt wie ein „normaler“ er- wachsener Leserkreis.
An dieser Stelle ist es möglich, Kontakt zur lokalen Jugendliteraturszene aufzunehmen, z.B. einen Jugendbuchautor einzuladen, eine Buchmesse mit entsprechendem Programm oder eine Autorenlesung zu besuchen. Die Schüler haben nun eigene Fragestellungen entwickelt, dass fruchtbare Diskussionen und Gespräche zu erwarten sind.
V.1.3) Adressatenorientierung
Nachdem erkannt worden ist, dass es sich bei dem Text um ein Buch für ei- nen bestimmten Adressatenkreis handelt, und nachdem der Kreis selbst ins Blickfeld gerückt ist, sollte die Frage aufgegriffen werden, wie Adressaten- orientierung am konkreten Beispiel erreicht worden ist, und aufbauend dar- auf, wie sie bei einem neu zu schreibenden Text erreicht werden kann.
Als Merkmale von KJL im vorliegenden Text können evaluiert werden:
- der auktoriale Erzähler spricht den Leser direkt an.
- dabei nimmt er Bezug auf einen kindlichen Erfahrungshori- zont und eine kindliche Perspektive: Schule (S. 7), Süßigkeiten (S. 7), Albernheit der Erwachsenen (S. 74), langweilige Geschichte, wie sie sich unter Erwachsenen abspielt (S. 76), Erziehung durch Eltern (S. 81, S. 149f).
- der Sprachstil verweist auf einen hierarchisch übergeordneten
Erwachsenen („Märchenonkel“): er führt den Leser ins Lon- don des 19. Jh. ein (S. 7, 79, 81), er selektiert die Erzählung nach Interessegrad des Lesers (S. 40: es wäre langweilig ... standen; S. 76: für euch ist nur interessant), er wertet das Ge- schehen (S. 52: eigentlich gibt es keine Entschuldigung ... ihm al-
lein), referiert auf sein Erzählen (S. 118: Ich muss jetzt ein
Stückchen zurückgehen) und erklärt die Geschichte (S. 40f: In
Wahrheit ... mit den meisten Zauberern., S. 122: Ihr haltet die Tie-
re ... nicht reden konnte.
- die Protagonisten sind Kinder
- sie zeigen kindliche Verhaltensmuster (keine an Erwachse- ne angelehnten Heldenfiguren):Pollys Schmugglerhöhle (S.
11), Schimpfworte d. Kinder („Typisch Mann/typisch
Frau“) (S. 51f), Digorys Meinung über „Erwachsenenge-
schwätz“ (S. 82), Ärger Pollys über Schule (S. 140)
- Erwachsene sind Außenstehende oder Randfiguren (Aus-
nahme: der Kutscher): Erwachsene ... langweilige Erklärungen für alles. (S. 13), Hätte Digory ... wie das bei den Erwachsenen üblich ist. (S. 82), Jadis und Andrew verkörpern das Böse,
Tante Letty, Nellie und Digorys Mutter sind Randfiguren,
Pollys Eltern treten nicht in Erscheinung.
- im Vergleich zu „hoher“ Literatur zeichnet sich die Geschichte durch
sprachliche und stilistische Schlichtheit aus
- v.a. parataktische Nebensatzstruktur
- linearer Aufbau der Handlung, Rückblenden werden in als
Erzählung integriert (der Kutscher über London (S. 116f))
oder kommentierend eingeleitet (Ich muss jetzt ein Stückchen zurückgehen ... man selbst st. (S. 118f); Aber wir müssen ihn jetzt allein ... zuwenden (S. 126); Um all das zu erklären, ... zu- rückgehen (S. 159))
- eine Haupthandlung, kaum Nebenhandlungen, diese sind eng mit dem Haupterzählstrang verknüpft (die Krankheit von Digorys Mutter) oder werden nur angedeutet (Mrs. Lefays Wahnsinn; die Geldstreitigkeiten zwischen Onkel Andrew und Tante Letty; Digorys Vater in Indien).
- Handlungsstränge werden abgeschlossen (entspricht kindli-
chem Bedürfnis nach Eindeutigkeit): der Teich von Charn verschwindet (S. 168), Aslan sagt Zukunft Jadis´ und Narnias nach Ende der Geschichte voraus (S. 135, 163, 174), Digorys Mutter wird gesund, der Vater kehrt aus Indien zurück (S. 173), er und Polly bleiben Freunde (S. 174) und Andrew gibt das Zaubern auf (S. 175).
- distanziert-deskriptiver Erzählstil führt zu einer Eindeutigkeit
des Textverständnisses
- Personen werden wiederholt mit den gleichen Attributen be-
schrieben: Onkel Andrews Haare und sein Hang zum Alko-
hol (S. 15, 74, 76, 85, 125); Jadis´ Größe und Wildheit (S. 49,
68, 107, 154); Aslans Stimme (S. 110, 112, 137, 157)
- die Personenkonstellation ist einfach aufgebaut; sie ändert
sich während der ganzen Geschichte nicht (Freundschaften
und Feindschaften bleiben gleichermaßen bestehen)
Einzelne Aspekte können durch Vergleich mit anderer Literatur vertieft
werden. Dass ein deskriptiv-distanzierter Erzählstil zu einer Vereinfachung der Rezeption führt, kann z.B. durch Textbeispiele für den „Stream of Councisness“ oder einen collagierenden Erzählstil evaluiert werden (hierfür: James Joyce, Ulysses; Döblin, Berlin Alexanderplatz). Dass eine erhöhte Komplexität z.B. der Figurenkonstellation zu einer erhöhten Komplexität der Gesammtgeschichte führt, kann verdeutlicht werden, wenn die Schüler Änderungen an der gegebenen Figurenkonstellation vornehmen sollen.
Reduktion der Komplexität als Merkmal von KJL kann von den Schülern praktisch erfahren werden. Eine Hausaufgabe könnte sein, jeweils eine Textpassage über das Alltagsleben aus Das Wunder von Narnia und ei- nem anderen historischen Roman (im 19. Jh. angesiedelt) in ein gegenwärti- ges Umfeld, eine deutsche Stadt, etc. zu übertragen. Letzterer Fall dürfte - v.a. wenn der Text mit Andeutungen, impliziten Beschreibungen und einem vorausgesetzten Vorwissen der Leser arbeitet - den Schülern größere Prob- leme bereiten.
Um Handlungsorientierung nicht nur zum Schlagwort für die praktische Einübung theoretischer Erkenntnis werden zu lassen, sollten Aspekte des Buches zuerst in mimetischen Verfahren von den Schülern nachvollzogen werden, bevor sie durch Analyse aufgeschlossen werden. Möglichkeiten sind
- die Geschichte des Kutschers und seiner Frau in Narnia weiter-
schreiben
- Jadis´ Flucht in Narnia beschreiben
Dabei sollen die Schüler darauf achten, den Ton des Erzählers zu treffen. Durch die Nachahmung des Erzählstils wird nachvollzogen, dass der Autor zwischen Erzähler und Leser selbst ein Gefälle aufbaut, wie es dem zwischen Erwachsenen und Kindern entspricht, dass er also die Rahmenbedingungen der KJL im Buch zitiert.
Zur Zusammenfassung dieser Stufe oder parallel zum Analyseprozess kann ein Projekt angesiedelt werden. Dabei wählt sich die Klasse eine Adressa- tengruppe außerhalb ihrer eigenen, der sie durch ein bestimmtes Medium (in
der Vorlage der Geschichtenerzähler; Möglichkeiten: Reportage, Roman,
Geschichtsbuch, ...) die Geschichte weitergibt. Die Schüler sollen beachten:
- Wie wird der Leser angesprochen?
- Wie wird auf ihn Bezug genommen?
- Wie wird sicher gestellt, dass die Geschichte die Zielgruppe erreicht und anspricht?
- Wie werden Anknüpfungspunkte für den Leser zur Identifikation mit den Protagonisten gegeben? Wie geschieht dies, wenn die Zielgruppe keine Kinder sind?
- Wie kann die Geschichte auf ein anderes Land (Deutschland) abge- stimmt werden?
Evtl. werden Schüler einer bestimmten Jahrgangsstufe der gleichen Schule als Zielgruppe ins Auge gefasst. Die Zusammenfassung der Untereinheit kann dann als Projekt (Schülerzeitung) mit dem Ziel, die unwissenden Mit- schüler umfassend über Narnia zu informieren, organisiert und zum Verkauf angeboten werden.
Bestandteil einer solchen Schülerzeitung können sein:
- Landkarten
- Charakteristiken der Personen
- Ortsbeschreibungen
- eine Zusammenfassung der Geschichte Narnias
- „wissenschaftliche Abhandlungen“ über die in der Geschichte ge-
schilderten Phänomene
Durch das Projekt vollziehen die Schüler praktisch nach, welche Arbeiten zu leisten sind, um einem uneingeweihten Leser / Hörer einen Inhalt eindeutig und schlüssig nahe zu bringen. Damit wird das Lehrplanziel des Arbeitsbereiches 1, „Informationen zweckentsprechend auszuwählen, klar und verständlich zu formulieren und korrekt weiterzugeben“, erfüllt.
V.1.4) Übersetzungsproblematik
Die Frage nach der angemessenen Wiedergabe fremdsprachlicher Texte in deutsch baut auf die Frage nach dem Adressantenbezug auf. Sie schließt ein Verständnis davon ein, dass bei der Übersetzungsarbeit gleichzeitig Adaptionsarbeit geleistet werden muss.
Im vorliegenden Buch kann das anhand der Akzente verschiedener Personen verdeutlicht werden.
- Onkel Andrew: „Ah, Letitia my dear,“ said Uncle Andrew, „I - ah - have to go out. Just lend me five pounds or so, there´s a good gel.“ („Gel“ was the way he pronounced girl.) (S. 77)
„Ah, Letitia, meine Liebe“, sagte Onkel Andrew. „Ich - ah - ich muss weg. Sei so lieb, mein Mädchen, und leih mir fünf Pfund oder so.“ (S. 77)
- Jadis: „Dog, unhand our royal charger. We are the empress Jadis.“ (S. 91)
„Hund! Lass mein königliches Streitross los! Ich bin Königin Jadis!“ (S. 88)
- Kutscher: „Too true, mate, too true!“ said the Cabby. „A `ard world it
was. I always did say those paving-stones weren´t fair on any `oss. That´s Lunn´on, that is. I didn´t like it no more than what you did. (...).“ (S. 121) „Ganz recht, alter Knabe, ganz recht“, stimmte der Kutscher zu, „´ne harte Welt war´s. Ja, das war´s. Ich hab´ immer gesagt, die Pflastersteine sind nichts Rechtes für´n Pferd. Aber so ist das eben in London. Hat mir genau so wenig gefallen wie dir. (...).“ (S. 117)
Weder der Pluralis Majestatis noch der harte Londoner Akzent des Kutschers können im Deutschen verständlich und deckend nachgeahmt werden. Durch verschiedene Versuche der Schüler, die Stellen anders zu übertragen (z.B. den Pluralis Majestatis nachzuahmen), erfahren sie, dass bei der entsprechenden Tätigkeit zahlreiche Entscheidungen getroffen werden müssen. Es ist festzulegen, was den Vorrang haben soll:
- ein genaues Einfangen der Stimmung
- eine wortgetreue Übersetzung
- eine für den Leserkreis verständliche Übersetzung
Anhand einiger Textstellen werden Eigenheiten der englischen Sprache of- fensichtlich, die nicht oder nur schwer wiedergegeben werden können.
- In Charn she had been alarming enough: in London, she was terrifying. (S. 69) (Alarm > Terror)
Schon in Charn hatte sie sehr beeindruckend gewirkt, hier in London sah sie furchterregend aus. (S. 68)
Hier erfahren die Schüler die Grenzen von Textübertragung, Übersetzung und Bearbeitung. Durch Gruppengespräche kann das Problem berührt werden, wieviel Freiheit den Bearbeitern eines Textes zugestanden werden soll. Dabei kann Bezug auf aktuelle Drameninterpretationen oder Literaturverfilmungen genommen werden, die oft jeden Bezug zur Erwartung des Zuschauers bei Lektüre des geschriebenen Textes vermissen lassen. (Gegebenenfalls ist unter diesem Gesichtspunkt ein Theaterbesuch oder die Rezeption einer Literaturverfilmung empfehlenswert.)
Die Untereinheit bietet sich für fächerübergreifenden oder fächerverbindenden Unterricht in Hinblick auf Kunst und Fremdsprachen an.
V.1.5) Abschluss, weiterleitende Themen
Als Abschluss kann eine Sammlung der während der Unterrichtseinheit entstandenen Texte herausgegeben werden. Dabei ergeben sich Überschneidungen mit dem Lehrplan der Klasse 10, Arbeitsbereich 1 (Einführung in Journalismus). Den Schülern kann der Beitrag redaktioneller Arbeit zur Adressatenorientierung und Übertragungsarbeit nahe gebracht werden. Sie erfahren, dass textexterne Kriterien - Layout, Druckformat etc. - die Übermittlung des Inhaltes unterstützen oder verhindern können.
An die Unterrichtseinheit lässt sich der Bereich „Journalismus“ wegen der verwandten Problematik ohne weitere Probleme anschließen. Ebenso kann die als mögliches vorausgehendes Thema genannte Literatur, die inhaltliche Bezüge zum Text anbietet, im weiteren Verlauf bearbeitet werden. Durch den im Laufe der Unterrichtseinheit gewonnenen Erkenntniszuwachs der
Schüler ist ein Einstieg in Werke der Weltliteratur über den Weg der Bear- beitung für Kinder möglich.
V.2) England
V.2.0) Mögliche hinleitende Themen
Die Qualität der Bearbeitung eines fremdsprachlichen Textes hängt wesent- lich vom denotativen Textverständnis ab. Ohne dieses ist weder Analyse, Interpretation noch Informationsgewinnung und -reorganisation möglich. Hinleitenden Themen sollten deshalb ihren Schwerpunkt darin haben, die Schüler entsprechend ihres Kenntnisstandes und Sprachvermögens auf die Lektüre vorzubereiten.
Nach Bedarf können Vokabeln aus dem Bereich Zauberei, Märchen, Phan- tastik behandelt werden. Großes Augenmerk sollte dabei auf den symboli- schen und metaphorischen Wortsinn gerichtet werden. So bedeutet im vor- liegenden Text world-Welt mehr als die Bezeichnung eines Planeten (s. S. 24f), und evil (S. 134) hat im Gegensatz zu bad eine metaphysische und mo- ralische Dimension, die durch den Ausdruck „böse“ (S. 128), der für beide Begriffe verwendet wird, nicht explizit wiedergegeben wird sondern nur implizit mitschwingt.
Durch Vermittlung der grundlegenden Satzstrukturen im Deutschen kann ein Ausgangspunkt dafür geschaffen werden, die Reduktion sprachlicher Komplexität als Merkmal von KJL zu erkennen.
Eine Auseinandersetzung mit dem deutschen Schulsystem vermittelt Landeskunde und kann, sofern der Schwerpunkt nicht einseitig auf organisatorische und politische Fragen gelegt wird, einen Bezug zur vorrangigen Adressatengruppe des zu behandelnden Textes herstellen.
Inhaltliche Verbindungen bestehen auf Grund des märchenhaften Charakters der Lektüre zu deutschen Sagen und Märchen (Gebrüder Grimm, Fouqué et. al.).
V.2.1) Einführung des Buches
Das Buch kann als Hausaufgabe gelesen werden.
Zum Einstieg ist jedoch auch empfehlenswert, die ersten Kapitel in einer si- lent reading lesson im Klassenplenum zu rezipieren. Es empfiehlt sich, im Anschluss an diese Stunde bzw. nach einem Teil der Zeit den Leseeindruck zu besprechen und Verständnisfragen zu klären. So wird gewährleistet, dass alle Schüler den Einstieg in die Lektüre bewältigt haben. Das Verständnis des Textbeginnes ist in der Regel grundlegend für das Verständnis der ge- sammten Handlung, da später aufkommende Schwierigkeiten nur durch Rückgriff auf das zuvor Beschriebene bewältigt werden können.
Im Anschluss an die silent reading lesson wird der Rest des Buches als Hausaufgabe gelesen. Eine gesonderte Behandlung schwieriger Textpassagen ist ratsam. Diese ergeben sich primär aus dem Bedürfnis der Schüler. Durch Behandlung einiger Passagen aus Lehrerinitiative kann geprüft werden, ob die Klasse tatsächlich den Text verstanden hat, oder ob Hemmungen bestehen, Sprachschwierigkeiten einzugestehen.
Solche Passagen können sein:
- S. 8f („Na gut, dann hab ich eben geheult“, ... die Tränen zu unterdrü- cken.)
Probleme dürfte der konditional bedingte Konjunktiv bereiten. Die erste Ebene der Textbedeutung (Digorys Gründe, zu weinen) wird wahrscheinlich leichter erfasst als die zweite (Polly weinte, passierte ihr das Gleiche wie Digory).
- S. 20 - 27 (Das Ganze ging so schnell ... Die grünen Ringe ziehen einen zurück.“)
Hier gilt es, die Verflechtung der Erzählung Onkel Andrews mit dem gegenwärtigen Geschehen zu erkennen. Die beiden Erzählstränge bedingen und erklären sich gegenseitig.
- S. 82f (Eine Frau kam ... plötzlich Hufgetrappel hörte.)
An dieser Stelle überschneiden sich zwei Erkenntniskreise von Figu- ren im Roman. Tante Letty bezieht sich auf die Erde, Digory über- trägt ihre Aussage auf alle phantastischen Welten. Die Textpassage
kann nur verstanden werden, wenn man denotativen (Tante Letty)
und symbolischen (Digory) Wortsinn gleichzeitig in ihr erkennt. Aus dieser Spannung ergibt sich das Verständnis der späteren Handlung in Narnia.
- S. 174ff (Polly und Digory blieben immer ... ein verdammt schönes Weib.“)
Problematisch ist die starke inhaltliche und sprachliche Verschrän- kung von irdischer Gegenwart, irdischer Zukunft, narnianischer Zu- kunft und dem Verweis auf die kommenden Narnia-Bücher. Schwie- rigkeiten dürfte v.a. der Zeitsprung auf S. 175 mit einhergehendem
Tempuswechsel machen (Abschluss der Handlung in London > Zukunft Narnias > Zukunft Digorys als erwachsener Mann > On- kel Andrew bei Digorys Eltern (Digory ein Kind), Rückblick auf Umzug Digorys aus London aufs Land).
V.2.2) KJL und Literaturübersetzung
Die Gesetzmäßigkeiten von KJL sind unabhängig vom Sprachgebiet. Sie gehören in den Bereich der Sprache allgemein und damit in das Fachgebiet der MTE. Sie im Fremdsprachenunterricht zu thematisieren, erscheint nur dann sinnvoll, wenn Kulturdifferenzen wissenschaftlich verbürgt und damit lehrbar sind, wenn also im Fremdsprachenunterricht über für Deutschland spezifische Gesetzmäßigkeiten im KJL-Bereich gelehrt werden kann. Für einen solchen Fall muss jedoch ein deutscher Originaltext herangezogen werden. Wegen des einheimischen Entstehungsraumes erfüllt die Überset- zung eines englischen Textes die Kriterien nicht.
Im Rahmen der Thematisierung von KJL kann jedoch ein anderes Problem angesprochen werden, dass den Adressatenbezug mit einschließt. Es ist zu untersuchen, ob die Übersetzung von KJL anderen Kriterien genügen muss als die Übersetzung von „Erwachsenenliteratur“, und wenn ja, was dies für Kriterien sind.
Die englische Schulklasse steht dabei potentiell auf der aktiven Seite des Translationsvorganges. Es ist die britische Kultur, die der deutschen durch Übersetzung nahe gebracht wird. Ein deutscher Übersetzer kann seiner ei- genen Kultur nur das vermitteln, was er selbst zuvor über die Herkunftskul- tur des Textes erfahren hat, sprich, was ihm vermittelt wurde. Der Aus- gangspunkt jeder Kulturvermittlungskette ist bei der jeweiligen Kultur selbst zu sehen.
In einer Gruppendiskussion kann dies anhand folgender Fragen evaluiert oder angerissen werden:
- Ist die deutsche Übersetzung eines englischen Textes primär ein deutscher oder ein englischer Text?
- Wer vermittelt die englische Kultur? Der Originaltext? Der Überset- zer?
- Wie ändert sich der Übersetzungsvorgang, wenn der Text von einem englischen Native speaker ins Deutsche übersetzt wird? Wie, wenn er von einem Deutschen übersetzt wird?
- Was wollen wir erreichen? Wollen wir den Deutschen „unser“ Ori- ginal wortgetreu nahebringen? Wollen wir es ihrer Kultur anpassen, so dass wir sicher sein können, dass sie ihn verstehen?
- Erkennen wir uns in der Übersetzung wieder? Können wir „typisch
Englisches“ in der deutschen Übersetzung ausmachen?
Manche der Fragen eignen sich, als Hausaufsatz oder schriftliche Stillarbeit behandelt zu werden. V.a. der letzte Punkt wird dann sehr ergiebig zu behandeln sein, wenn sich die Schüler in Ruhe mit dem deutschen Text auseinandersetzen können, v.a. mit den Passagen, die etwas über die britische Kultur des 19. Jh. aussagen (s. V.1.2).
Nach Erarbeitung eigener Vorstellungen können Textpassagen ins englische rückübersetzt, und anschließend mit dem Originaltext verglichen werden. Die markantesten Unterschiede zwischen der eigenen Übersetzung und dem Originaltext sollten schriftlich fixiert werden.
Es ist denkbar, diesen Schritt als Einstieg in das Thema an den Anfang der
Unterrichtseinheit zu setzen. Dann wird ein Ausschnitt des Originaltextes vorgelegt und ins Deutsche übersetzt, mit der Vorgabe, dass es sich um ein Kinderbuch handelt und für den anvisierten Leserkreis verständlich sein muss.
Geeignete Passagen für die Übersetzung sind:
- S. 7 In jenen Tagen ... neugierig an.
S. 7 In those days Mr full of curiosity.
v.a. die Auslassung von Bastables/Lewisham Road in der deutschen Übersetzung und der Austausch der Parallelstellung von Mr. Ketterly
- Mrs. Ketterly, brother - sister, old bachelor - old maid (durch die das Nebeneinander her leben (living together) ohne Gemeinsamkei- ten unterstützt wird), gegen Klammerstellung (dort lebten - Mr. Ket-
terly - alter Jungeselle - unverheiratete Schwester - Miss Ketterly).
- S. 93: „Dies ist mein Verderben!“ ... mit `nem Liedchen die Zeit vertrei- ben“.
S. 95f „My doom has come upon me,“ ... would be to sing a ´ymn.“
v.a. die Wiedergabe von doom-Verderben (auch: Urteil, Gericht) und der Dialekt des Kutschers)
- S. 119f Seit dem ersten Auftauchen ... An mich denkt keiner.“
S. 123ff Ever since the animals ... No one thinks of me.“
v.a. he was dreadfully practical - er war schrecklich unpraktisch
veranlagt (eigentlich: praktisch); he missed the whole point - ging
unbemerkt an ihm vorüber (eigentlich: verlor er völlig den Faden, geriet er völlig durcheinander); these brutes will eat the Rings along with the children - Jetzt fressen diese Bestien die Kinder mitsamt den Ringen (eigentlich: die Ringe mitsamt den Kindern)
Anhand der unterschiedlichen Ergebnisse bei der Übersetzung erkennen die Schüler die Schwierigkeiten und Gefahren jeder Übersetzungsarbeit (man- gelhafter Ausdruck d. sprachlichen Dialektes, Fehler, Betonungsverschie- bungen). Sie entwickeln eigene Übersetzungsvorschläge, die ihrer Meinung
nach die Intention, Stimmung und den Wortsinn des Originaltextes besser wiedergeben.
V.a. anhand des Dialektes des Kutschers sollte nach entstandenem Erkennt- niszuwachs noch einmal die Frage besprochen werden, ob und wie Literatur adäquat übersetzt werden kann. Daraus können verschiedene Projekte ent- stehen.
- einen deutschen, verschriftlichten Dialekt lesen und versuchen, Aus- sagen des Kutschers in diesen Dialekt zu übertragen.
Dabei empfiehlt es sich, auf einen für englische Schüler relativ leicht verständlichen deutschen Dialekt zu achten. Als geeignet wird we- gen gradueller Verwandtheit mit den angelsächsischen Sprachen das Friesischen angesehen (dt.: Pfeife, Katze / fries.: Pipe, Katte / engl.: pipe / cat).
- die Sache, für die der Dialekt ein Zeichen ist (ländliche Herkunft, ge- ringe Bildung) durch etwas anderes ausdrücken (körperliche Merkma- le (Schwielen), Vergleiche der Sprache (aus agrarischem Bereich)).
- eine Textpassage aus der Sicht des Kutschers schreiben, durch die seine Herkunft deutlich wird.
Als Abschluss dieser Untereinheit können die Schüler ein Exzerpt entwer- fen, nach welchen Kriterien und wie sie ein englisches Kinderbuch (wahl- weise auch ein Werk der „hohen“ Literatur) deutschen Kindern vermitteln würden. Sie können einen Index mit Überarbeitungsvorschlägen zum Text erarbeiten oder Vorschläge für die Übetragung des Textes in den deutschen Kulturraum machen.
V.2.3) Abschluss, weiterleitende Themen
Als Abschluss können die übersetzungsanalysierenden Schriften gesammelt und als Beiheft zum Buch herausgegeben wer dieses können auch Kommentare zum Leseeindruck, Übersetzungshilfen und freiwillige kreati-ve Schülerarbeiten eingehen. Das Beiheft kann als Arbeitsheft zum deut- schen den. Inund englischen Text in die Schulbibliothek gestellt werden.
Als weiterleitende Themen empfehlen sich Einblicke ins Studium und Berufsleben in Deutschland, dargestellt am Beispiel des Literaturübersetzers. Beschäftigung mit deutsch-britischen Beziehungen anhand aktuelle Tagespolitik oder regionalen Besonderheiten (Partnerstädte, Schüleraustausch) schließen an den Aspekt der Kulturvermittlung an.
Des weiteren können deutsche Kinderbuchklassiker besprochen werden, etwa Werke von Ottfried Preußler oder Michael Ende (bietet sich wegen dem ebenfalls märchenhaft-magischen Tenor an).
VI) Anhang: Materialien
VI.1) Inhalt des Primärtextes
Im London des ausgehenden 19. Jahrhunderts lebt Digory Kirke mit seiner todkranken Mutter bei deren Bruder Andrew Ketterley und ihrer Schwester, Miss Letty Ketterly. Gemeinsam mit dem Nachbarsmädchen Polly Plummer betritt er über einen geheimen Gang auf dem Dachboden des plum- mer´schen Hauses das geheime Arbeitszimmer seines Onkels in dessen Dachkammer. Andrew Ketterly, der sich mit Zauberei beschäftigt, entdeckt die beiden. Er überredet Polly, einen Ring anzustecken, der sie in eine ande- re Welt bringt. Digory muss auf dem gleichen Weg folgen, um ihr einen an- deren Ring zu bringen, der die Rückkehr auf die Erde ermöglichen wird.
Durch den Zauberring findet er sich in einem Wald voller Teiche, einem Durchgangsplatz zwischen allen Welten, wieder. Polly und er entschließen sich, vor der Rückkehr in das Arbeitszimmer Onkel Andrews´ in ein paar andere Welten hineinzusehen. Sie springen in einen Teich (diese sind die Tore zwischen den Welten) und landen in Charn, einem menschenleeren, verfallenen, unheimlichen Land.
Charn wurde von der bösen Königin Jadis regiert, die im Kampf gegen ihre ursupatorische Schwester alles Leben ausgelöscht und sich selbst in einen tiefen Schlaf gezaubert hatte. Trotz einer entsprechenden Warnung und Pol- lys Bedenken weckt Digory Jadis auf. Diese, eine riesenhafte, starke Zaube- rin, zwingt die Kinder, sie zuerst in den Durchgangswald und anschließend auf die Erde mitzunehmen, wo sie die Herrschaft übernehmen will.
In London beraubt die Hexe einen Juwelier, stiehlt eine Droschke und ver- ursacht einen Verkehrsunfall. In dem Tumult gelingt es Digory und Polly, Jadis anzufassen und so durch Berührung der Ringe wieder in den Wald zu gelangen, allerdings nehmen sie dabei das Droschkenpferd, den Kutscher und Onkel Andrew mit, die ebenfalls in Körperkontakt standen. Die Kinder springen in einen anderen Teich, und alle landen in einer leeren Welt, in der es keine Pflanzen, Tiere, Sterne gibt, nichts außer dem nackten
Boden und der Luft. Während Onkel Andrew, die Hexe und Digopry darum streiten, dass Digory sie nach London zurück bringen soll, beginnt in der Ferne der Löwe Aslan zu singen. Durch den Gesang erscheinen am Himmel Sterne, eine Sonne geht auf, aus der Erde kommen Gras, Bäume andere Pflanzen und schließlich Tiere hervor.
Jadis kann den Gesang nicht ertragen und schleudert den Arm einer Straßenlaterne, den sie in London abgerissen hatte um Polizisten zu attackieren, gegen Aslan. Dieser verzieht keine Miene und ignoriert die Hexe, welche flieht. Der Arm der Straßenlaterne versinkt in der weichen Erde und wächst zu einer neuen, immer brennenden Laterne heran.
Digory, der entdeckt hat, dass der Löwe Leben geben kann, folgt diesem, um ihn um ein Heilmittel für seine Mutter zu bitten. Währenddessen hat As- lan Nymphen, Faune, Dyraden und sprechende und laufende Bäume er- schaffen und einige Tiere ausgewählt, denen er die Sprache und Verstand verleiht. Einige davon wählt er aus, in einen Rat mit ihm zu treten, um einen Plan zu machen, wie Jadis aus Narnia, dem neuen Land, entfernt werden kann.
Derweil beginnen die andren sprechenden Tiere, das neue Land zu erkun- den, und finden Onkel Andrew. Da er sich entschlossen hatte, nicht zu glau- ben, dass ein Löwe singen kann, hatte er im Gegensatz zu den Kindern und dem Kutscher die Fähigkeit verloren, die Sprache Aslans oder der Tiere zu verstehen, und auch für diese sind die Worte, die er spricht, nicht mehr als ein unverständliches Geräusch. Im Zweifel, ob es sich bei dem Ding um ei- nen Baum oder ein vernunftloses Tier handelt, pflanzen sie ihn mit den Fü- ßen in der Erde ein und begießen ihn.
Zeitgleich stößt Digory zu dem Rat, wird von Aslan erkannt und dafür zur Verantwortung gezogen, dass er dem Bösen Zutritt in die neue Welt verschafft hatte. Er soll aus einem Garten eine Frucht bringen, die, zu einem Baum gewachsen, Narnia vor der Hexe schützen wird. Auf dem Droschkenpferd, das von dem Löwen zu einem sprechenden geflügelten Pferd gemacht wurde, fliegen er und Polly zu dem Garten jenseits von Narnia.
Durch ein Tor, in das eine Warnung eingelassen ist, dass die Früchte des Gartens nicht für sich selbst, nur für andere verwandt werden dürfen, betritt Digory den Garten und pflückt einen Apfel. Obwohl er hungrig und durstig ist, verzehrt er ihn nicht sondern steckt ihn in die Hosentasche. Da versperrt ihm Jadis, die über die Mauer in den Garten eingebrochen ist und eine Frucht gegessen hat, den Weg. Sie offenbart ihm, dass die Äpfel ewige Ju- gend verleihen und will Digory überreden, die für Aslan bestimmte Frucht selbst zu essen und mit ihr Narnia zu beherrschen, oder aber damit seine Mutter zu heilen. Digory entscheidet sich dennoch, den Apfel Aslan zu bringen.
Der Kutscher und seine von Aslan herbeigezauberte Frau Helen werden als Könige über Narnia und das Nachbarland Archeland eingesetzt. Digory darf den Baum pflanzen, dessen Geruch von Leben und Frische der Hexe derart Unbehagen und Angst einflößen wird, dass sie es nicht wagen wird, sich Narnia zu nähern. Aslan schenkt Digory einen Apfel für seine Mutter und bringt ihn, Polly und Onkel Andrew nach London zurück.
Andrew lässt dqas Zaubern für immer sein. Digorys Mutter lebt zwar nicht ewig, da der Zauber nur in seiner Ursprungswelt die volle Kraft entfaltet, doch sie wird gesund. Digory und Polly vergraben die Ringe und das Kern- gehäuse des Apfels im Garten der Ketterlys. Aus dem Kerngehäuse wächst ein Apfelbaum, der die gesündesten Äpfel ganz Englands trägt. Nach vielen Jahren entwurzelt ein Sturm den Baum, und Digory, nunmehr Professor Kirke, lässt sich aus dessen Holz einen Wandschrank bauen. Der Wand- schrank wird in späteren Folgen der Bücherserie eine wichtige Durchgangs- tür zwischen der Erde und Narnia sein.
VI.4) Quellenverzeichnis
Primärtext: Lewis. C.S.: Das Wunder von Narnia. Moers, 19953 Lewis C.S.: The Magicians´s Nephew. London 19758
1. Aufl. 1955
Stoltefuß, Martin: Elterliches Erziehungsrecht und staatliches Bildungswe- sen in England. Münster, 1993
www.kultusministerium.baden-wuerttemberg.de
(v.a. die Seiten der Bereiche Schule und Ministerium)
www.lbs.bw.schule.de/gymnasium/index
(Lehrplan aller Fächer in allen Jahrgängen für das Gymnasium in Baden-Württemberg)
www.dfee.gov.uk
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Textes "Das Wunder von Narnia"?
Der Text ist ein umfassender Sprach-Preview, der den Titel, ein Inhaltsverzeichnis, Lernziele und Hauptthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es handelt sich um eine didaktische Aufarbeitung des Kinderbuchs "Das Wunder von Narnia" von C.S. Lewis, mit dem Ziel, es im Deutsch- und Englischunterricht zu verwenden. Der Text behandelt die Begründung der Textauswahl, die Lokalisation der Lerngruppen (Baden-Württemberg und England), die Schulsysteme in beiden Regionen, lerngruppenspezifische Zielsetzungen und eine detaillierte Unterrichtsreihe für beide Länder. Der Anhang enthält Materialien, Quellen und Dokumente, einschließlich einer Inhaltsangabe des Primärtextes und Auszüge aus Bildungsplänen.
Warum wurde "Das Wunder von Narnia" als Text ausgewählt?
Die Wahl fiel auf "Das Wunder von Narnia", weil es die Verknüpfung zweier Kulturen (Deutsch und Englisch) thematisiert. Es ist die deutsche Übersetzung des Werkes eines britischen Autors, was den englischen Schülern den Zugang zur deutschen Sprache erleichtern und gleichzeitig eine neue Ebene muttersprachlicher Literatur erschließen soll. Für deutsche Schüler ermöglicht es einen Einblick in die literarische Kultur des europäischen Auslandes, ohne Sprachbarrieren überwinden zu müssen. Zudem wird die deutsche Sprache als Übersetzungssprache und die damit verbundene Problematik betrachtet.
Für welche Lerngruppen ist diese Unterrichtseinheit konzipiert?
Die Unterrichtseinheit ist für zwei unterschiedliche Lerngruppen konzipiert: eine 9. oder 10. Klasse eines Gymnasiums oder einer Realschule in Baden-Württemberg (Deutschland) und eine 12. Klasse einer Grammar oder Comprehensive School in England. Die Konzeption berücksichtigt die unterschiedlichen sprachlichen Fähigkeiten und Lernniveaus der Schüler in beiden Ländern.
Welche Ziele werden mit der Unterrichtseinheit in Baden-Württemberg verfolgt?
In Baden-Württemberg liegt der Fokus darauf, den Schülern anhand des Kinderbuches einen Einblick in die sprachlichen und stilistischen Gesetze der Kinder- und Jugendliteratur (KJL) zu geben und gleichzeitig die Thematik des Adressatenbezugs eines geschriebenen Textes zu behandeln. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der praktischen Erarbeitung seitens der Schüler, Handlung und Produktion, um die vom Lehrplan geforderten Unterrichtsziele zu erreichen.
Welche Ziele werden mit der Unterrichtseinheit in England verfolgt?
In England liegt der Schwerpunkt auf der Vermittlung des Aspektes Kinderliteratur. Die Schüler sollen KJL als eigenständigen Literatursektor kennen lernen, Vorstellungen von KJL zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten haben, Begriff und Relevanz der Adressatenorientierung eines Textes kennen, erkennen, dass die Form eines Textes bei Beibehaltung des Inhaltes in Bezug auf Gattung und Adressatenbezug modifiziert werden kann, zwischen Inhalt und Darbietung eines Textes unterscheiden können und einen Einblick in die Problematik der Literaturübersetzung und -übertragung gewinnen.
Wie sind die Schulsysteme in Baden-Württemberg und England organisiert?
Das Schulwesen in Baden-Württemberg untersteht den einzelnen Landesregierungen, während in England das Schulwesen der Staatsregierung unterstellt ist. In Baden-Württemberg gibt es eine hierarchische Struktur mit dem Ministerium für Jugend, Kultus und Sport an der Spitze. In England steht das Department of Education and Empleoyment (DfEE) an der Spitze. Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass die Schulen in Baden-Württemberg stärker zentral organisiert sind, während in England den Lehrern ein relativ großer Freiraum bei der Gestaltung des Unterrichtes bleibt.
Welche Themen werden in der Unterrichtsreihe behandelt?
Die Unterrichtsreihe ist in verschiedene Stufen gegliedert, die aufeinander aufbauen. Zu den behandelten Themen gehören mögliche hinleitende Themen, die Einführung des Buches, das Feld "Kinder- und Jugendliteratur", Adressatenorientierung, Übersetzungsproblematik und abschließende bzw. weiterleitende Themen. Die einzelnen Stufen sind flexibel und können je nach Bedarf modifiziert und ausgetauscht werden.
Welche Bedeutung hat die Übersetzungsproblematik im Rahmen der Unterrichtseinheit?
Die Frage nach der angemessenen Wiedergabe fremdsprachlicher Texte in Deutsch baut auf die Frage nach dem Adressatenbezug auf. Sie schließt ein Verständnis davon ein, dass bei der Übersetzungsarbeit gleichzeitig Adaptionsarbeit geleistet werden muss. Anhand von Beispielen aus dem Buch werden Eigenheiten der englischen Sprache und die Herausforderungen bei der Übersetzung verdeutlicht. Die Schüler sollen erkennen, dass bei der Übertragung zahlreiche Entscheidungen getroffen werden müssen und dass es wichtig ist, festzulegen, was den Vorrang haben soll (genaues Einfangen der Stimmung, wortgetreue Übersetzung oder eine für den Leserkreis verständliche Übersetzung).
Wo finde ich zusätzliche Informationen und Materialien zur Unterrichtseinheit?
Der Anhang des Textes enthält Materialien, Quellen und Dokumente, einschließlich einer Inhaltsangabe des Primärtextes, Auszüge aus Bildungsplänen für Baden-Württemberg und England, sowie ein Quellenverzeichnis mit Links zu relevanten Websites (z.B. Kultusministerium Baden-Württemberg, Department of Education and Employment).
- Quote paper
- Angelika Knapp (Author), 2001, C.S. Lewis: Das Wunder von Narnia. Ein Unterrichtsentwurf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102642