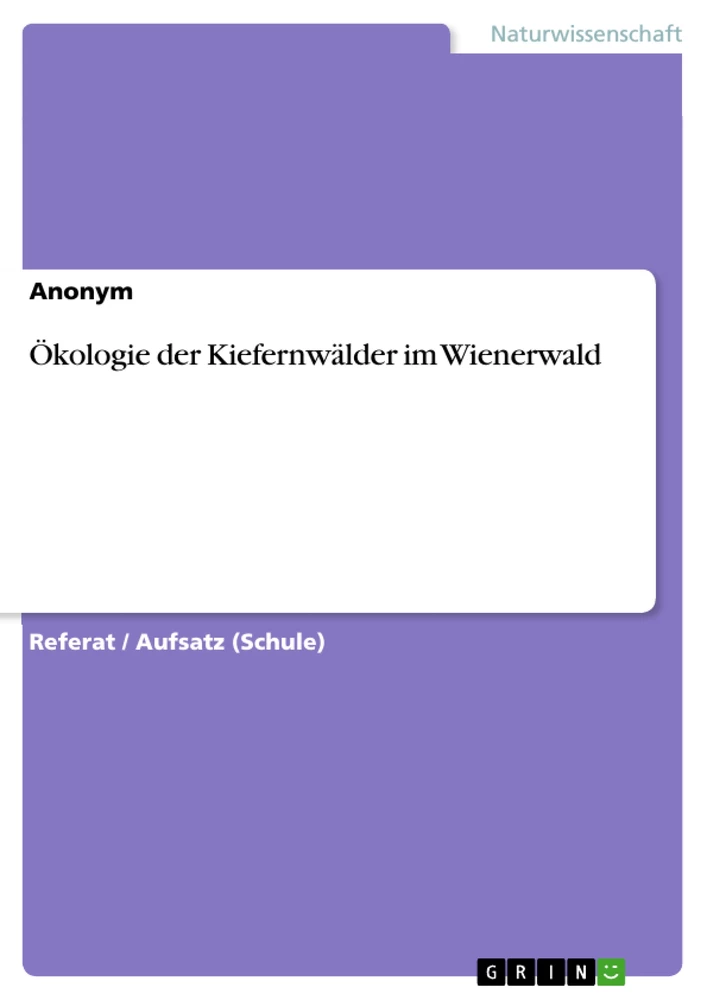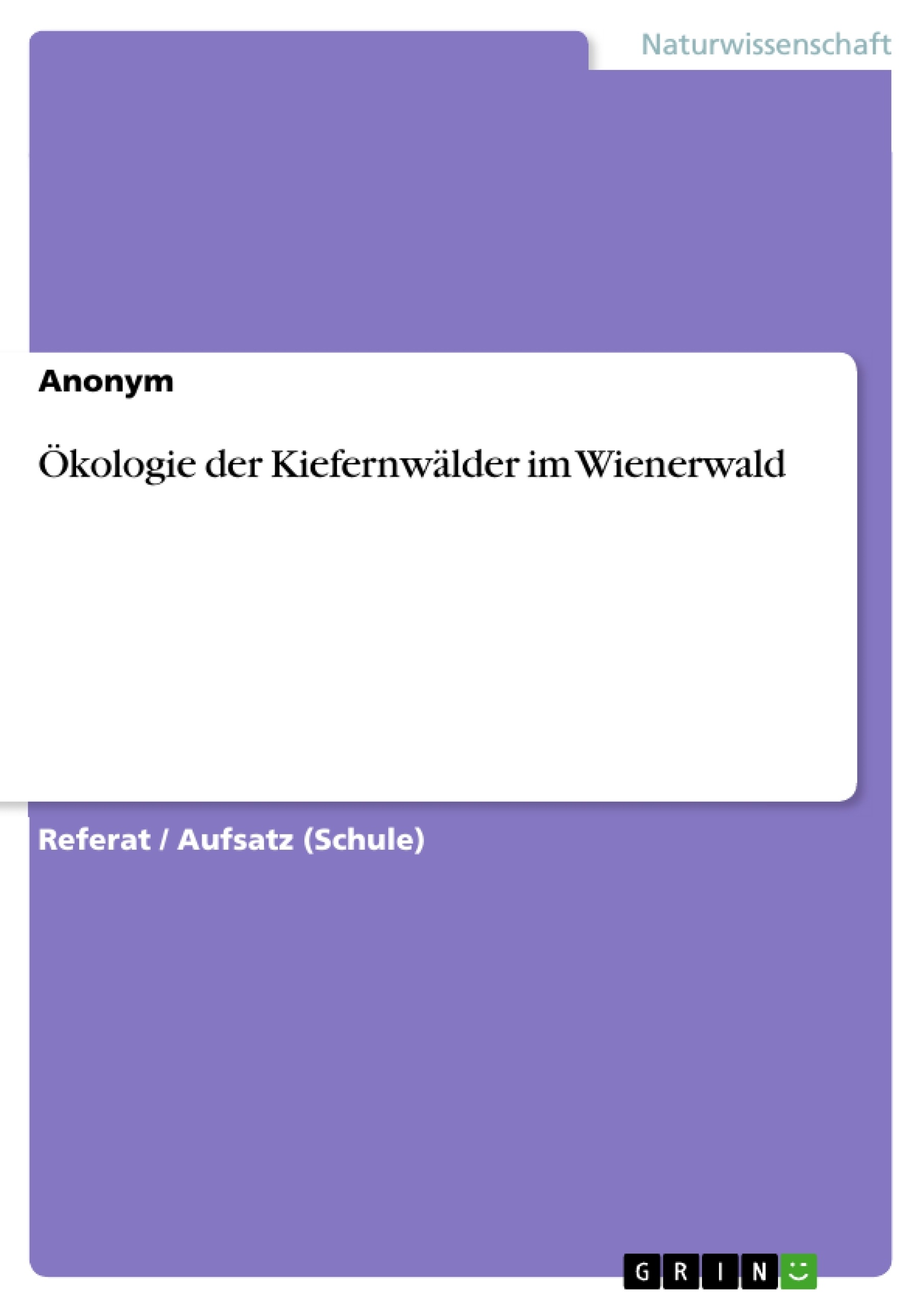1. Einleitung
Diese Arbeit befaßt sich einerseits mit der Ökologie der gesamten Kiefernwälder im
Wienerwald, andererseits besonders mit dem Beispiel des hohen Linkogels. Dieser 847 Meter hohe Berg liegt südlich von Wien, zwischen Alland, Berndorf und Baden. Der Lindkogel wird noch zum Kalkwienerwald gezählt, liegt jedoch an der Grenze zu den Kalkvoralpen. Jene Textabschnitte welche nur das Beispiel Linkogel behandeln sind durch Kursivschrift zu erkennen.
Arbeitsgrundlage für dieses Referat ist fast ausschließlich eine Standortserkundung von
Helmut Jelem im Auftrag der Forstlichen Bundesversuchsanstalt Mariabrunn in Schönbrunn.
2. Klima
2.1.Temperatur
Die täglichen Temperaturschwankungen im Wienerwald sind relativ hoch. Von der
Vegetationsperiode spricht mensch sobald eine durchschnittliche Tagesmitteltemperatur von 5 Grad überschritten wird.
So gemessen beginnt im östlichen Wienerwald die Vegetationsperiode etwa am 15. März und dauert bis in den November. Im westlichen Teil und in höheren Lagen tritt die Vegetationsperiode später ein und ist dementsprechend kürzer.
2.2.Niederschlag
Auch der Niederschlag ist im Wienerwald sehr unterschiedlich. Im Osten beträgt der
Niederschlag im Jahresdurchschnitt nur etwa 640 mm, während er im Westen bis zu
1000mm erreicht. Zusammenhängend mit den Tiefdrucktemperaturen im Mittelmeerraum liegt im Osten das Maximum an Niederschlägen im Frühjahr und im Herbst, im Westen jedoch im Sommer.
Die Schneelage dauert im nördlichen Wienerwald 30 bis 40 Tage, im südlichen Wienerwald hingegen 50 bis 60 Tage.
3. Geologische Gegebenheiten
Grundsätzlich besteht zwischen Kalk und Dolomit keine scharfe Grenze. Der Dolomit entstand nachträglich durch Umwandlungen des Kalkes infolge Eindringen wässriger Lösungen. Am Lindkogel findet mensch folgende Gesteine:
Gutensteinerkalk
Dieseälteste Kalksteinbildung am Lindkogel liefert dünnschichtige Ablagerungen. Dieses bituminöse Material ist vermutlich durch Schlammassen entstanden. Der Gutensteinerkalk ist bräunlich bis schwarz.
Ramsaudolomit
In dem Gebiet wo der Ramsaudolomit vorkommt gibt es eine starke Erosion und es entstehen ausgeprägte Schutthalden und Grabenbildungen. Dieses Material ist im mittleren Trias entstanden. Der Ramsaudolomit ist reinweißoder hellgrau mit zuckerkörniger Struktur.
Wettersteinkalk
Dieser entstand zur gleichen Zeit wie der Ramsudolomit und baut einen wesentlichen Bestandteil des Linkogels auf. Der Wettersteinkalk ist rein und hell.
Lunzer Schichten
Dieses Gestein entstand in der jüngeren Triaszeit und ist aus sandigem tonigem Grundmaterial gebildet.
Hauptdolomit
Er entstand ebenfalls in der jüngeren Triaszeit aus Meeresschlamm und Kalk. Das Material ist scharfkantig, splittrig und dunkler als der Ramsaudolomit.
Dachsteinkalk
Er tritt im Bereich Linkogel kaum auf. Der Dachsteinkalk ist hellgrau und wurde in mächtigen Bänken abgelagert.
4. Böden
Die Böden im Kalkwienerwald sind in ihrer Entstehung durch den vorherrschenden Kalk und Dolomit bestimmt.
So entstehen etwa auf Gutensteinerkalk tiefgründiger und nährstoffreichere Böden als auf Wettersteinkalk. die wenigen Bodentypen sind auf engstem Raum, aber in vielfältigsten Formen zu finden, sodass eine Bodentypisierung schwierig ist. Die kleinflächigen
Unterschiede wirken sich jedoch infolge unterschiedlicher Wasser und Lufthaushalte auf die Baumarten aus.
Folgende Bodenarten findet mensch nun im Bereich des Linkogels:
Rendsinen
-Protorendsina: Dieser Boden besteht aus einem flachgründigen losen Gemenge von unverwitterten Mineralteilchen, Pflanzenresten und Insektenexkrementen. Er ist meist trocken staubig und leicht verwehbar. Die Körnung ist Sand. Dieser Boden bildet die Primärstandorte der Schwarzföhre.
-mullartige Rendsina: Der Humushorizont besteht aus Insektenfeinmoder. Diese
Bodenform kommt meist auf Dolomit vor der chemisch schwer, physikalisch jedoch leicht verwittert sodass viel Feinmaterial entsteht. Dieser Bodentyp ist leicht, luftreich und staubt weniger als die Protorendsina.
-Mullrendsina: Sie hat eine ausgeprägte Mullhumusbildung und ist sandig-lehmig mit gutem Wasserhaushalt. Hier leben bereits Regenwürmer die Ton-Humus-Komplexe erzeugen. Dieser Boden tritt am Lindkogel nur auf schattseitigen Hängen auf.
-Tangelrendsina-Moderrendsina: Diese Bodenart bevorzugt etwas kühlere oder schattseitige Lagen. Die Bodenfarbe ist etwas brauner.
Terra Fucsa und Kalksteinrotlehm
Die Terra Fucsa ist hauptsächlich ausäolischen Sedimenten entstanden, bedeutend ist aber auch der Verwitterungsrückstand aus dem Kalk. Es handelt sich um alte Böden, deren Bildung unter den heutigen klimatischen Verhältnissen unmöglich erscheint. Diese Böden wurden in Folge von Erosion weitgehend umgelagert.
Auf den niedrigen Plateaus sind die Terra Fucsa Böden die natürlichen Standorte des Traubeneichen-Hainbuchenwaldes. Die Humusschicht ist sehr gering, weil der Boden trocken, dicht und untätig ist.
Mischböden (Kolluvien)
Abgesehen von den schon etwas kolluvial gelagerten Kalklehmen findet mensch auf allen Hängen in weiter Verbreitung Kolluvien in vielfältigsten Variationen. Sie bedecken Hangrinnen und Gräben.
In tiefen, sonnenseitigen Lagen gibt es untätige, schwach humose und trockene
Bodentypen, in schattseitiger Lage frische, lockere, tiefgründige Bodentypen mit guter Humusform.
Silikatischer Braunlehm
Dieser Boden ist sehr tiefgründig und schwer. Weiter oben ist der Boden eher leichter, in 20-30 cm Tiefe findet mensch jedoch einen außerordentlich dichten Lehm bis Ton. Die Humusschicht ist sehr gering.
5. Baumarten
5.1. Schwarzföhre
Die Schwarzföhre ist ein ostmediterranes Florenelement, das seine natürliche Verbreitung in Kärnten, Italien und dem ehem. Jugoslawien hat.
Im Wienerwald ist sie ein Relikt aus der Tertiärzeit als diese Landstriche noch meerenahe Gebiete waren.
Das niederösterreichische Schwarzföhrengebiet ist mit seinen 80 000 ha Fläche ein isolierter Vorposten des zentralen südlichen Schwarzföhrenverbreitungsgebietes. Die ökologische Amplitude der Schwarzföhre ist sehr breit, sie kann auch auf extrem trockenen Standorten als alleinige Holzart vorkommen. Sie ist im Stande, Dolomitböden nährstoffmäßig aufzuschließen. Sie beherrscht konkurrenzlos die Dolomitfelsen in allen Höhenstufen wo der Wasserhaushalt für Laubholzarten nicht mehr ausreicht. Ihre Primärstandorte sind also Dolomitfelsen und Schutthalden, da die Laubholzstandorte aber oftmals kahlgeschlagen wurden hatte die Schwarzkiefer die Möglichkeit, sich auszubreiten. sie hat sich sekundär eingebürgert. So entstanden aus Laubwäldern unsere heutigen Schwarzföhren-Buchen-Mischwälder in einer Baumarten- mischung von Schatten und Lichtholz wie sie in der Natur nur selten entsteht. In freier und ungelenkter Konkurrenz würde die Schwarzföhre auch wieder weitgehend an Lebensraum verlieren, und diesen an Laubbäume abgeben müssen. Der allergrößte Teil der heutigen Schwarzföhrenbestände sind nach pflanzensoziologischer Beurteilung als sekundär anzusehen.
Der wirtschaftliche Einfluss und der künstliche Umbau der Wälder ist jedoch schon soweit fortgeschritten, dass sich der Waldhaushalt auf diesen sekundären zustand weitgehend eingespielt hat und ein sekundäres Gleichgewicht erzeugt hat.
Ihre beste Bonität erreicht die Schwarzföhre in kühleren Lagen, außerdem bevorzugt sie die Schatthänge.
Die Schwarzföhre ist nicht als kontinentaler sondern illyrischer Charakterbaum anzusehen der hohe Bodenwärme in Verbindung mit einer gewissen Luftfeuchtigkeit bevorzugt. Die Schwarzföhre wurzelt sehr tief, sowohl auf bindigen als auch auf lockeren und steinigen Böden. Ihre dickrindigen Schotterwurzeln sind gegen Druckschäden sehr widerstandsfähig und dringen auch leicht in Felsspalten ein.
Es gibt zwei verschiedene Rassen von Schwarzkiefern, eine breitkronige und eine schmalkronige. Die breitkronige Rasse hat lockere Kronen mit weniger aber stärkeren Ästen, die scmalkronige Rasse ist durch eine größere Anzahl von schwächeren Ästen charakterisiert. Es scheint dass diese Unterschiede nicht alleine auf verschieden Ernährungsmodifikationen zurückgehen, sondern tatsächliche Rassenunterschiede sind.
Der Kronenschluss der Schwarzföhre ist relativ dicht, sie ist im Vergleich zur Rotföhre nicht so lichtbedürftig. unter den Föhren besitzt die Schwarzföhre die größte Schattenfestigkeit, sie ist eine Halbschattenart. Der Höhenwuchs ist in den ersten Jahren geringer als bei der Rotföhre und sie verträgt eine gewisse seitliche Bedrängung. Sie ist völlig unempfindlich gegen Windaustrocknung und auch gegen Frost und Schneebruch sehr widerstandsfähig. Gegen Nebel und Rauhreif ist die Schwarzföhre empfindlich, weshalb sie Nebellagen meidet. Der Wasserverbrauch der Schwarzföhre ist sehr gering.
Die Schwarzföhre ist wahrscheinlich die genügsamste Holzart unter allen Wadbäumen. Findet mensch in der Gesamtasche der Weißkiefer 60% Kalk, 10% Kali, 5% Phosphorsäure und 8% Magnesia, so findet mensch in der Asche der Schwarzkiefer nur 38% Kalk, 21% Kali, 7% Phosphorsäure und 12% Magnesia. Die Schwarzföhre ist daher im Mineralstoffanspruch sehr genügsam.
5.2. Die Rotbuche
In der mäßig warmen Stufe erreicht die Rotbuche in schattseitigen Lagen Nutzholztauglichkeit, auch ihre natürliche Verjüngung ist in dieser Stufe leicht erzielbar. In der warmen Stufe ist dagegen ihre Lebenskraft geringer und daher auch die natürliche Verjüngung schwieriger.
5.3. Traubeneiche
Die Trauebneiche steht bevorzugt in tiefer Lage und auf südexponierten Hängen sowie auf Terra-Fusca-reichen Mischböen.
5.4. Hainbuche/Weißbuche
Sie hat ihren Lebensraum in der warmen Stufe und bevorzugt lehmigere Mischböden sowie Terra-Fusca. Sie kommt in Plateaulagen bis etwa 500 Meter vor. Meist reicht die Hainbuche nur in Nebenbestand.
In den südexponierten Gräben steigt sie höher hinaus, sofern lehmige Böden vorhanden sind. die Hainbuche bevorzugt Gräben auf Grund ihrer luftfeuchteren und bodenfrischeren Lagen.
5.5. Tanne
Die Tanne kommt in der mäßig warmen Stufe vor, jedoch nur noch als schlechtwüchsiger unterdrückter Einzelbaum. In schattseitigen frischen Gräben wäre es jedoch möglich die Tanne wieder vermehrt einzubringen. Kahlschlagwirtschaft und der Wildverbiss haben sie völlig verdrängt. in der warmen Waldstufe fehlt die Tanne.
5.6. Lärche
Die Lärche dürfte im Gebiet der Termenalpe noch nicht natürlich vorkommen, daher sind Lärchenaufforstungen durchaus unbefriedigend. Nur im Nordabfall des Lindkogels kann sie in Einzelmischung standorttauglich sein.
5.7. Fichte
Die Fichte ist im Gebiet auch nicht natürlich, ihr heutiges Gruppen und horstweises Vorkommen geht auf mißlungene Einbringungsversuche zurück. Sie wurde vom Laubholz verdrängt, blieb im Wuchs zurück und war der Konkurrenz der natürlichen Baumarten nicht gewachsen.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Ökologie der Kiefernwälder im Wienerwald und speziell mit dem Beispiel des Lindkogels.
Wo liegt der Lindkogel?
Der Lindkogel liegt südlich von Wien, zwischen Alland, Berndorf und Baden.
Woher stammen die Informationen für diese Arbeit?
Die Arbeitsgrundlage ist hauptsächlich eine Standortserkundung von Helmut Jelem im Auftrag der Forstlichen Bundesversuchsanstalt Mariabrunn.
Wie ist das Klima im Wienerwald?
Die täglichen Temperaturschwankungen sind relativ hoch. Die Vegetationsperiode beginnt im Osten etwa am 15. März und dauert bis November. Der Niederschlag variiert von 640 mm im Osten bis 1000 mm im Westen.
Welche geologischen Gegebenheiten gibt es am Lindkogel?
Am Lindkogel findet man Gutensteinerkalk, Ramsaudolomit, Wettersteinkalk, Lunzer Schichten, Hauptdolomit und Dachsteinkalk.
Welche Bodenarten gibt es im Bereich des Linkogels?
Man findet Rendsinen (Protorendsina, mullartige Rendsina, Mullrendsina, Tangelrendsina-Moderrendsina), Terra Fucsa, Kalksteinrotlehm, Mischböden (Kolluvien) und silikatischen Braunlehm.
Welche Baumarten sind im Wienerwald relevant?
Die wichtigsten Baumarten sind Schwarzföhre, Rotbuche, Traubeneiche, Hainbuche/Weißbuche, Tanne, Lärche und Fichte.
Was ist das Besondere an der Schwarzföhre im Wienerwald?
Die Schwarzföhre ist ein Relikt aus der Tertiärzeit und ein isolierter Vorposten des zentralen südlichen Schwarzföhrenverbreitungsgebietes. Sie ist sehr genügsam und kann auch auf extrem trockenen Standorten vorkommen.
Wo findet man die Traubeneiche?
Die Traubeneiche steht bevorzugt in tiefer Lage und auf südexponierten Hängen sowie auf Terra-Fusca-reichen Mischböen.
Wo findet man die Hainbuche/Weißbuche?
Sie hat ihren Lebensraum in der warmen Stufe und bevorzugt lehmigere Mischböden sowie Terra-Fusca. Sie kommt in Plateaulagen bis etwa 500 Meter vor.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2001, Ökologie der Kiefernwälder im Wienerwald, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102624