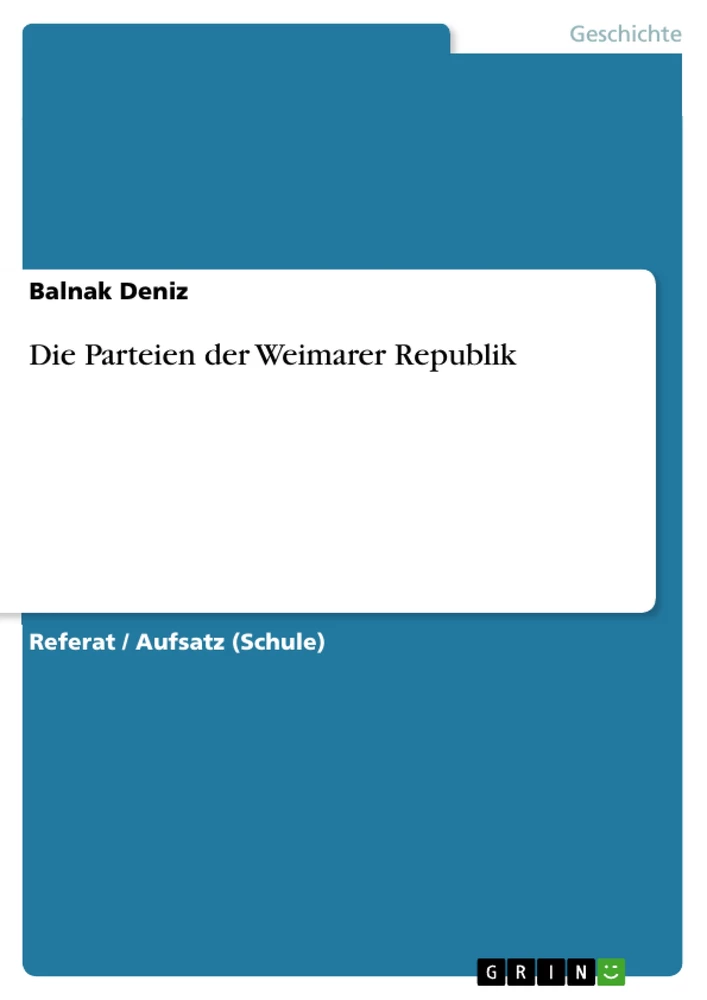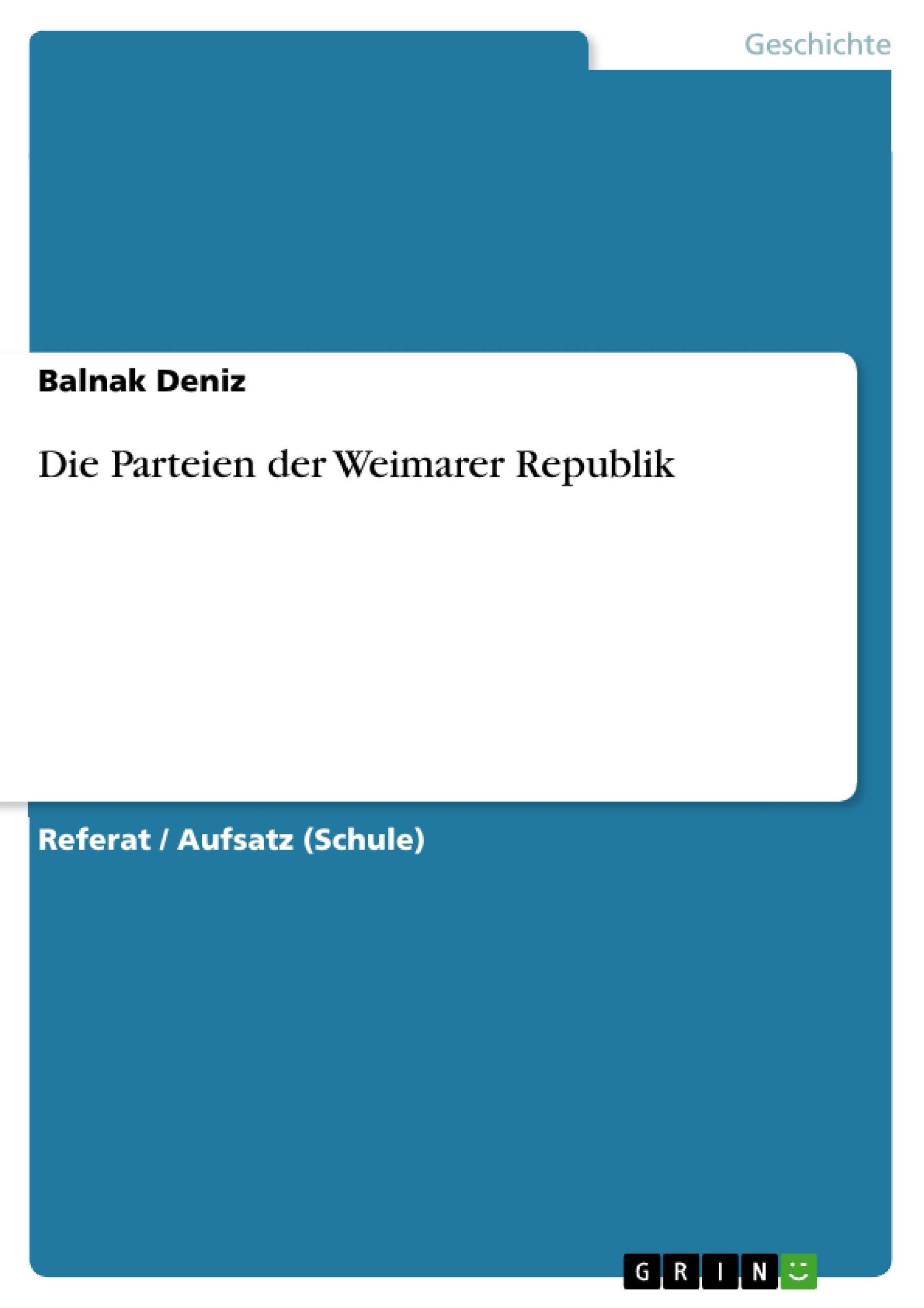In den Wirren der Weimarer Republik, einem Zeitalter des Umbruchs und der politischen Zerrissenheit, rangen unterschiedliche politische Kräfte um die Vorherrschaft. Doch welche Ideologien formten diese turbulente Ära wirklich, und wie beeinflussten sie das Schicksal Deutschlands? Dieses Buch taucht tief ein in die Welt der Weimarer Parteien, von den traditionsreichen Konservativen der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) bis hin zu den aufstrebenden Nationalsozialisten, um ein umfassendes Bild der politischen Landschaft zu zeichnen. Im Fokus stehen das Zentrum, eine Bastion des politischen Katholizismus, die zwischen Tradition und Republikanismus navigierte und mit Reichskanzlern wie Brüning die Politik maßgeblich prägte, sowie die Bayerische Volkspartei, die eine konservativere, föderalistische Vision verfolgte. Die Deutsche Demokratische Partei (DDP), ein Sammelbecken linksliberaler Kräfte, kämpfte für die Weimarer Verfassung und scheiterte letztlich an ihrer eigenen Unfähigkeit zur Massenmobilisierung. Die Deutsche Volkspartei (DVP) verkörperte das rechtsliberale Bürgertum, lavierte zwischen Monarchie und Republik und suchte die Gunst der Wirtschaft. Die Deutschnationale Volkspartei (DNVP), eine Stimme der alten Eliten, träumte von der Wiederherstellung der Monarchie und verschmolz schließlich mit dem Nationalsozialismus. Entdecken Sie die Biografien der führenden Köpfe, die innerparteilichen Konflikte und die strategischen Schachzüge, die das politische Panorama der Weimarer Republik prägten. Eine fesselnde Analyse, die nicht nur die Ideologien und Programme der Parteien beleuchtet, sondern auch deren verhängnisvolle Rolle beim Aufstieg des Nationalsozialismus und dem Untergang der ersten deutschen Demokratie aufzeigt. Tauchen Sie ein in eine Zeit, in der das Schicksal einer Nation auf dem Spiel stand, und verstehen Sie die komplexen Kräfte, die den Weg in die Katastrophe ebneten. Eine unerlässliche Lektüre für alle, die die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts verstehen wollen.
Eine der augenfälligsten Veränderungen, die die Umbildung des deutschen Staatswesens in Richtung parlamentarischerOrdnung durch die Oktoberreformen 1918 und die Gründung der Republik brachte, war die gewachsene Bedeutung der Parteien als Träger der Politik, auch wenn ihnen hierfür die Verfassung keinen ausdrücklichen Auftrag gab. Dabei blieb das alte Parteienschema mit einigen, den Zeitverhältnissen entsprechenden Umbenennungen mit den Konservativen ( im wesentlichen repräsentiert durch die Deutschnationale Volkspartei ), dem politischen Katholizismus ( Zentrum und Bayerische Volkspartei ), dem Rechts- und Linksliberalismus ( Deutsche Volkspartei und Deutsche Demokratische Partei )sowie den Sozialisten, bestehen.
Hinzu traten als Flügelparteien die Kommunisten und die Nationalsozialisten.
Das Zentrum deutsche katholische Partei (1870-1933)
Katholische Gruppierungen in deutschen Länderparlamenten formierten sich als politisch-parlamentarisch eVertretung des Katholizismus und zogen 1871 mit 48 Abgeordneten in den Deutschen Reichstag ein. Wegen ihrer Plazierung in der Mitte des Sitzungssaales und wegen ihrer Zielsetzung, angesiedelt zwischen derjenigender Konservativen und Liberalen, nannten sie sich Deutsche Zentrumspartei. Mit ihrer großen, stabilen Wählerschaft stellte die Zentrumspartei von 1881 bis 1912 und 1916 bis 1918 die stärkste Fraktion.
Maßgeblich gestaltete sie die Politik der Weimarer Republik mit. Obwohl die Zentrumspartei die Novemberrevolution ablehnte, verteidigte sie die republikanisch- demokratische Verfassung und beteiligtesich von 1919 bis 1932 an den Regierungen. Zitat aus dem 4. Reichsparteitag in Kassel:
„ Die Zentrumspartei ist in ihrem Wesen eine Verfassungspartei. Ihre grundsätzliche Einstellung zum Staats- und Autoritätsbegriff ermöglicht ihr die Bejahung jeder Staatsform, in welcher dieser Begriff seine Verwirklichung finden kann ... Darum bekennt sich die Zentrumspartei zur deutschen Republik, die in der Weimarer Verfassung festgelegt ist und deren Schutz und Durchdringlichkeit mit christlichem Geiste sie als ihre Aufgabe und Pflicht betrachtet.“
Parteivorsitzende während der Weimarer Republik waren Karl Trimborn (1917-1920) und Wilhelm Marx (1920-1928).
In neun Kabinetten stellte sie insgesamt vier Reichskanzler (Konstantin Fehrenbach 1920/21;. Joseph Wirth 1921/22; Wilhelm Marx 1923-1925 und 1926-1928; Heinrich Brüning 1930-1932).
Brüning förderte mit seiner Zuflucht zu autoritärer Politik und mit Maßnahmen, die der schweren Wirtschaftskrisenicht Herr werden konnten, eher den Zerfall der Weimarer Republik, als dass er den Aufstieg der Nationalsozialisten behinderte.
Am 27. März 1933 stimmten die Abgeordneten des Zentrums, das von Adolf Hitler unverbindliche Zusagen zur Einhaltung des verfassungsmäßigen Weges erhalten hatte, dem Ermächtigungsgesetz zu. Im Zuge der nationalsozialistischenGleichschaltung musste sich das Zentrum vier Monate später auflösen. Ehemalige Zentrumspolitiker gehörten nach dem Krieg zu den Begründern der CDU.
Für das Zentrum konnte es im Volksstaat keine Herrschaft einer besonderen Gruppe oder Klasse geben. Es forderte eine zentralistische Staatsstruktur bei Fortbestehen der Länder. Die Kirche hatte für diese Partei sowohl in der Kulturpolitik als auch in der Verfassung bewahrende Aufgaben und Rechte.
Wirtschaft und Gesellschaft wünschte das Zentrum berufsständisch gegliedert zu sehen. Außenpolitisch lag das Zentrum auf der Linie des Revisionismus.
Die Bayerische Volkspartei
Schon 1918 war der bayerische Parteiflügel des Zentrums unter dem Namen Bayerische Volkspartei aufgetreten. Unter dieser Bezeichnung löste er sich nun völlig von der Mutterpartei ab und entwickelte ein eigenes, auf katholischen Fundamenten beruhendes, Programm, das weitaus stärker als beim Zentrum zur Monarchie und zu einer Rückkehr zur Bismarckschen Reichsverfassung mit ihren ausgeprägt föderativen
Strukturen tendierte. Es ist kein Zufall, dass die bayerische Volkspartei in den Tagen des Kapp-Lüttwitz-Putsches durch eine gegen das legale Ministerium unter sozialdemokratischer Führung gerichtete Aktion in die Verantwortung gelangte und
seither im Bündnis mit dem bayerischen Ableger der Deutschnationalen, der Bayerischen Mittelpartei, und dem seit den Tagen der Münchener Rätezeit zum Konservatismus zurückgekehrten Bayerischen Bauernbund die Landesregierung bildete. Obgleich die BVP ebenfalls einen Arbeiterflügel besaß, gewann dieser für die Politik der Partei keine große Bedeutung, und so war sie weniger den Parteien der bürgerlichen Mitte als vielmehr den Rechtsparteien zuzurechnen. Zumindest gilt dies für die Jahre bis 1923, in denen die BVP eine prononcierte Politik bayerischer Eigenstaatlichkeit betrieb.
Zwischen 1920 und 1928 waren immer etwa 16 - 18 Mitglieder in der Reichtagsfraktion, die wie die rechtsgerichteten Parteien oppositionell wirkten.
Die 1925 einsetzende rechtsentwicklung des Zentrums, führte wieder zur Zusammenarbeit, nicht aber zur organisatorischenVerbindung. Doch diese Zusammenarbeit zerbrach, als die BVP den Ausschluß von Joseph Wirth und dem gesamten linken Flügel verlangte.
Die Bayerische Volkspartei verfocht mit Entschiedenheit das Prinzip der Bundesstaatlichkeit wie in der Bismarckschen Verfassung, stand sonst mit stark konservativer Akzentuierung den Auffassungen des Zentrums nahe.
Die Deutsche Demokratische Partei
Die linksliberale Partei der Weimarer Republik wurde am 20. November 1918 von Friedrich Naumann mitbegründet. Sie setzte sich aus ehemaligen Mitgliedern der Fortschrittlichen Volkspartei (FVP), den Jungliberalen und dem linken Flügel der Nationalliberalen Partei zusammen und stützte sich vor allem auf den bürgerlichen Mittelstand. In der Weimarer Nationalversammlung verfügte die DDP über knapp 20 Prozent der Sitze und wirkte als drittstärkstePartei maßgeblich an der Ausarbeitung der Weimarer Verfassung mit.
Es sah so aus, als würde die DDP die republikanische Staatspartei werden, zu der sich jeder bekennt, der die aktuelle staatliche Ordnung gutheißt und diese so belassen will. Zitat aus dem Programm vom 15.12.1919:
Die Deutsche Demokratische Partei steht auf dem Boden der Weimarer Verfassung;
zu ihrem Schutz und zu ihrer Durchführung ist sie berufen.
Voraussetzung des Erfolges ist die Erziehung des Volkes zur staatsbürgerlichen Gesinnung. Das Verhältnis des einzelnen zur Gesamtheit bestimmt sich durch den Gedanken der staatsbürgerlichen Pflicht.
Die DDP war eine der Parteien der Weimarer Koalition und von 1919 bis 1932 mit einer kurzen Unterbrechung 1927/28 an der Regierung beteiligt.Der Stimmenanteil der DDP ging von 18,6 Prozent im Jahr 1919 auf knapp fünf Prozent im Jahr 1930 zurück.
Die Partei war zu Stolz auf das was sie hatte und plante die Zukunft und die Veränderungen nicht mit ein, zu spät erst wurde der Versuch unternommen eine Massenpartei zu bilden.
Angesichts des Stimmenverlusts schloss sich die Mehrheit der DDP mit anderen Parteien,
u. a. mit dem Jungdeutschen Orden, zur Deutschen Staatspartei zusammen. Im Juni 1933 löste sich die Partei selbst auf.
Die Deutsche Demokratische Partei sah in ihrem Programm den Volkswillen als oberstes Gesetz an. Sie lehnte aus Sorge vor einer Bürokratisierung der Wirtschaft die Sozialisierung der Produktionskräfte ab, bekämpfte aber Monopole und forderte Reformen im großagrarischen Bereich. Außenpolitisch verlangte die DDP eine Revision des Friedensvertrages und deutsche Gleichberechtigung. In der Kulturpolitik vertrat die Partei wie auch die DVP den liberalen Grundsatz der Trennung von Staat und Kirche.
Die Deutsche Volkspartei
Die Hoffnungen des rechtsliberalen Bürgertums waren von 1920 an auf die Deutsche Volkspartei gerichtet. Ohne einen vergleichbaren Parteiapparat, wie er in vielen Bezirken der DDP zur Verfügung stand, war die Wahl zur Nationalversammlung für die neue Partei des nationalen Liberalismus noch zu früh gekommen. Mit 4,4 Prozent der abgegebenen Stimmen lag sie an fünfter Stelle. Doch in den Beratungen der Nationalversammlung erwies sie sich als konsequente Vertreterin eines Bildungsbürgertu ms, das die Revolution ablehnte und der Neuentwicklung mit unverhohlener Kritik gegenüberstand. Das Bekenntnis zur Monarchie und zu den alten Reichsfarben rückte die DVP in die Nähe der Deutschnationalen, von denen sie sich im wesentlichen nur durch einen geringeren Verbalradikalismus und die Ablehnung des
Antisemitismus unterschied. Immerhin gab es durchaus enge Kontakte und Erwägungen einer Fusion. Die Nagelprobe kam in den Tagen des Kapp - Lüttwitz - Putsches, als die DVP unter Stresemann zunächst den gegenrevolutionären Vorstoß zumindest nicht missbilligte, dann aber, als sein Scheitern offensichtlichwurde, um Vermittlung zwischen der legitimen Regierung un den Usurpatoren bemüht war. Die DVP war zu diesem Zeitpunkt ganz und gar opportunistisch eingestellt. Sie missbilligte den politischen Generalstreik gegen die Putschisten und kritisierte das Verhalten der Reichsregierung und der Länderregierungen in den nachfolgendenpolitischen Unruhen.
Der DVP kam zugute, dass sie bald eine eigene Parteiorganisation entwickeln konnte, die - gestützt auf Zahlungen aus der Wirtschaft - in der Lage war, Propaganda zu treiben. Als Gegenleistung für die Unterstützung durch die Wirtschaft mussten führende Vertreter der Schwerindustrie als Kandidaten für den Reichstag akzeptiert werden.
Geschadet hat dies der DVP nicht. Bei den Wahlen am 6. Juni gewann sie einen großen Teil der DDP - Wähler und wurde mit 13,9 Prozent der Stimmen die viertstärkste Partei. Die Deutsche Volkspartei setzte sich für eine starke, zentrale Staatsgewalt bei Erhaltung Preußens ein. Soziale und ökonomische Konflikte sollten gütlich ausgeglichen werden, das Unternehmertum erhalten bleiben. Außenpolitisch verfocht die Volkspartei sowohl deutsche Selbstbestimmung , d.h. Revision der Versailler Vertragsauflagen, als auch Vökerversöhnung.
Die Deutschnationale Volkspartei
Die Deutschnationale Volkspartei wurde im November 1918 aus konservativen, antiparlamentarischen und antisemitischen Gruppierungen gebildet. Die rechtsgerichtete Partei in Deutschland, deren Wählerschaft sich vor allem aus ehemaligen Offizieren, Ärzten, Professoren, Bauern und Beamten zusammensetzte, strebte die Wiederherstellungder Monarchie und den Wiedererwerbvon Kolonien an. Ebenfalls forderte sie eine Vormachtstellung Preußens bei föderalistischer Gliederung des Reiches. 1924 bis 1928 war die DNVP stärkste bürgerliche Reichstagsfraktion, 1926 war sie am Minderheitenkabinett der Mitte sowie 1927/28 an der Koalitionsregierung mit dem Zentrum beteiligt.Unter Alfred Hugenbergs Führung entwickelte sich die DNVP zu einer reaktionär - nationalistischenPartei. Im Oktober 1931 schloss sie sich mit den Nationalsozialisten zusammen (Harzburger Front). Im Januar 1933 trat sie dem Kabinett Adolf Hitlers bei. Im Juni 1933 folgte die Selbstauflösung. Oskar Hergt (1920-1926) und Kuno Graf von Westarp (1926-1928) waren die Parteivorsitzenden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Zentrum (Deutsche Katholische Partei)?
Das Zentrum war eine deutsche katholische Partei, die von 1870 bis 1933 existierte. Sie entstand aus katholischen Gruppierungen in den deutschen Länderparlamenten und wurde 1871 mit 48 Abgeordneten in den Deutschen Reichstag gewählt. Die Partei positionierte sich zwischen Konservativen und Liberalen und war von 1881 bis 1912 sowie von 1916 bis 1918 die stärkste Fraktion.
Welche Rolle spielte das Zentrum in der Weimarer Republik?
Das Zentrum spielte eine bedeutende Rolle in der Politik der Weimarer Republik. Obwohl die Partei die Novemberrevolution ablehnte, verteidigte sie die republikanisch-demokratische Verfassung und beteiligte sich von 1919 bis 1932 an den Regierungen. Die Partei stellte vier Reichskanzler: Konstantin Fehrenbach, Joseph Wirth, Wilhelm Marx und Heinrich Brüning.
Was geschah mit dem Zentrum während der Zeit des Nationalsozialismus?
Am 27. März 1933 stimmten die Abgeordneten des Zentrums dem Ermächtigungsgesetz zu, nachdem sie von Adolf Hitler unverbindliche Zusagen zur Einhaltung des verfassungsmäßigen Weges erhalten hatten. Im Zuge der nationalsozialistischen Gleichschaltung musste sich das Zentrum vier Monate später auflösen. Ehemalige Zentrumspolitiker gehörten nach dem Krieg zu den Begründern der CDU.
Was waren die politischen Ziele des Zentrums?
Das Zentrum forderte eine zentralistische Staatsstruktur bei Fortbestehen der Länder. Es forderte, dass die Kirche sowohl in der Kulturpolitik als auch in der Verfassung bewahrende Aufgaben und Rechte wahrnimmt. Das Zentrum wünschte sich eine berufsständisch gegliederte Wirtschaft und Gesellschaft. Außenpolitisch lag das Zentrum auf der Linie des Revisionismus.
Was war die Bayerische Volkspartei (BVP)?
Die Bayerische Volkspartei entstand 1918 als bayerischer Parteiflügel des Zentrums und löste sich später völlig von der Mutterpartei ab. Sie entwickelte ein eigenes, auf katholischen Fundamenten beruhendes Programm, das stärker zur Monarchie und einer Rückkehr zur Bismarckschen Reichsverfassung tendierte. Sie betrieb eine prononcierte Politik bayerischer Eigenstaatlichkeit, insbesondere bis 1923.
Wie war die Beziehung zwischen dem Zentrum und der BVP?
Obwohl es eine Zusammenarbeit gab, kam es nicht zu einer organisatorischen Verbindung. Die Zusammenarbeit zerbrach, als die BVP den Ausschluss von Joseph Wirth und dem gesamten linken Flügel des Zentrums verlangte.
Was war die Deutsche Demokratische Partei (DDP)?
Die Deutsche Demokratische Partei war eine linksliberale Partei der Weimarer Republik, die 1918 mitbegründet wurde. Sie setzte sich aus ehemaligen Mitgliedern der Fortschrittlichen Volkspartei, den Jungliberalen und dem linken Flügel der Nationalliberalen Partei zusammen. Die DDP wirkte maßgeblich an der Ausarbeitung der Weimarer Verfassung mit.
Was waren die politischen Ziele der DDP?
Die DDP sah den Volkswillen als oberstes Gesetz an. Sie lehnte die Sozialisierung der Produktionskräfte ab, bekämpfte aber Monopole und forderte Reformen im großagrarischen Bereich. Außenpolitisch verlangte die DDP eine Revision des Friedensvertrages und deutsche Gleichberechtigung. In der Kulturpolitik vertrat sie die Trennung von Staat und Kirche.
Was geschah mit der DDP?
Der Stimmenanteil der DDP ging von 18,6 Prozent im Jahr 1919 auf knapp fünf Prozent im Jahr 1930 zurück. Angesichts des Stimmenverlusts schloss sich die Mehrheit der DDP mit anderen Parteien zur Deutschen Staatspartei zusammen. Im Juni 1933 löste sich die Partei selbst auf.
Was war die Deutsche Volkspartei (DVP)?
Die Deutsche Volkspartei war eine rechtsliberale Partei, die sich ab 1920 an das Bürgertum richtete. Die DVP setzte sich für eine starke, zentrale Staatsgewalt bei Erhaltung Preußens ein. Sie befürwortete einen Ausgleich sozialer und ökonomischer Konflikte und den Erhalt des Unternehmertums. Außenpolitisch forderte sie Revision der Versailler Vertragsauflagen und Völkerversöhnung.
Was war die Deutschnationale Volkspartei (DNVP)?
Die Deutschnationale Volkspartei wurde im November 1918 aus konservativen, antiparlamentarischen und antisemitischen Gruppierungen gebildet. Sie strebte die Wiederherstellung der Monarchie, den Wiedererwerb von Kolonien und eine Vormachtstellung Preußens an. Im Oktober 1931 schloss sie sich mit den Nationalsozialisten zusammen (Harzburger Front) und trat im Januar 1933 dem Kabinett Adolf Hitlers bei. Im Juni 1933 erfolgte die Selbstauflösung.
Was waren die politischen Ziele der DNVP?
Die Deutschnationalen gingen von der Monarchie als staatsbildendem Element aus. Sie befürworteten Arbeitsschutz, Koalitions- sowie Tarifrechte der Arbeitnehmer, Wahrung des Privateigentums und Maßnahmen zugunsten des Mittelstandes. Sie verlangten einen starken Staat mit Wehrpflicht, die Beseitigung aller fremden Kontrollen und die Revision des Versailler Vertrages.
- Quote paper
- Balnak Deniz (Author), 2000, Die Parteien der Weimarer Republik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102612