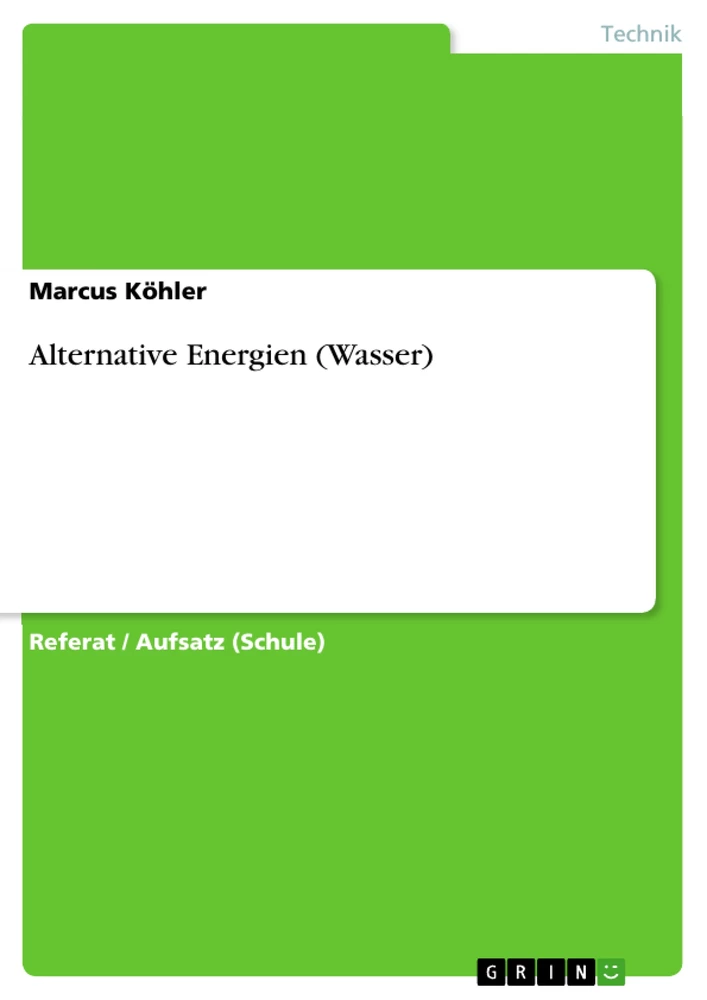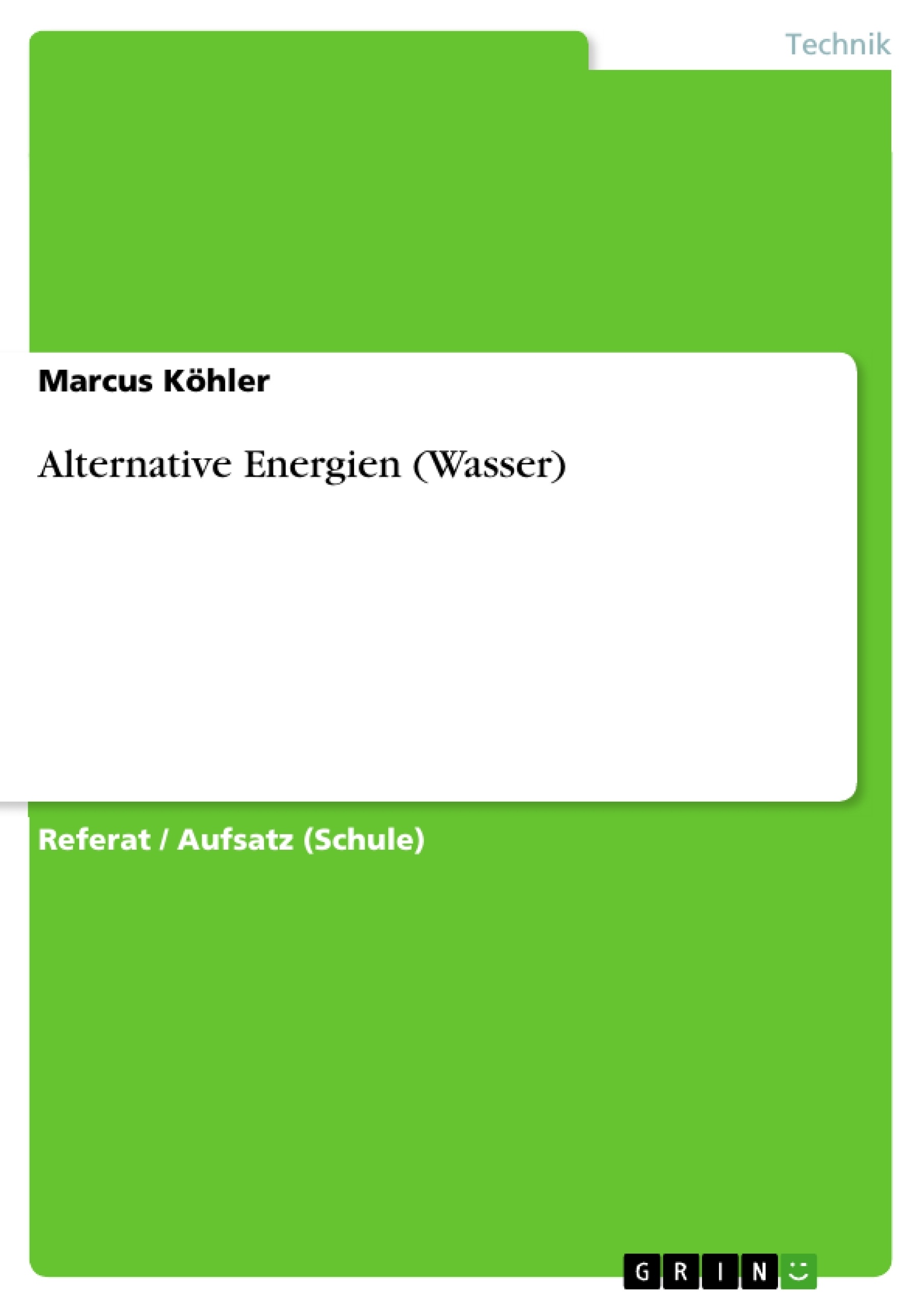Gliederung:
1. Talsperrenkraftwerke
2. Vorschlag: Energienutzung im Grönlandeis
3. Strömungskraftwerke
4. Gezeitenkraftwerke
5. Zukunftsvision: Wellenkraftwerke
6. Quellenverzeichnis
1. Talsperrenkraftwerke
Diese Kraftwerke nutzen das Gefälle des Flusses. Die Staumauer staut das Wasser auf. Durch glatte Wände und durch niedrige Fließgeschwindigkeiten geht wenig Energie bis zur Turbine verloren. Ein Netz, das am Anfang des Kanals befestigt ist, hält grobes Geröll und Geäst auf. Kurz vor der Turbine befindet sich noch ein feineres Netz. Die Turbine wandelt die kinetische Energie des Wasser in eine Drehenergie um, die nach Übersetzung im Getriebe den Generator antreibt. Dieser setzt die Drehenergie in elektrische Energie um. Das Wasser wird dann wieder in den Fluß geleitet.
Dieses Wasserkraftwerk ist eine saubere Energiequelle. Sie hilft die Umwelt von negativen Schadstoffreisetzungen zu entlasten. Die Talsperrenkraftwerke greifen aber in das ökologische Gleichgewicht von Seen, Flüssen und deren Umgebung ein. Außerdem besteht die Gefahr der Überflutung durch Dammbruch.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Vereinfachter Aufbau eines Talsperrenkraftwerkes
2. Vorschlag: Energienutzung im Grönlandeis
Wasserkraftwerke im Grönlandeis funktionieren wie die Talsperrenkraftwerke. Das Eismassiv staut das Schmelzwasser auf. Die Gletscherkraftwerke können nur im Sommer in Betrieb genommen werden. Dann ist es so warm, das die Sonne das Eis zum Schmelzen bringt. Die Errichtung der Anlagen beschränkt sich z. B. in Grönland auf den südlichsten Teil, da sich nur an Randgebieten des Gletschers Schmelzwasser bildet.
Dieses Projekt kann aber nicht verwirklicht werden, weil zu viele Fragen nicht beantwortet werden können z. B. über die Schmelzwassermenge, dessen Fließwegen usw..
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Schema einer Gletscher-Kraftwerksanlage
3. Strömungskraftwerke
Eine Nutzung für elektrische Energie kann mit Hilfe von Turbinen ermöglicht werden, die durch Strömungen der Flüsse oder Meere betrieben werden. Bei einem Energieentzug von max. 59% führt es zu einer Verzögerung der Strömung auf ein Drittel, dadurch wird sich die Strömung verbreiten. Um das zu Vermeiden muß dieser Entzug wesentlich niedriger als 50% liegen, so kann nur wenig elektrische Energie entstehen, d. h. der Aufwand und die dabei entstehenden Kosten würden sich nicht lohnen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Beispiel für ein Strömungskraftwerk
4. Gezeitenkraftwerke
Eine Nutzung der Gezeitenkraftwerke ist nur in Küstennähe möglich, weil dort die Voraussetzungen für die Errichtung der technischen und baulichen Anlagen bestehen. Außerdem ist der Tidenhub (der Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser) nur hier nutzbar. Auf offenem Meer liegt dieser bei 1m, in Küstenregionen kann er durch Resonanzeffekte, Buchten, Fjorde und deren Trichterwirkung bei 20m und sogar noch höher liegen. Der Mindestwert bei Gezeitenkraftwerke ist 3m, jedoch muß er für eine wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit der gewonnenen Energie bei 5-6m liegen. Das technische Grundprinzip dieser Kraftwerke entspricht dem der Flutmühlen. Ausgenutzt werden immer zwei Becken mit unterschiedlichen Wasserständen. Die einfachste Art dieser Variante ist, wenn eines davon das Meer ist. Günstig sind natürliche Fjorde Buchten die für den Beckenbau ausgenutzt werden können. In der einfachsten Variante wird ein Becken angelegt, das die Flut mit Wasser füllt. Das Stauwasser fließt bei Ebbe wieder ins Meer zurück und treibt somit die Turbinen- Generatorsysteme an. Also ist nur bei Ebbe Energieabgabe. Werden Ebbe und Flut ausgenutzt, ist der Gewinn 20%. Das bei Flut ins Becken strömende Wasser und das bei Ebbe zurückfließende Wasser treiben die Turbinen an. Eine andere Möglichkeit der Energiegewinnung lautet: Die Flutwelle füllt als erstes beide Becken, dabei wird über reversible (in beiden Strömungsrichtungen arbeitende) Turbinen Strom erzeugt. Bei Ebbe entleeren sich die Becken, die als Pumpspeicherwerk während der Ebbe arbeiten, bis die nächste Flut kommt.
Das Hauptproblem sind die hohen Baukosten der Gezeitenkraftwerke. Andere Probleme sind
z. B. die Versandungen in den Becken und die Korrosion der technischen Anlagen durch das Meerwasser. Vorteilhaft sind dagegen die geringen Unterhaltungskosten und daß keine schädlichen Abfälle produziert werden. Die Gezeitenkraftwerke könnten in
Entwicklungsländern, aber auch autonome Regionen wie Inseln oder Halbinseln Bedeutung finden.
5. Zukunftsvision: Wellenkraftwerke
Eine der vielen Varianten der Wellenkraftwerke ist, daß die Meereswellen so ausgenutzt werden, wie die Flutwellen der Gezeiten, um Staubecken zu füllen. Gewöhnliche Wellenhöhen reichen dafür aber nicht aus. Eine andere Möglichkeit ist die Wellenenergie zu konzentrieren. In konstanten Abständen werden Betonblocks im Meer vor der Küste verankert. Es kommt zu Interferenzen, bei denen sich Wellen auslöschen oder verstärken. Diese verstärkten Wellen erreichen Amplituden bis zu 30m. Sie können über einen Trichter in das Staubecken einlaufen.
Die Idee der Wellenflöße stammte von Sir Cockerell. Diese großen, gekoppelten Pontons werden durch Wellenberge und -täler rhythmisch bewegt. Über Gestänge und Getriebe können diese Bewegungen an den Kopplungsstellen übertragen werden z. B. auf hydraulische Kolben- Zylinder-Systeme, die wie Pumpen einen Motor antreiben, und diese wiederum einen Wechselstromgenerator. Versuchsanlagen mit 3m*1,5m Fläche ergaben sogar in ruhigen Gewässern gute Ergebnisse.
Zu den mechanischen Systemen gehören z. B. Schaufelräder, welche die kinetische Energie der Horizontalbewegung der Wellen benutzen. Anfangs sind sie mit ihren Zapfansatz der Wellenrichtung entgegengesetzt. Die Wellen drehen diese Schaufelräder in ihrer Bewegungsrichtung. Nach der Welle gehen sie wieder in ihrer Ausgangslage zurück. Die entstehende Taumel- oder Pendelbewegung kann auf eine Hochdrucksanlage übertragen werden. Dazu braucht man eine Schaufel, die einen Hohlraum und eine Innenkamm hat, der auf einen mit Außenkamm ausgestatteten Innenzylinder wirkt. Der von einer Pumpe erzeugte Wasserfluß betreibt eine Turbine. Eine Gleichmäßigkeit dieses Flusses kann durch eine gleichrichtende Spezialpumpe erfolgen oder durch Kopplung vieler solcher Schaufelradsysteme. Der Wirkungsgrade dieser Umwandlung liegen bei 70%.
Eine rein mechanisch wirkende Version benutzt schwimmende, stabilisierte Zylinder, die mit den Wellengängen eine vertikale Pendelbewegung ausführen. Diese überträgt sich auf hydraulische Pumpen, welche die Turbinen antreiben.
Die potentielle Energie, die unter Wasser durch Druckschwankungen entsteht, wird von pneumatisch arbeitenden Systemen ausgenutzt. Die Druckschwankungen arbeiten auf ein Arbeitsmedium in pneumatischen Druckkammern, das die langsamen Druckschwankungen des Seegangs auf hochtourige Luftturbinen überträgt. Aber der optimale Einsatzbereich und der Wirkungsgrad sind noch nicht angebbar.
Günstige Bedingungen sind beispielsweise in Japan und Norwegen. Diese gehören zu den wenigen Ländern, die sich intensiv mit dieser Technik befassen. Die Investitions- und Betriebskosten der Wellenkraftwerke dürften sehr hoch sein. Umweltbelastungen treten selten auf, da die Verringerung der Brandungswellen keine negativen Folgen haben. Beachtet werden müssen die Behinderungen für die Schiffahrt. Diese Kraftwerke sind schon als "Minikraftwerke" für Bojen u. ä. in geraumer Zeit in Einsatz. In einigen Ländern gibt es Versuchsanlagen zum Studium von Grundsatzfragen.
6.Quellenverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was sind Talsperrenkraftwerke und wie funktionieren sie?
Talsperrenkraftwerke nutzen das Gefälle eines Flusses. Eine Staumauer staut das Wasser auf, welches dann durch Turbinen geleitet wird. Die Turbinen wandeln die kinetische Energie des Wassers in Drehenergie um, die einen Generator antreibt, um elektrische Energie zu erzeugen. Das Wasser wird danach wieder in den Fluss geleitet.
Welche Vor- und Nachteile haben Talsperrenkraftwerke?
Talsperrenkraftwerke sind eine saubere Energiequelle, die die Umwelt von Schadstoffen entlasten kann. Allerdings greifen sie in das ökologische Gleichgewicht von Seen, Flüssen und deren Umgebung ein. Außerdem besteht die Gefahr der Überflutung bei einem Dammbruch.
Was ist der Vorschlag zur Energienutzung im Grönlandeis?
Der Vorschlag sieht vor, Wasserkraftwerke im Grönlandeis zu betreiben, die wie Talsperrenkraftwerke funktionieren. Das Schmelzwasser des Eises würde aufgestaut und zur Stromerzeugung genutzt. Dies wäre jedoch nur im Sommer möglich, wenn das Eis schmilzt.
Warum kann das Projekt der Energienutzung im Grönlandeis nicht verwirklicht werden?
Das Projekt kann derzeit nicht verwirklicht werden, da zu viele Fragen unbeantwortet sind, beispielsweise über die Schmelzwassermenge und deren Fließwege.
Wie funktionieren Strömungskraftwerke?
Strömungskraftwerke nutzen die Strömung von Flüssen oder Meeren, um Turbinen anzutreiben und elektrische Energie zu erzeugen. Allerdings ist der Energieentzug begrenzt, um die Strömung nicht zu stark zu beeinträchtigen, was die Wirtschaftlichkeit in Frage stellt.
Wo ist die Nutzung von Gezeitenkraftwerken möglich und wie funktionieren sie?
Gezeitenkraftwerke sind nur in Küstennähe möglich, wo ein ausreichender Tidenhub (Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser) vorhanden ist. Sie nutzen Becken mit unterschiedlichen Wasserständen, um das Wasser beim Gezeitenwechsel durch Turbinen zu leiten und Strom zu erzeugen.
Was sind die Probleme bei Gezeitenkraftwerken?
Hauptprobleme sind die hohen Baukosten, Versandungen in den Becken und die Korrosion der technischen Anlagen durch Meerwasser.
Was sind Wellenkraftwerke und welche Varianten gibt es?
Wellenkraftwerke nutzen die Energie der Meereswellen zur Stromerzeugung. Es gibt verschiedene Varianten, z. B. die Nutzung von Wellen, um Staubecken zu füllen, die Konzentration von Wellenenergie durch Betonblocks oder die Verwendung von Wellenflößen, die durch Wellenbewegungen hydraulische Systeme antreiben.
Welche Vorteile bieten Wellenkraftwerke?
Wellenkraftwerke verursachen selten Umweltbelastungen, da die Verringerung der Brandungswellen keine negativen Folgen hat. Allerdings müssen Behinderungen für die Schifffahrt beachtet werden.
Wo liegen die günstigen Bedingungen für Wellenkraftwerke?
Günstige Bedingungen für Wellenkraftwerke sind beispielsweise in Japan und Norwegen.
What is a summary of the document?
The document details several methods to exploit the natural energy of water. It contains sections for hydroelectric dams, energy harnessing in Greenland's ice, stream plants, tidal plants, and wave plants. The section for Greenland ice is simply a propsal, not an implemented system.
- Quote paper
- Marcus Köhler (Author), 2001, Alternative Energien (Wasser), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102607