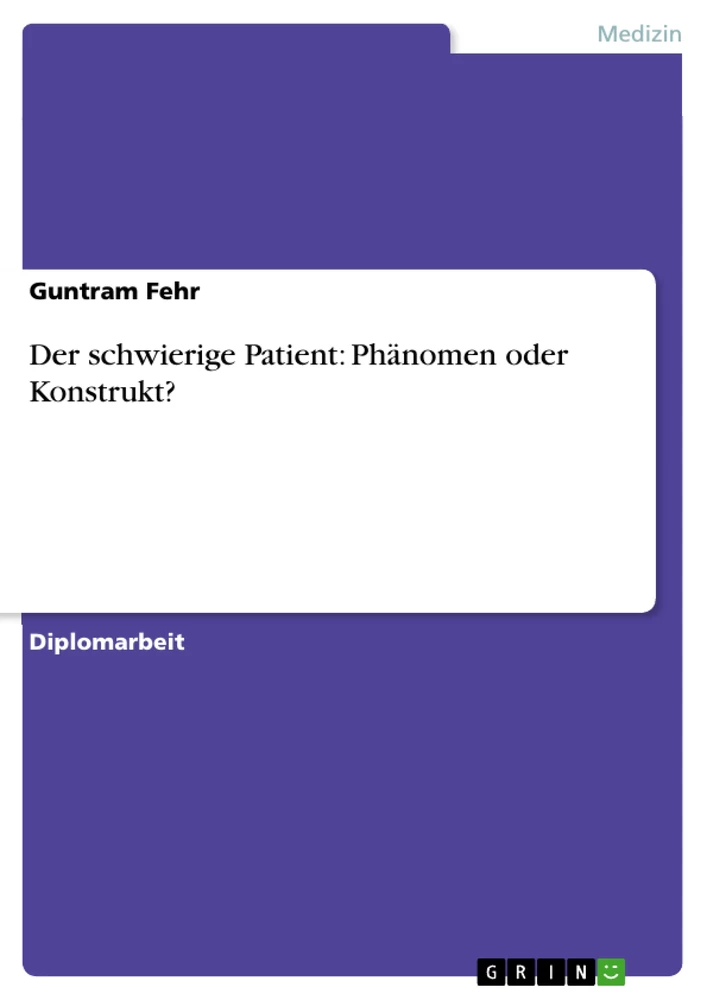INHALTSVERZEICHNIS
1. ZUSAMMENFASSUNG
2. EINFÜHRUNG
2.1. Prospekt
2.2. Motivation
2.3. Ziel und Absicht
2.4. Forschungsfragen
3. PHILOSOPHISCHER HINTERGRUND
3.1. Einführung
3.2. Radikaler Konstruktivismus
3.3. Radikaler Konstruktivismus und Psychiatrie
3.4. Radikaler Konstruktivismus in der Forschung
4. METHODOLOGIE
4.1. Phänomenologie
4.2. Qualitativ – induktiver Ansatz
4.3. Ethische Kriterien
5. DATENERHEBUNG
5.1. Auswahl der Probanden
5.2. Charakteristik der Probanden
5.3. Setting und Ablauf der Interviews
5.4. Methodik der Interviews
6. DATENANALYSE
6.1. Transkription der Interviews
6.2. Inhaltsanalyse
6.3. Kategorienbildungsprozeß
7. ERGEBNISSE DER FORSCHUNG
7.1. Überblick der gebildeten Kategorien
7.2. Beschreibende Kategorien mit Interviewbeispielen
8. DISKUSSION UND INTERPRETATION DER ERGEBNISSE
8.1. Diskussion der einzelnen Kategorien
8.2. Wechselwirkungen der gebildeten Kategorien
8.3. Illustration der Interpretation und Diskussion durch graphische Modelle
9. SCHLUßFOLGERUNG
9.1. Zusammenfassung der Befunde
9.2. Kritik und Grenzen der Arbeit
9.3. Empfehlungen
10. PERSÖNLICHE SCHLUßBEMERKUNG
10.1. Reflexion
10.2. Danksagung
11. LITERATURVERZEICHNIS
11.1. Bibliographie
11.2. Weiterführende Literatur
12. TABELLEN- UND ABBILDUNGSVERZEICHNIS
13. ANHANG
1. Zusammenfassung
Die vorliegende Forschungsarbeit ist eine qualitative Studie, welche phänomenologisch Daten erhebt.
In einer psychiatrischen Klinik werden zehn diplomierte Pflegepersonen zum „schwierigen Patienten“ befragt. Die Absicht ist, Datenmaterial über die Pflegepersonen zu erheben.
Die erhaltenen Aussagen werden dazu verwendet, aus der Sicht psychiatrischer Pflegepersonen den Begriff selbst, dessen Verwendung im Pflegealltag wie auch das Erleben vom „schwierigen Patienten“ zu erforschen.
Die Erkenntnistheorie des „Radikalen Konstruktivismus“ ist durch den ganzen Forschungsprozeß bestimmend. Die Grundannahme der Theorie ist, daß Wahrnehmung von Phänomenen ein konstruktiver Prozeß des Wahrnehmenden ist, so daß keine Aussagen über eine „wirkliche Wirklichkeit“ möglich sind. Für die Psychiatrie bedeutet das, daß die Annahme, ein Patient habe eine „falsche“, eine pathologische Realität, nicht haltbar und rechtfertigbar ist.
Methodologisch wird die Phänomenologie angewandt. Die Forschung ist induktiv angelegt.
Aus den transkribierten Daten werden mit der Inhaltsanalyse neun Kategorien aus pflegerischer Perspektive gebildet. Dies sind: „Kommunikation“, „emotionale Involviertheit“, „zielorientiertes Arbeiten“, „fehlende Herausforderung“, „Konflikt“,
„Beziehung“, „Behandlung“, „System“ und „Gewalt“.
In der Interpretation und Diskussion der Kategorien werden im wesentlichen Kommunikations- und Interaktionstheorien, systemtheoretische Ansätze sowie der Radikale Konstruktivismus herangezogen. Die gebildeten Kategorien werden darauffolgend in ihren Wechselwirkungen dargestellt, anschließend illustrieren graphische Modelle die Aussagen. Die Komplexität von menschlicher Kommunikation, dem Arbeitsmittel von psychiatrischen Pflegepersonen, wird durch diese Verknüpfung mit den unterschiedlichen Aspekten des Wahrnehmungsprozesses durchleuchtet.
Obwohl die Anzahl der interviewten Pflegepersonen aus den Ergebnissen keine verallgemeinbaren Aussagen erlaubt, zeigen die Resultate, daß der „schwierige Patient“ ein phänomenologisch faßbares, im Wahrnehmungsprozeß jedoch konstruiertes Gegenüber ist. Die abschließenden Empfehlungen richten sich an Pflegende, die ihren alltagsphilosophischen Ansatz hinterfragen möchten, die Verlangen auf eine neue Perspektive der Sicht des „schwierigen Patienten“ verspüren.
2. Einführung
2.1. Prospekt
Die vorliegende Studie ist die Diplomarbeit zur Weiterbildung HöFa II, SBK1, 1996 bis 1998.
- Den philosophischen Hintergrund der Forschung bildet die Erkenntnistheorie des
„Radikalen Konstruktivismus“2. Diese Philosophie, welche die Erkenntnisfähigkeit einer wirklichen Welt verneint, ist im gesamten Forschungsprozeß sehr bestimmend und richtungsweisend.
- Aufgrund dieser Haltung folgt, daß der heute professionelle Standpunkt gegenüber psychiatrischen Patienten, daß ihre Wirklichkeit falsch sei, nicht haltbar ist, da kein Mensch die reale Welt zu erfassen imstande ist.
- Die Studie ist eine induktive, qualitative Forschung.
- Die Phänomenologie hat keine philosophische Bedeutung für die Studie, sondern wird als qualitative Technik, im Sinne angewandter Phänomenologie verwendet.
- Die Untersuchung wurde in einer psychiatrischen Klinik3 in der Schweiz durchgeführt. Diese hat 150 Betten und führt Aufnahme sowie Therapie aller psychiatrischen Krankheitsbilder durch.
- Das Interesse der Arbeit ist, zu erforschen, wo psychiatrisches Pflegepersonal die Schwierigkeit in der pflegerischen Arbeit mit dem Patienten hauptsächlich ansiedelt: beim Patienten und/oder im System und/oder bei sich selbst.
- Der Untersuchungsgegenstand ist also nicht der „schwierige Patient“.
2.2. Motivation
„Das ist aber wirklich ein schwieriger Patient, den ihr da habt.“
„Es ist einer angemeldet, der soll ein besonders schwieriger Patient sein.“
„Mit dem komme ich nicht weiter
... er ist ein zu schwieriger Patient.“
Solche und ähnliche Äußerungen kennt man in der Psychiatrie aus dem Pflegealltag. Sowohl als Empfänger wie auch als Sender.
In der psychiatrischen Pflege, wie im gesamten Gesundheitsversorgungssystem, sind zwei Faktoren zunehmend bestimmend in der Arbeit:
1. Der Kostendruck, welcher personelle Aufstockungen verunmöglicht und Einsparungen in der Therapie verlangt.
2. Die erhöhten Anforderungen an die Rehabilitation durch die sich jährlich steigernden Aufnahmezahlen bei kürzerer Aufenthaltsdauer der Patienten.
Der Leistungsdruck auf die psychiatrisch Pflegenden steigert sich also laufend. Schweitzer und Schumacher4 orten eine Verlagerung der chronifizierenden Verhaltensweisen aus der Psychiatrie in die Sozialpsychiatrie. Dies hat eine Verschiebung hin zur Behandlung von durchwegs akut Kranken in der Psychiatrie zur Folge, was die Praxiserfahrung des Autors bestätigt.
Im Psychiatriearbeitsalltag werden Schwierigkeiten in der direkten Arbeit mit dem Patienten oft personifiziert im Begriff „der schwierige Patient“.
Unklar ist, ob mit diesem Alltagsbegriff wirklich der Patient als Person gemeint ist. Wird diese Bezeichnung generell dazu verwendet, Schwierigkeiten verbal auszudrücken, über die Schwierigkeiten zu kommunizieren?
Dem Autor ist wesentlich: Wird der psychisch Kranke von Pflegenden als Problemträger, als der „schwierige Patient“ erlebt und definiert? - oder wird er nicht vielmehr im oberflächlichen Sprachgebrauch als Problemträger bei Schwierigkeiten personifiziert?
2.3. Ziel und Absicht
Die Untersuchung beabsichtigt, mehr Klarheit über die Schwierigkeiten von psychiatrischem Pflegepersonal im Arbeitsalltag zu gewinnen.
Ursachen sollen benannt werden, welche für psychiatrisches Pflegepersonals typisch für das Erleben von Schwierigkeiten mit psychisch Kranken sind.
Die Forschung zielt auf folgendes:
- Schwierigkeiten in der Arbeit mit Patienten können durch das psychiatrische Pflegepersonal besser reflektiert werden.
- Die sprachliche Verwendung des Begriffes „schwieriger Patient“ wird hinterfragt.
- Ursachen werden erforscht und grundlegende Muster im Erleben des schwierigen Patienten werden aus der Sicht des psychiatrischen Pflegepersonals beleuchtet.
- Die Bedeutung des Begriffs „schwieriger Patient“ wird aus der Perspektive des psychiatrischen Pflegepersonals erforscht.
- Definitionen des psychiatrischen Pflegepersonals zum Begriff „schwieriger Patient“ werden erhoben.
2.4. Forschungsfragen
1. Wie definiert psychiatrisches Pflegepersonal den Begriff „schwieriger Patient“?
2. Welche Bedeutung hat der Begriff für psychiatrisches Pflegepersonal?
3. Wie erlebt psychiatrisches Pflegepersonal den „schwierigen Patienten“?
3. Philosophischer Hintergrund
Die Theorie bestimmt, was wir erkennen können
A. Einstein
3.1. Einführung
Mit Konstruktivismus werden allgemein Richtungen bezeichnet, die den Begriff der Konstruktion in den Mittelpunkt ihrer beabsichtigten Leistungen stellen.
Kunst, Mathematik, Wissenschaftstheorie und Philosophie benützen diesen Begriff, wenn sie Strömungen bezeichnen, welche sich mit Aufbau und Zusammenfügen beschäftigen.
Der Mathematiker und Philosoph B. Russell war bestrebt, die gesamte geistige und körperliche Wirklichkeit aus Sinnesdaten logisch zu konstruieren5. Noch 1946 schrieb er in seiner Philosophie des Abendlandes: Subjektiv glaubt jeder Philosoph sich mit der Erforschung von etwas zu befassen, das sich als „Wahrheit“ bezeichnen läßt. (... ) Kein Mensch würde sich mit Philosophie abgeben, wenn er ernstlich glaubte, die ganze Philosophie sei nichts anderes als der Ausdruck irrationaler Voreingenommenheit6 .
Der Konstruktivist Lorenzen7 propagierte, daß (nur) die Sprache nicht der Wirklichkeit
entspreche. Um 1950 war dies ein revolutionärer Ansatz.
Mit diesen klassischen, ja antiken Dogmen der Philosophie bricht der Radikale Konstruktivismus eben radikal. Denn er negiert die Möglichkeit, eine Wirklichkeit außerhalb von sich selbst zu erfassen. Es gibt für den Menschen keine Erfahrung der realen Welt.
Für die vorliegende Arbeit ist folgende Konsequenz dieser Prämisse relevant:
Wenn ich keine Wirklichkeit außerhalb von mir erkennen kann, ist es mir auch unmöglich, anderen Menschen eine falsche Wirklichkeit zu unterstellen.
Oder, im Kontext der Psychiatrie und der psychiatrischen Pflege ausgedrückt:
Einem Patienten eine falsche Auffassung der Realität zu diagnostizieren, ist in sich falsch und ausgeschlossen.
3.2. Radikaler Konstruktivismus
Der Radikale Konstruktivismus ist teilweise mit der Philosophie der Solipsisten8 vergleichbar. Diese vertreten die Auffassung, daß alleine ich und meine Bewußtseinszustände existieren, oder daß ich und meine Bewußtseinszustände die einzigen Größen sind, die wirklich erkannt werden können9. Die Erkenntnis der Wirklichkeit wird auf Sinneseindrücke oder Bewußtseinsinhalte reduziert, die nur die einzelne Person haben kann.
Die Hauptfrage, die der Radikale Konstruktivismus stellt und zu beantworten versucht, wurde schon 1710 von Giambattista Vico vorbereitet :
Ebenso wie die Wahrheit Gottes das ist, was Gott erkennt, (...) ist die menschliche Wahrheit das, was der Mensch erkennt, indem er es handelnd aufbaut und durch sein Handeln formt. Darum ist Wissenschaft Kenntnis der Entstehung, der Art und Weise, wie die Dinge hergestellt wurden.10
Vico formulierte damit den erkenntnistheoretischen Grundsatz, daß der Mensch nur das erkennt, was er selbst geschaffen hat. 11
Die Bezeichnung Radikaler Konstruktivismus ist erst in jüngerer Zeit entstanden. Sie bezieht sich nicht auf die konstruktive Methode zur Erklärung der Welt sondern erfolgt durch Beobachtung 12 . Wir erfinden die Welt, so wie sie ist. Die Wirklichkeit wird als unsere Konstruktion definiert: Wir erzeugen buchstäblich die Welt, in der wir leben, indem wir sie leben,13 schreibt Maturana, und von Foerster hält fest: Die Umwelt, so wie wir sie wahrnehmen, ist unsere Erfindung. 14
Riedl vertritt, daß jedes System – organisch, psychisch oder sozial – seine Umwelt ausschließlich daran „erkennt“, daß es Konstruktionen für sich entwirft, die in die systemimmanenten Strukturen eingepaßt werden. Nur so ist erkennen möglich und es gibt keine erkennbare Realität außerhalb der Konstruktion des erkennenden Systems. 15
In der Neurobiologie wird diese Meinung dadurch untermauert, daß Sinneszellen nur die Intensität codieren, aber nicht die Natur der Erregungsursache. 16
Die Neurobiologen Maturana und Varela17 kreierten den Begriff der Autopoiese: Dies ist ein System, das zirkulär die Komponenten produziert, aus denen es besteht, das sich also über die Herstellung seiner Bestandteile selbst herstellt und erhält.18
Lebende Systeme werden von Hejl als selbsterhaltende Verknüpfungen selbstorganisierender oder selbsterzeugender Prozesse19 erklärt.
Menschen werden demzufolge in der Art und Weise, wie sie den Nutzen einer Einstellung oder eines Verhaltens wahrnehmen oder bewerten, von Bildern und Vorstellungen über die Welt – eben ihren Konstrukten – geleitet, die ihr Handeln bestimmen.
3.3. Radikaler Konstruktivismus und Psychiatrie
Die Begriffe, mit denen wir die Welt beobachten, ordnen und beschreiben, sind Konstrukte; also sind auch Klassifikationssysteme wie Gesundheit, Krankheit und Pflege konstruiert. Sie sind Erklärungsgrundsätze, die wir konstruiert oder als Überlieferung übernommen haben.
So hat auch die Psychiatrie entsprechend den von ihr angenommenen Notwendigkeiten Schizophrenie, Depression, Manie usw. geschaffen.
Keine Klassifikation ist besser oder schlechter als eine andere, höchstens für eine Sache geeignet oder nicht.
Laut Watzlawick20 ist die Psychiatrie innerhalb des Gesundheitssystems dahingehend
jedoch einzigartig, daß sie den Patienten die Realität ihrer Wirklichkeit abspricht.
Von Foerster drückt dies provokativ und bildlich wie folgt aus:
Unter den Blinden kommt der Einäugige ins Irrenhaus, denn er sieht mehr als die anderen 21 .
Das heißt, die Werte werden anhand der Abweichung von der Norm bestimmt, ohne andere Grundlagen.
D. Rosenhan veröffentlichte 1973 folgende Studie, welche Watzlawick beschreibt22:
Er selbst und mehrere Mitarbeiter ließen sich mit dem Symptom, daß sie dumpfe Stimmen hörten und eine Behandlung wünschten, freiwillig in verschiedene nordamerikanischen Nervenkliniken aufnehmen.
Sofort nach der Aufnahme gaben sie an, nun keine Stimmen mehr zu hören und verhielten sich in einer Weise, die außerhalb der Klinik als normal gegolten hätte. Die Dauer ihrer „Behandlung“ schwankte von 7 bis 52 Tagen.
Alle wurden mit der Diagnose Schizophrenie in Remmission entlassen.
Watzlawick schließt daraus: Statt sich an den beobachtbaren Tatsachen zu orientieren, erschuf die Diagnose also eine Wirklichkeit (...), die dann ihrerseits alle klinischen Maßnahmen notwendig machte und rechtfertigte23 .
Im Buch Die erfundene Wirklichkeit 24 folgert Watzlawick:
1. Die Diagnose erschafft den Zustand;
2. Der Zustand macht das Bestehen der Institution nötig, in denen er behandelt werden kann;
3. Das Milieu der Institution erzeugt eben jene Hilflosigkeit und Depersonalisation des Patienten, die rückbezüglich die Richtigkeit der Diagnose bestätigt.
Das beschriebene Geschehen der Studie wird zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, die schließlich auch der Patient glaubt und nach der er sein Leben einrichtet. Die Erkenntnisse des Radikalen Konstruktivismus regen an, für die Pflege Grundlagen zu entwickeln, in denen sich psychisch Kranke besser erkennen und finden können.
Die zunehmend – aus verschiedensten Gründen – favorisierte Entwicklung von Pflegediagnosen versucht hier, gegenüber der medizinischen Diagnostik, welche sich im naturwissenschaftlichen Ansatz allein auf objektivierbare Daten stützt, die Reaktionen auf Probleme klinisch zu beurteilen.25 Aus radikalkonstruktivistischer Sicht ist dies ein erster positiver Ansatz.
Die individuelle Erfahrungswelt der Patienten hat dadurch einen höheren Stellenwert als der „objektive“ Versuch, eine medizinischen Diagnose quantitativ zu verifizieren.
3.4. Radikaler Konstruktivismus in der Forschung
Der Neurobiologe Maturana weist in seiner Erkenntnistheorie darauf hin, daß Forschung lediglich Beschreibungen von Natur – nicht objektive Feststellungen – und Erklärungsvorschläge – nicht die Gesetze der Realität – erbringen kann.26
Ein Phänomen ist für Maturana das, was mir vorkommt 27 ; im selben Buch auf Seite 31
schreibt er dazu: Man sieht nur, was man glaubt.
V. Foerster beschreibt den Erkenntnisprozeß folgendermaßen: (...) Kenntnis, Wissen, Verstehen erwächst nicht lediglich aus einem Registrieren von Beobachtung, ohne daß nicht gleichzeitig eine strukturierte Aktivität des Subjekts stattfindet.27
Hejl zitiert Maturana zum wissenschaftlichen Prozeß folgendermaßen:
- a) Beobachtung eines Phänomens, das als zu erklärendes Problem angesehen wird;
- b) Entwicklung einer Hypothese in Form eines deterministischen Systems, das ein Phänomen erzeugen kann, welches mit dem beobachteten Phänomen isomorph ist;
- c) Generierung eines Zustandes oder Prozesses, der entsprechend der vorgelegten Hypothese als vorhergesagtes Phänomen beobachtet werden soll;
- d) Beobachtung des so vorhergesagten Phänomens;28
Versteht man Beobachtung als konstruktiven Prozeß, so ist der wissenschaftliche Prozeß eine Form des Problemlösens.
Erklärungen von psychiatrischem Pflegepersonal, Zuordnungen von Bedeutung sowie Definitionen des „schwierigen Patienten“ sind aus der Perspektive des Radikalen Konstruktivismus Versuche, die Beobachtungen zu strukturieren.
Sie sagen also viel über das Pflegepersonal, über ihre Art zu konstruieren aus, jedoch nichts über den Patienten.
Nach Maturana wollen wir die Erfahrung erklären 29 .
Der umseitige Problemlösungsprozeß tangiert in der vorliegenden Arbeit zwei Ebenen:
Erster Problemlösungsprozeß: Beobachtung von Pflegepersonal € schwieriger Patient:
1. Pflegende nehmen phänomenologisch Erscheinendes wahr auf Grundlage ihrer Erfahrung (anderes ist nicht wahrnehmbar)
2. Sie entwickeln, wiederum auf dieser Erfahrungsgrundlage, eine Hypothese, was ursächlich sein könnte; sie bemühen sich nach Maturana um einen erzeugenden Mechanismus 30
3. Anschließend deduzieren Pflegende Kohärenzen aus den angesprochenen Erfahrungen und leiten davon Prinzipien ab (Pflegediagnose, Verhalten bei ... usw.), welche ihre Reaktion bestimmen
4. Die vorhergesagten und erwarteten Phänomene werden von Pflegenden wahrgenommen
Zweiter Problemlösungsprozeß: Beobachtung Autor der Arbeit € Pflegepersonal
1. Die gemachten Erfahrungen des Autors bestimmen dessen Kommunikationspotential, als Empfänger auch dessen Wahrnehmung; daraus resultiert eine nicht vermeidbare zielgerichtete Haltung in den Interviews
2. Eine Hypothesenbildung erfolgt: Jede Pflegeperson kennt die Bedeutung, die Definition und das Erleben des Phänomens „schwieriger Patient“ und kann darüber kommunizieren
3. Umgrenzen von Bereichen übereinstimmender Erfahrungen und ableiten von Prinzipien, € Bestätigung der Hypothese
4. Beobachtung des so Vorhergesagten; alles kreist um die Erfahrung des Beobachters! 31
Mit diesen zwei Konstrukten im Forschungsprozeß stellt sich die Frage, ob brauchbare Aussagen überhaupt wissenschaftlich erfaßbar sind?
Zur Bilanz des Prozesses schreibt Maturana: Sind die vier Bedingungen gleichzeitig erfüllt, so avancieren alle anerkannten Erzeugungsmechanismen, die bewußt entworfen wurden, um die betreffende Erfahrung im Rahmen der vier Kriterien kohärent zu begründen, zu
„wissenschaftlichen Erklärungen“. 32
Er vertritt also nicht, daß Wissenschaftlichkeit nicht möglich ist, sondern betont die Einschränkungen der vermeintlichen Objektivität.
Ronald Hitzler beschreibt den Forschungsprozeß in den Sozialwissenschaften folgendermaßen: Die Konstruktionen des Sozialwissenschaftlers sind Konstruktionen von Konstruktionen. 33
Weiter unten schreibt er erläuternd: Phänomenologie, die in ihren vielfältigen Verzweigungen eben auch immer wieder dieses Problem der Konstitution des anderen zu klären versucht hat, ist natürlich noch keine verstehende Soziologie. Aber was verstehen sei und wie verstehende Soziologie möglich ist, das ist wohl die epistemologische Grundfrage phänomenologischer Protosoziologie schlechthin.
Mit diesen Annahmen im Blickfeld kann bezweifelt werden, ob ein Verstehen im naturwissenschaftlichen Sinn, also ein Verstehen objektivierbarer Wahrheit der Erkenntnis der Welt, überhaupt möglich ist.
Die angewandte Phänomenologie ist aus der Sicht des Radikalen Konstruktivismus methodisch für die Forschung geeignet, da beide Theorien intersubjektive Erkenntnisse für wahr nehmen.
Beide Theorien verlangen demzufolge aus verschiedenen Gründen einen qualitativen Ansatz im Forschungsprozeß34.
4. Methodologie
4.1. Phänomenologie
Die vom Philosophen Husserl begründete Phänomenologie zielte darauf herauszuarbeiten, was im Bewußtsein an gültigen Strukturen aufweisbar ist 35 . Ob ein Gegenstand tatsächlich existiert oder nicht, ist demzufolge nicht relevant. Das entscheidende ist in allen Fällen die Intentionalität des Bewußtseins (Gerichtetheit) 36 .
Die Phänomenologie in dieser Arbeit hat nicht den Stellenwert einer Philosophie, sondern wird als Forschungsmethodologie angewandt.
Gegenüber dem erkenntnistheoretischen Realismus bestreitet der erkenntnistheoretische Radikale Konstruktivismus die Möglichkeit, mit Wahrnehmungssinnen die Realität so zu erfassen, wie sie wirklich ist.
Kromrey zitiert dazu Meinefeld, der vertritt, daß durch die Erkenntnismöglichkeiten und Grenzen nur gezeigt wird, ob eine Erkenntnis mit der Welt vereinbar ist, ob sie paßt – nicht aber, daß sie wahr ist 37 .
Die vorliegende Studie untersucht die subjektiv erlebte, „phänomenale“ Erfahrungswelt der Probanden hinsichtlich der Forschungsfragen. Die wissenschaftstheoretische Position der Phänomenologie ist hier relevant.
Lamnek schreibt dazu: Die Phänomenologie ist keine einheitliche, klar abgegrenzte Disziplin. Sie reiche von streng philosophischer Phänomenologie (...) bis zur angewandten Phänomenologie in den Geistes- und Sozialwissenschaften 38 .
Die angewandte Phänomenologie beschreibt der Wissenschaftstheoretiker Seiffert folgendermaßen: Phänomenologisch nennen (...) wir eine Methode, die die Lebenswelt des Menschen unmittelbar durch „ganzheitliche“ Interpretation alltäglicher Situationen versteht, und weiter, daß der Phänomenologe selbst an dieser Erfahrungswelt durch seine Alltagserfahrungen teilhat39.
Damit das Wesen eines Gegenstandes zur Geltung kommen kann, wird dieser so objektiv wie möglich beschrieben, befreit von subjektiven, theoretischen und traditionellen Elementen, schreibt Lamnek sinngemäß40.
Nach Liehr und Taft Marcus ist die phänomenologische Methode ein Prozeß, in dessen Verlauf Informationen gesammelt werden, aus denen die Bedeutung menschlicher Erfahrung herausgefiltert wird; als Grundlage dienen intensive Gespräche mit Menschen, die diese Erfahrung durchleben 41 .
Lamnek42 stellt die wissenschaftstheoretischen Schritte angewandter Phänomenologie folgendermaßen als Modell dar.
Abbildung 1: Modell angewandter Phänomenologie
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ziel des ersten Schritts ist eine möglichst vorurteilsfreie Einstellung, schreibt Lamnek weiter und zitiert auf Seite 67 Danner: Der Sinn der Forderung nach Vorurteilsfreiheit liegt in einer kritischen und skeptischen Haltung.
Und weiter unten: Dennoch müssen derart gewonnene phänomenologische Ergebnisse in ihrer möglichen Bedingtheit gesehen werden 43 .
Letzteres bezieht sich auf die vielen interpretativen Schritte des Prozesses in der qualitativen Forschung. Jeder Schritt ist ja interpretativ. Mit der Sicht des Radikalen Konstruktivismus ist jedoch auch eine quantitative Forschung Interpretation.
Wie auch der Radikale Konstruktivismus vertritt, betont der phänomenologische Ansatz die Bedingtheit möglicher Objektivität und die Notwendigkeit fortlaufender Interpretation im Forschungsprozeß.
Die phänomenologische Methode im Forschungsprozeß wird von Lamnek folgendermaßen in vier Schritten dargestellt:
- Alle Elemente und Aspekte eines Untersuchungsgegenstandes werden gesammelt. c Diese Bestandteile des Forschungsobjektes werden daraufhin untersucht, ob sie überflüssig oder veränderlich sind; solche werden ausgeschlossen (Einklammerung).
- Es verbleiben jene Elemente, die dann für die Konstitution des Untersuchungsgegenstandes notwendig und invariant sein müssen.
- Die verbliebenen, charakteristischen Elemente bilden eine Struktur, sie konstituieren das typische, das Wesen des Gegenstandes 44 .
4.2. Qualitativ – induktiver Ansatz
Die angewandte Phänomenologie untersucht subjektive Erfahrungen, also einen qualitativen Aspekt von Wissen.
(Forschungs-) Fragen, die die Erforschung einer menschlichen Erfahrung nahelegen, verlangen einen qualitativen Ansatz 45, schreiben diesbezüglich Liehr/Taft Marcus.
Die vorliegende Arbeit sammelt Daten mittels Interviews, im Gespräch . Der kommunikative – sprich: qualitative – (...) Forscher behandelt das informierende Gesellschaftsmitglied als prinzipiell orientierungs-, deutungs- und theoriemächtiges Subjekt 46, schreibt Schütze.
Der Interviewte ist der Experte.
Der qualitative Forschungsansatz bedingt ein induktives Vorgehen.
Induktion ist ein logischer Gedankenprozeß, in dessen Verlauf aus einzelnen Beobachtungen Verallgemeinerungen abgeleitet werden; induktives Denken geht vom Besonderen hin zum Allgemeinen 47 .
Von der Beobachtung zur Theorie: Wir müssen (...) von der Beobachtungssprache der Protokollaussagen zur theoretischen Sprache der Hypothesen, Gesetze und Theorien übergehen 48 .
Das im induktiven Vorgehen wesentliche Kriterium der intersubjektiven Überprüfbarkeit beschreibt Seiffert folgendermaßen:
Jeder, der ein normales Wahrnehmungsvermögen hat (...) kann von einem anderen Forscher gemachte Beobachtungen und daraufhin abgeleitete Theorien auf ihre Richtigkeit überprüfen 49 .
Die phänomenologische Methodik der qualitativen Forschung bedingt 5 grundsätzliche Prozesse50.
Die für die vorliegende Arbeit wesentlichen Aspekte werden kurz angeführt:
1. Die Identifizierung des Phänomens (Erfahrung steht im Mittelpunkt)
2. Die Strukturierung der Studie
- Forschungsfrage: zielt auf durchlebte Erfahrung
- Forschungsperspektive: bewußt machen € ausklammern persönlicher Vorurteile
- Stichprobenauswahl: haben Erfahrung durchlebt; Geschichte = Dimension der Gegenwart
3. Die Datensammlung: Colaizzi Technik € geringe Interviewanzahl wird transkribiert
4. Die Datenanalyse: verschiedene Techniken möglich (in dieser Arbeit: Qualitative Inhaltsanalyse von Mayring51)
5. Beschreibung der Ergebnisse: in Form einer beschreibenden Synthese
Aus Sicht des Radikalen Konstruktivismus konstruiert jeder mit „normalem Wahrnehmungsvermögen“, was immer das auch sei, eine durch andere nachvollziehbare
„Wirklichkeit“.
Jeder kann davon ausgehen, daß andere Personen, ähnlich ihm selbst, ihre Welt durch Konstruktion zu erfassen versuchen; mit in etwa den gleichen physiologischen, sozialen, und kommunikativen Grundlagen der Konstruktionsfähigkeit.
4.3. Ethische Kriterien
Menschliches Verhalten, das das Leben anderer Menschen beeinflußt, ist ethisches Verhalten.
Francisco J. Varela
In der Forschung ist der Schutz der Versuchsperson oberstes Gebot 52. Dem versucht die vorliegende Arbeit durch nachfolgende Methoden zu entsprechen.
Alle Probanden unterschrieben einen Informed Consent53 in Form einer Einverständniserklärung. Der Informed Consent macht Aussagen zu Zweck und Ablauf der Forschung, geht auf den Persönlichkeitsschutz ein und verweist auf die Rechte der Interviewpartner.
Zum Schluß der Interviews wurde nochmals nachgefragt, ob die Daten weiter verwendet werden dürfen.
Ethische Probleme in qualitativen Studien ergeben sich aufgrund dieser Methodik speziell. Besonderheiten, mögliche Problembereiche in qualitativen Forschungen, sind nach Liehr
& Taft Marcus54 folgende:
Tabelle 1: Ethische Aspekte in qualitativer Forschung
(in der rechten Spalte Beurteilung vorliegende Forschung)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Insbesondere durch die Frage nach dem Erleben der Probanden ist der Aspekt der Vertraulichkeit wesentlich. Deshalb sind die Originalprotokolle auch nicht der Arbeit beigefügt, zum Schutz der Forschungsteilnehmer.
Die drei ethischen Prinzipien des Belmont Reports von 197955 bilden die Grundlage der Bestimmungen für staatlich geförderte Forschungsarbeiten in den USA.
In der rechten Spalte der folgenden Tabelle sind wiederum die entsprechenden Charakteristiken der vorliegenden Arbeit angeführt:
Tabelle 2: Ethische Anforderungen des Belmont Reports
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5. Datenerhebung
5.1. Auswahl der Probanden
Auf jede der 10 Stationen in der Klinik X wurde ein Informationsschreiben geschickt mit der Bitte, daß sich eine Pflegeperson zur beabsichtigten Forschung zur Verfügung stellt.
Das Schreiben zur Probandensuche machte Aussagen zu Rahmen, Absicht und Methodik der Forschung, wie auch zur notwendigen Freiwilligkeit der Probanden.
Auf Aspekte des Personen- und Datenschutzes wurde knapp verwiesen, ebenso auch auf die notwendige Mindestqualifikation der Probanden (mindestens 1 Jahr Diplomabschluß in Psychiatriepflege oder allgemeiner Pflege).
5.2. Charakteristik der Probanden
Der Interviewer war mit allen Probanden bekannt. Das „per Du“ ist in der Klinik X interdisziplinär wie auch unter Pflegenden die übliche Kultur.
Die erhobenen Variablen der Probanden sind die folgenden:
Tabelle 3: Charakteristik der Probanden
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5.3. Setting und Ablauf der Interviews
- Die Probanden erfuhren erst direkt vor den Interviews die Thematik der Forschung
- Die Interviews fanden in einem Büro außerhalb der Stationen der Probanden statt, in nüchterner Umgebung
- Der Informed Consent in Form einer Einverständniserklärung wurde gemeinsam durchgegangen und bei Bedarf erläutert, anschließend vor dem eigentlichen Beginn der Interviews von den Probanden unterschrieben
- Das Tonband wurde erst nach ausdrücklichem Einverständnis der Probanden gestartet und nach Wunsch unterbrochen
- Am Schluß der Interviews wurde nochmals nachgefragt, ob die Daten verwendet werden dürfen oder der jeweilige Proband die Daten gelöscht haben wollte
- Die benötigte Zeitspanne der Interviews war ohne Vor- und Nachbereitung zwischen 15 und 60 Minuten
5.4. Methodik der Interviews
Der Interviewer beschränkt sich laut Lamnek auf nur wenige und nur allgemein festgehaltene Fragen 56 . Ein narratives Interview charakterisiert er57 folgendermaßen:
Der Interviewer verhalte sich anregend und zurückhaltend zugleich, er könne und solle nachfragen. Er praktiziere eine offene Gesprächsführung. Der Befragte werde gebeten zu erzählen, der Detaillierungsgrad sei ihm überlassen. Es existiere eine non-autoritäre, kollegial- freundschaftliche Vertrauensatmosphäre.
Der Interviewstil der vorliegenden Untersuchung ist halbstrukturiert. Das heißt, daß den Anforderungen an das narrative Interview großteils entsprochen wurde. Da die Forschung jedoch auf spezifische Aussagen abzielt, wurden drei Interviewfragen bei jedem Interview gestellt und bei Bedarf wiederholt, plus einer Zusatzfrage in jedem Interview.
Die Fragen lauten:
- Was verstehst du unter einem „schwierigen Patienten?“
- Welche Bedeutung hat für dich der Begriff „schwieriger Patient?“
- Wie erlebst du den „schwierigen Patienten?“ und die Zusatzfrage:
- Wieviele „schwierige Patienten“ habt ihr auf eurer Station?
5.4.1. Pilotinterview
Das erste Interview der Forschung war grob gegliedert in eine Einleitung, die Forschungsfragen selbst und den Ausstieg.
Das Augenmerk des Pilotinterviews war, neben dem eigentlichen Forschungsgegenstand, auch auf das wie der Datensammlung gerichtet.
Ein Konflikt war, daß der Interviewer sich möglichst zurückhaltend zu verhalten hatte58 und
doch an einer möglichst umfassenden und aussagekräftigen Datensammlung interessiert war. Es wurde versucht, auch in den späteren Interviews auftretende Stockungen im Gesprächsfluß mit größtmöglicher Vermeidung von Beeinflussung zu überbrücken, wie nachfolgender Abschnitt darstellt:
Proband:
... bei jemandem, der sich noch ein wenig wehrt oder so, kann ich eher noch ein wenig Freiheit lassen, tue ich nicht so bevormunden. Aber wenn der Alltag einfach so gegeben ist, dann komme ich mir vor, als ob ich einfach ... ja, die Leute bevormunden würde ...
Interviewer:
mhm; und das magst du nicht
Proband:
nein, ich will nicht ... ich habe das selbst auch nicht gerne ...
(das Gespräch stockt) Interviewer:
hast du im Moment konkrete Patienten im Kopf?
Proband:
ja, jetzt sind mir so Pflegefälle in den Kopf gekommen, wo ich die Routine einfach so mache, für und über sie bestimme. Irgendwo maße ich mir das einfach nicht an, daß ich das darf und daß ich das kann ...
Interviewer:
mhm ...
Die Erkenntnisse des Pilotinterviews wurden systematisch erfaßt und ausgewertet. Wesentliches Kriterium war, daß mögliche Stockungen überwunden werden können, ohne daß
die Probanden zu „erwünschten“ Aussagen geleitet wurden. Siehe dazu auch den Abschnitt dieser Arbeit zu Ethik.
5.4.2. Leitraster der Interviews
Folgendes Leitraster wurde in den Interviews, nach Reflexion des Pilotinterviews, vom Autor erstellt und nachfolgend angewandt59:
Tabelle 4: Leitraster der Interviews
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
in der Qualitativen Inhaltsanalyse
Die Tonbandaufnahmen wurden bei Unklarheiten in der Transkription und im weiteren Forschungsprozeß immer wieder herangezogen.
6. Datenanalyse
6.1. Transkription der Interviews
Die auf Tonband aufgezeichneten Interviews wurden wortwörtlich in hochdeutscher Sprache transkribiert. Ausgenommen davon waren spezielle Dialektausdrücke, welche im Dialekt belassen wurden.
Pausen und Stockungen bei den Interviews wurden im Protokoll festgehalten. Auch Lachen, tiefes Einatmen, Husten und Hüsteln wurden transkribiert, wie auch Besonderheiten in der Stimmung (Angespanntsein, Nervosität, Belustigung usw.).
In drei Fällen wurde aufgrund von Unklarheiten der Aussagen (oder auch durch tonale Verständlichkeitsprobleme) bei den Interviewten nachgefragt und gegebenenfalls die Transkription korrigiert.
6.2. Inhaltsanalyse
Zur Analyse der Daten wurde die Inhaltsanalyse von Mayring60 angewandt, die qualitative Technik der Zusammenfassung.
Diese Methode zielt darauf, aus der Fülle erhobener Daten eine überschaubare Menge an Material zu extrahieren, bei größtmöglicher Vermeidung von Verlust inhaltstragenden Datenmaterials. Die Daten werden, vom Ausgangsmaterial ausgehend, in einzelnen Schritten zunehmend auf ein höheres Abstraktionsniveau generiert.
Die nachfolgende, schematische Darstellung des angewandten Ablaufmodells der Qualitativen Inhaltsanalyse61 (von der Transkription an), stellt in der rechten Spalte die erstellten Anweisungen für die vorliegende Arbeit in Anlehnung an die Z-Regeln von Mayring62 dar:
Tabelle 5: Schritte der Inhaltsanalyse
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Mayring empfiehlt, ab dem fünften Schritt der Datenanalyse in Zweifelsfällen theoretisches Wissen zu Hilfe zu nehmen.
Dementsprechend wurde bei Bedarf auf nachstehende Inhalte zurückgegriffen:
- die gestellten Forschungsfragen
- die theoretischen Annahmen des Radikalen Konstruktivismus
- Psychiatrisches Wissen63
Bezüglich des Radikalen Konstruktivismus kamen, wenn die Daten nicht geradlinig weiter abstrahierbar waren, folgende aus der Theorie abgeleitete Leitsätze zur Anwendung:
1. Es gibt keine Wirklichkeit außerhalb von uns selbst, welche wir fähig wären, wahrzunehmen; es bleibt nur die konstruktive Interpretation
2. Demzufolge ist Objektivität das Ergebnis unserer Bemühungen, Sinneseindrücke konstruktivistisch auszuwerten
3. Diese privaten Konstrukte von uns bestimmen unser Bewerten der Welt
4. Unsere Handlungen sind durch diese Werte bestimmt
Das Fach Psychiatrie wurde dazu genutzt, für bestimmte psychiatrische Krankheitsbilder typische, in den Interviews genannte Verhaltensweisen und Eigenschaften, zuzuordnen.
6.3. Kategorienbildungsprozeß
6.3.1. Grundlagen der Kategorienbildung
Aus der Sicht des Radikalen Konstruktivismus ist jede Beobachtung (an welche im Verstehensprozeß eine nachfolgende Analyse gekoppelt ist) die Konstruktion einer vermeintlichen Wirklichkeit.
Somit könnte jede Interviewaussage des Pflegepersonals als interpretative Konstruktion des
„schwierigen Patienten“ ausgelegt werden, wie eben auch die Interpretation der Aussagen durch den Forscher. Wie in der angewandten Phänomenologie festgestellt, interessieren die Bewußtseinsinhalte.
Relevant sind in der vorliegenden Studie folgende mögliche Zuordnungen der Aussagen aus Sicht der Pflegepersonen:
- ob die erlebte, definierte Schwierigkeit in der Arbeit ursächlich bei sich selbst (den Pflegepersonen) lokalisiert wird, oder
- das Problem die Person des Patienten ist, oder
- die Schwierigkeit außerhalb der Pflegenden gesichtet wird im System
Die beiden letzteren Möglichkeiten können als Versuch interpretiert werden, das Problem zu objektivieren.
6.3.2. Das Problem der Differenzierung der Forschungsfragen
Die Fragen nach Definition, Bedeutung und Erleben in den Interviews legen nahe, daß die Antworten dementsprechend erfolgen. Dem war in der vorliegenden Untersuchung nicht so.
Zwei Aspekte kristallisierten sich dahingehend heraus:
1. Präferenzen der interviewten Probanden: Je nach Eigenart der Probanden und Verlauf der Interviews wurden Fragen nach der Definition mit dem Erleben beantwortet und umgekehrt. Fragen nach der Bedeutung wurden mit Definitionen oder mit Aussagen zum Erleben des schwierigen Patienten beantwortet, usw.
2. Abgrenzung der Begriffe „Bedeutung“, „Verstehen“ wie auch „Definition“ im Sprachgebrauch64: Bedeutung ist ein Grundbegriff der Semantik. Er bezeichnet dasjenige, was ein sprachlicher Ausdruck oder ein anderes Zeichen zu verstehen gibt bzw. was derjenige, der den Ausdruck oder das Zeichen gebraucht, damit meint. Wie schon der alltägliche Sprachgebrauch zeigt, ist die Verwendung des Begriffs „Bedeutung“ mehrdeutig und meint etwa Sinnhaftigkeit, Bedeutsamkeit oder Wichtigkeit bestimmter Dinge oder Sachverhalte.
Das heißt weiters, daß der „Sinn“ in Definition und/oder im Erleben ausgedrückt werden kann. Auch in theoretischen Bestimmungsversuchen seines Verhältnisses zu Wirklichkeit, Sprache und Bewußtsein hat der Begriff „Bedeutung“ die verschiedensten Interpretationen erfahren. Als Gegenstand sprachanalytischer Untersuchungen werden zum einen seine semantischen Beziehungen zu andern Begriffen wie „Wahrheit“, „Referenz“, „Verstehen“ (d. h. Erkenntnis von Bedeutung), „Kommunikation“ usw. geklärt; zum andern wird er im Umfeld bewußtseins- und handlungstheoretischer Untersuchungen in seinem Verhältnis zum Beispiel zur „Intentionalität“ (Absicht, Bezug), „Verstehen“ (d. h. Erkenntnis von Absicht), „Gedanke“ und „Meinung“ gesehen. Verstehen ist das Erkennen des Sinns (der Bedeutung) von etwas.
Verstehen betrifft beispielsweise die Bedeutung eines Zeichens, etwa eines Wortes oder geschriebenen Textes (im Gegensatz zum bloßen Hören eines Lautes oder Sehen von Farbflecken); den Zweck einer Handlung (im Gegensatz zum bloßen Wahrnehmen physischer Bewegung); den Sinn einer sozialen Institution.
Eine „Definition“ wiederum ist nach dem Duden das Erklären und Bestimmen eines Begriffes.
Eine inhaltsanalytische Selektionsgrundlage der Kategorien ist dementsprechend:
1. Erleben (auch: Bedeutung; Sinn im Erleben); aus Sicht der Pflegenden € Innenschau
2. Verstehen (auch: Bedeutung; Sinn semantisch); aus Sicht der Pflegenden €
Außenschau
6.3.3. Kontext und Kodiereinheit der Inhaltsanalyse
Folgende, nach Mayring notwendig zu erstellenden Anweisungen, wurden zur Analyse der Daten angewandt65:
- Kontexteinheit:
- Die Kontexteinheit der vorliegenden Analyse ist bis zur zweiten Reduktion im Schritt 5 der einzelne Fall, um Datenverlust zu vermeiden.
Danach werden die Abstraktionen fallübergreifend gebildet.
- Kodiereinheit:
- Jede Aussage der psychiatrischen Pflegepersonen über Definition, Bedeutung, Verstehen und Erleben des schwierigen Patienten und zu Schwierigkeiten in der Arbeit generell, wie auch Aussagen zu möglichen Hilfen und Erleichterungen bei Schwierigkeiten wird aufgenommen.
Letztere wurden berücksichtigt, da positive Aussagen in ihrer Umkehrung auch inhaltlich relevant für die Forschung sind.
7. Ergebnisse der Forschung
7.1. Überblick der gebildeten Kategorien
Die Forschungsfragen selbst sind abstrakt verfasst und werden in den Interviews in direkter Ansprache formuliert. Auch wurden die Begriffe der Forschungsfragen in den Interviews, je nach Verlauf derselben, in der Ausdrucksweise abgewandelt.
Zum Beispiel wurde bei der Frage nach der Definition nachgefragt, was der Begriff für den Probanden heiße, was er darunter verstehe usw.
Tabelle 6: Gebildete Kategorien
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wie definiert psychiatrisches Pflegepersonal den Begriff „schwieriger Patient“ oder:
was verstehst Du darunter?
Welche Bedeutung hat der Begriff des
„schwierigen Patienten" oder:
was gibt er Dir zu verstehen?
Wie erlebt psychiatrisches Pflegepersonal den
„schwierigen Patienten“ oder:
was erlebst Du wie schwierig?
7.2. Beschreibende Kategorien mit Interviewbeispielen
Im nachfolgenden Kategoriensystem werden die einzelnen Aussagen erläuternd (möglichst wenig interpretierend) beschrieben.
Um diese nachvollziehbar zu belegen, ist beispielhaftes Datenmaterial der Interviews in
Kursivschrift fortlaufend angeführt.
7.2.1. 1. Kategorie: Kommunikation
Kommunikationsprobleme im weiteren Sinn werden von psychiatrischem Pflegepersonal als schwierig erlebt. Dies betrifft die verbale wie auch die nonverbale Kommunikation.
Eine Störung in der Kommunikation wird von psychiatrischem Pflegepersonal nicht vorrangig als das Problem des Patienten beschrieben, sondern als eigenes Versagen:
- „das muß man ja können“,
war eine dementsprechende Interviewaussage.
Unklarheiten in der Kommunikation verunsichern; eine psychiatrische Pflegeperson formuliert dies folgendermaßen:
- „ich weiß nicht, versteht er mich nicht oder will er mich nicht verstehen ...“
Eine gut mögliche Kommunikation wird von psychiatrischen Pflegepersonal demgegenüber als erleichternder Faktor der Arbeit erlebt:
- „wenn er weniger Mühe hat, um von der Psychiatrie zu profitieren, er versteht, man kann die Pflegeplanung mit ihm zusammen machen“,
wie auch die Aussage:
- „um so intelligenter, um so einfacher“
auf erleichterte Kommunikation bei Verständnis des Patienten verweist.
Kontaktprobleme, als Folge einer Kommunikationsstörung, werden als schwierig erlebt:
- „ein schwieriger Patient ist für mich sicher einer, (...) wo ich schlecht Zugang finde“
wie auch:
- „wenn ich keinen Kontakt finde, wenn ich nicht reden kann mit ihm“
- „daß es mir schlechter gelingt, auf den Patienten einzugehen, mich einzufühlen und Verständnis zu zeigen“
Informationen über Patienten können problematische Vorurteile bei psychiatrischem Pflegepersonal auslösen:
- „habe ich auch schon erlebt, daß einer, ein Patient, vom Pflegeheim kam, und da hat’s geheißen: das ist ein schwieriger Patient“
- „im Altersheim oder Pflegeheim als schwieriger Patient gestempelt, und kommen dann zu uns“
Vorinformationen werden aber auch geschätzt und als hilfreich empfunden:
- „die Vorinformationen sind schon sehr wichtig, wenn man jemanden kennt“
Auch Kommunikationsprobleme mit Angehörigen werden als schwierig erlebt:
- „war sehr schwierig, auch den Angehörigen verstehen zu geben ...“
- „Also daß sie (die Angehörigen) kommen: wir bringen da einen Patienten, in sechs Wochen soll er wieder genau gleich sein, und wenn das nicht so ist, machen wir etwas falsch“
[...]
1 Höheren Fachschule Stufe II des Schweizer Berufsverbandes der Krankenschwestern und Krankenpfleger
2 „Radikal“ wird auch im weiteren groß geschrieben, da dies die übliche Schreibform dieser philosophischen Haltung ist
3 Im weiteren Klinik X
4 J. Schweitzer; B. Schumacher; Die unendliche und endliche Psychiatrie, 1995
5 Hügli, A. & Lübcke, P.; Philosophielexikon, Diskettenversion
6 Russel, B.; Philosophie des Abendlandes; Seite 794
7 Hügli, A. & Lübcke, P.; Philosophielexikon, Diskettenversion
8 Von lat. solus ipse, ich allein
9 Russel, B.; Philosophie des Abendlandes; Seiten 666, 714, 727
10 Glaserfeld, H.; Wirkung und Ursache; Seite 26 in Watzlawick (Hrsg.); Die erfundene Wirklichkeit
11 Glaserfeld, H.; Wirkung und Ursache; Seite 26; in Watzlawick (Hrsg.); Die erfundene Wirklichkeit
12 Jensen J.; Im Kerngehäuse; Seite 60; in Rusch, G. & Schmidt, S (Hrsg.); Konstruktivismus und Sozialtheorie
13 Maturana, H; Was ist Erkennen; Seite 87
14 Foerster v., H; Konstruieren einer Wirklichkeit; Seite 40; in Watzlawick (Hrsg.): Die erfundene Wirklichkeit
15 Riedl, R; Die Folgen des Ursachendenkens; Seite 72; in Watzlawick (Hrsg.): Die erfundene Wirklichkeit
16 Foerster v., H.; Entdecken oder erfinden, wie läßt sich verstehen verstehen; Seite 59 in Gumin, H. & Schmidt, H. (Hrsg.); Einführung in den Konstruktivismus
17 Varela arbeitet mit Maturana in Chile zusammen
18 Roth, G.; Autopoiese und Kognition; Seite 258; in S. J. Schmidt (Hrsg.): Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus
19 Hejl P. M.; Konstruktion der sozialen Konstruktion; Seite 308; in S. J. Schmidt (Hrsg.): Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus
20 Watzlawick, P.; Wie wirklich ist die Wirklichkeit
21 Foerster v., H.; Entdecken oder Erfinden; Seite 154; in Gumin, H. & Meier, H. (Hrsg.); Einführung in den Konstruktivismus
22 Watzlawick, P; Wirklichkeitsanpassung oder angepaßte Wirklichkeit; Seite 89 ff; in Gumin, H. & Meier, H. (Hrsg.) ; Einführung in den Konstruktivismus
23 Watzlawick, P.; Wirklichkeitsanpassung oder angepaßte Wirklichkeit; Seite 89 ff, in Gumin, H. & Meier, H. (Hrsg.); Einführung in den Konstruktivismus
24 Watzlawick, P. (Hrsg.); Die erfundene Wirklichkeit, Wirkung und Ursache, Seite 65
25 Doenges, M. E. und Mooshause, M. F.; Pflegediagnosen und Maßnahmen; Seite 11: Eine Pflegediagnose ist die klinische Beurteilung der Reaktion von Einzelpersonen, Familien oder sozialen Gemeinschaften auf aktuelle oder potentielle Problem der Gesundheit oder im Lebensprozeß
26 Maturana H.; Was ist erkennen; Seite 16 und 26 Maturana H.; Was ist erkennen, Seite 22
27 von Foerster, H; Entdecken oder erfinden, wie läßt sich verstehen verstehen; Seite 69; in Gumin, H. & Meier, H. (Hrsg.); Einführung in den Konstruktivismus
28 Hejl P. E.; Konstruktion der sozialen Konstruktion: Grundlinien einer konstruktivistischen Sozialtheorie; Seite 304 in Schmidt S. J. (Hrsg.): Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus
29 Maturana, H; Was ist erkennen; Seite 63
30 Maturana, H; Was ist erkennen; Seite 64
31 an selber Stelle
32 ebenda
33 Hitzler, R.; Verstehen: Alltagspraxis und wissenschaftliches Programm; Seite 231 in Jung, T. und Müller- Doohm, S.; Wirklichkeit im Deutungsprozeß
34 Zur angewandten Phänomenologie siehe im nächsten Abschnitt
35 Liehr, P. R. & Taft Marcus, M.T.; Qualitative Forschungsansätze; Seite 294, Kapitel 11 in Lo Biondo- Wood/Haber; Pflegeforschung
36 Hügli, A. & Lübcke, P.; Philosophielexikon, Diskettenversion
37 Kromrey, H.; Empirische Sozialforschung; Seite 25
38 Lamnek, S.; Qualitative Sozialforschung, Bnd. 1, Seite 58
39 Seiffert H.; Einführung in die Wissenschaftstheorie Bnd. 2; Seite 41
40 Lamnek S.; Qualitative Sozialforschung, Bnd. 1; Seite 70
41 Liehr, P. R. & Taft Marcus, T.; Qualitative Forschungsansätze; Seite 317, Kapitel 11 in Lo Biondo- Wood/Haber; Pflegeforschung
42 Lamnek S.; Qualitative Sozialforschung, Bnd. 1; Seite 65
43 Lamnek S.; Qualitative Sozialforschung, Bnd. 1; Seite 65
44 Lamnek S.; Qualitative Sozialforschung, Bnd. 1; Seite 71
45 Liehr, P. R. Taft Marcus, T.; Qualitative Forschungsansätze; Seite 290, Kapitel 11 in Lo Biondo- Wood/Haber; Pflegeforschung
46 Lamnek S.; Qualitative Sozialforschung, Bnd. 1; Seite 23
47 Lo Biondo Wood/Haber; Glossar; Seite 570
48 Seiffert H.; Einführung in die Wissenschaftstheorie, Bnd. 1; Seite 204
49 Seiffert H.; Einführung in die Wissenschaftstheorie, Bnd. 1; Seite 204
50 Liehr, P. R. & Taft Marcus, T.; Qualitative Forschungsansätze; Seiten 294 - 297, Kapitel 11 in Lo Biondo- Wood/Haber; Pflegeforschung
51 Mayring P.; Qualitative Inhaltsanalyse
52 Liehr, P. R. & Taft Marcus, T.; Qualitative Forschungsansätze; Seite 310, Kapitel 11 in Lo Biondo- Wood/Haber; Pflegeforschung
53 Siehe Anhang A
54 Liehr, P. R. & Taft Marcus, T.; Qualitative Forschungsansätze; Seite 310, Kapitel 11 in Lo Biondo- Wood/Haber; Pflegeforschung
55 Jackson, B.S; Rechtliche und ethische Problem; Seite 310, Kapitel 13 in Lo Biondo-Wood/Haber; Pflegeforschung
56 Lamnek S.; Qualitative Sozialforschung Bnd. II; Seite 68
57 Lamnek S.;: Qualitative Sozialforschung Bnd. II; Seite 74
58 Lamnek S.; Qualitative Sozialforschung Bnd. II; Seite 68
59 Mayring, P.; Qualitative Inhaltsanalyse; Seite 24 spricht von der Notwendigkeit eines Kommunikationsmodells
60 Mayring P,; Qualitative Inhaltsanalyse; Seiten 55 ff
61 Mayring P.; Qualitative Inhaltsanalyse; Seite 54, Schema Seite 56
62 Mayring P.; Qualitative Inhaltsanalyse; Seite 54, Z-Regeln Seite 58
63 vorwiegend verwendete psychiatrische Literatur (auch im Interpretationsschritt): Böhm, E.; Verwirrt nicht die Verwirrten // Ciompi, L,; Affektlogik // Dörner, D. & Plog, U.; Irren ist menschlich // Möller, H. J. & Laux, G. & Deister, A.; Psychiatrie // Needham, I.; Pflegeplanung in der Psychiatrie // Scharfetter, C.; Schizophrene Menschen // Vetter, B.; Psychiatrie für Pflegeberufe
64 Annäherungen aus Hügli, A & Lübcke, P; Philosophielexikon, Diskettenversion
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Forschungsarbeit?
Die Forschungsarbeit behandelt das Thema des "schwierigen Patienten" aus der Perspektive von psychiatrischem Pflegepersonal. Sie untersucht, wie Pflegekräfte diesen Begriff definieren, welche Bedeutung er für sie hat und wie sie das Erleben mit solchen Patienten beschreiben.
Welche philosophische Grundlage hat diese Arbeit?
Die Arbeit basiert auf dem philosophischen Hintergrund des Radikalen Konstruktivismus. Dieser Ansatz geht davon aus, dass Menschen die Realität konstruieren und es keine objektive, von uns unabhängige Realität gibt, die wir erkennen können.
Welche methodologischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet einen qualitativen Forschungsansatz, insbesondere die Phänomenologie und eine induktive Methode. Daten werden durch Interviews mit Pflegepersonen erhoben und anschließend mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.
Wie wurden die Daten für die Studie erhoben?
Die Daten wurden durch halbstrukturierte Interviews mit diplomierten Pflegepersonen in einer psychiatrischen Klinik erhoben. Die Interviews wurden transkribiert und analysiert, um Kategorien und Muster im Erleben des "schwierigen Patienten" zu identifizieren.
Welche ethischen Kriterien wurden bei der Durchführung der Studie berücksichtigt?
Ethische Aspekte wie Informed Consent, Vertraulichkeit und Schutz der Persönlichkeit der Probanden wurden berücksichtigt. Alle Teilnehmer unterschrieben eine Einverständniserklärung, und die Anonymität der Daten wurde gewährleistet.
Welche Kategorien wurden im Rahmen der Datenanalyse gebildet?
Im Rahmen der Inhaltsanalyse wurden neun Kategorien gebildet, die das Erleben von Schwierigkeiten aus pflegerischer Perspektive widerspiegeln. Diese Kategorien sind: Kommunikation, emotionale Involviertheit, zielorientiertes Arbeiten, fehlende Herausforderung, Konflikt, Beziehung, Behandlung, System und Gewalt.
Was sind die Schlussfolgerungen dieser Forschungsarbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass der "schwierige Patient" ein Phänomen ist, das im Wahrnehmungsprozess der Pflegenden konstruiert wird. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Art und Weise, wie Pflegekräfte Schwierigkeiten erleben, stark von ihren individuellen Konstruktionen und Erfahrungen beeinflusst wird. Die Empfehlungen richten sich an Pflegende, die ihren alltagsphilosophischen Ansatz hinterfragen und eine neue Perspektive auf den "schwierigen Patienten" entwickeln möchten.
Welche Rolle spielt die Kommunikation in der Wahrnehmung des "schwierigen Patienten"?
Kommunikationsprobleme, sowohl verbal als auch nonverbal, werden von Pflegepersonen als besonders schwierig erlebt. Eine Störung in der Kommunikation wird oft als eigenes Versagen wahrgenommen, was zu Unsicherheit und Frustration führen kann.
Wie beeinflussen Vorinformationen über Patienten die Pflegepersonen?
Vorinformationen über Patienten können problematische Vorurteile auslösen, werden aber andererseits auch als hilfreich empfunden, um sich auf die Betreuung einzustellen. Die Qualität und Art der Vorinformationen spielen somit eine entscheidende Rolle.
Welche Bedeutung hat die Einbeziehung der Angehörigen?
Kommunikationsprobleme mit Angehörigen werden als schwierig wahrgenommen. Es ist wichtig, die Angehörigen zu verstehen und ihnen die Behandlung der Patienten verständlich zu machen.
- Quote paper
- Guntram Fehr (Author), 1998, Der schwierige Patient: Phänomen oder Konstrukt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102603