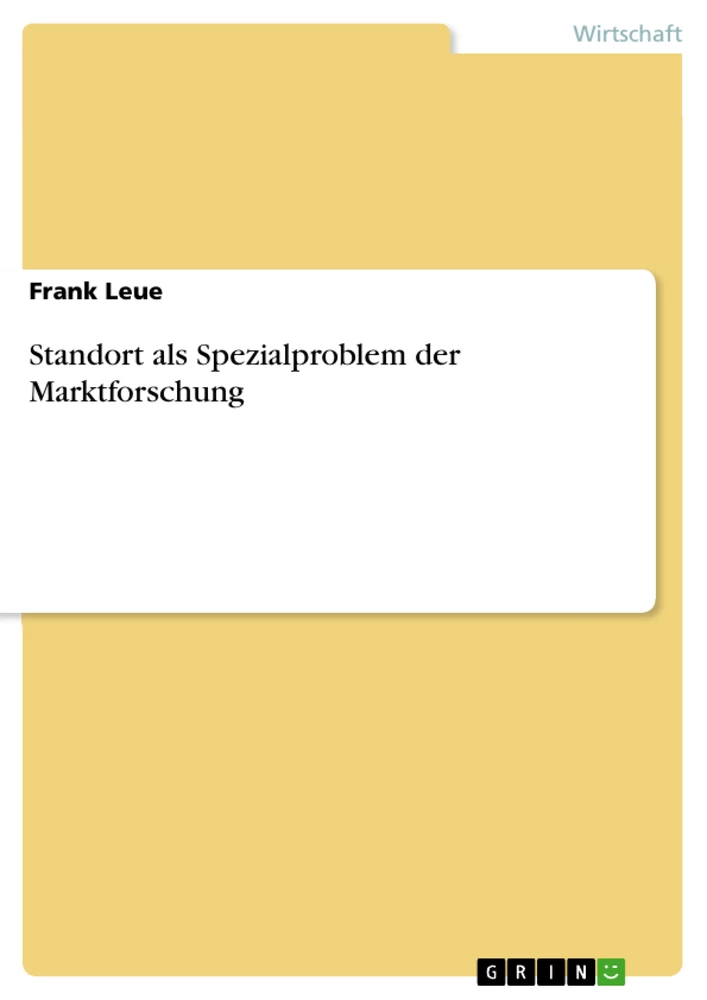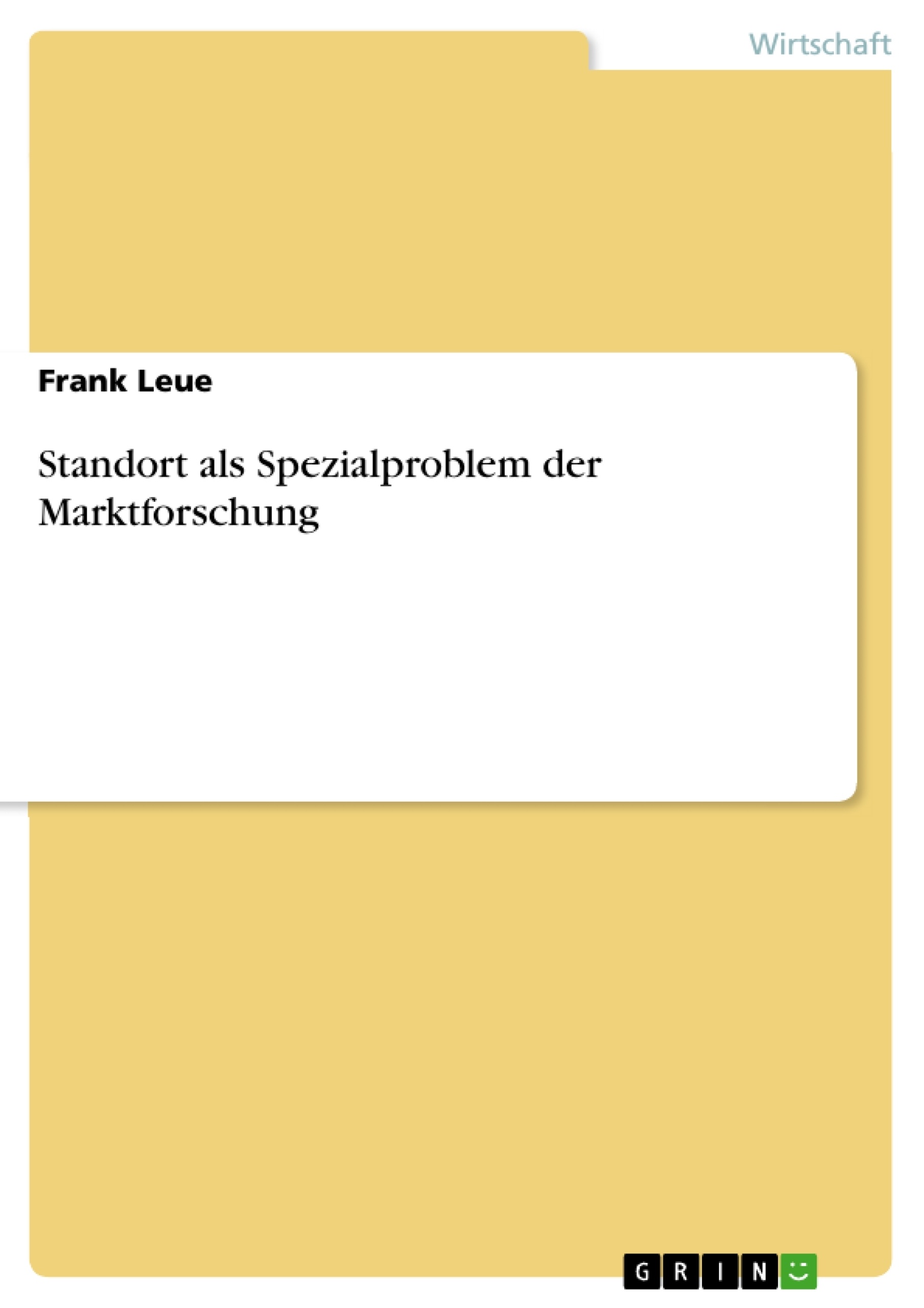„Standort als Spezialproblem der Marktforschung“
Definition: Als Standort einer Handelsunternehmung ist jener geographischer Ort anzusehen, an dem die Unternehmung zum Zweck der Erreichung ihrer Ziele Produktionsfaktoren kombiniert (Arbeit, Betriebsmittel, Werkstoffe)
- Mit wenigen Ausnahmen ist der Standort mit die wichtigste Entscheidung eines Einzelhändlers, denn der Standort ist eine konstitutive (langfristige) Entscheidung. Zusätzlich mit dem Standort werden auch gleichzeitig die potentiellen Nachfrager und Konkurrenten mit ausgewählt.
- Von einer systematischen Standortbestimmung lässt sich reden, wenn vorhandene Alternativen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten überprüft und ausgewählt werden:
- Standortanforderungen: Eigenschaften der Immobilie
- Standortfaktoren (-bedingungen): die Einschätzung der Absatzmöglichkeiten und die Analyse von Ballungsräumen.
- Absatzwirtschaftliche Aspekte: Man muss sich darüber im klaren sein, dass die Entfernung zum potentiellen Kunden somit fixiert wird, und je leichter der EH zu erreichen ist, desto geringer die psychologische Hürde ihn aufzusuchen. Sehr viele EH haben inzwischen ein größeres Einzugsgebiet als vor 20 Jahren, was allerdings durch die hohe EH-Dichte ausgeglichen wird und somit der Kunde nicht mehr so weite Wege hinter sich bringen muss.
- Analyse der Absatzmöglichkeiten (quantifiziert & Allgemein) in mehreren Schritten:
- Kaufkraft = Anzahl der Haushalte * jeweiliges Netto-Einkommen
- Kaufkraft der Bundesrepublik = 100,00; von der Gfk wird die Kaufkraft jeder Region einzeln ermittelt (Vergleichbarkeit); Hochtaunus-Kreis 146,1 und Prenzlau 52,9
- da in jeder Region A b- und Zuwanderungen der Kaufkraft vorhanden sind, müssen diese berücksichtigt werden (Berufspendler, Touristen etc.). Diese Zentralitätsziffer wird berechnet indem man den EH-Umsatz/Pro Kopf durch die Kaufkraft/pro Kopf rechnet. Problem: Nicht Branchenbezogen
- Ermittlung Nachfragevolumina innerhalb einer Branche: Das statistische Bundesamt erhebt regelmäßig und stichprobenartig Verbrauchsausgabenanteile. Nun kann man die Volumina gebietsweise ermitteln: Anzahl der Haushalte * Verbrauchsausgaben * Ab- bzw. Zuwanderung der Kaufkraft. Problem: geographische Konsumgewohnheiten werden nicht berücksichtigt => gewisse Ungenauigkeit
- Einkaufsstätten Attraktivität: Zu erwähnen ist dass bei der Ab- und Zuwanderung die Attraktivität einer Einkaufsstätte eine wesentliche Rolle spielt, denn eine hohe Attraktivität wirkt Distanzreduzierend auf den Kunden. Dazu wird ein Attraktivitätsindex erstellt der mehrere Gesichtspunkte mit einer Skala von 1 - 7 bewertet wird (u. a. Gesamteindruck, Gebäudewirkung, Schaufensterwirkung). Außerdem werden noch quantitative Kennziffern hinzugezogen (Umsatz, VKFläche). => Hohe Attraktivität bedeutet nicht gleichzeitig hoher Umsatz!!!
- Konkurrenzaspekt Konkurrenz kann sowohl negative als auch positive folgen für einen EH haben. Branchengleiche Agglomerationen (Anhäufungen) sind insofern kritisch als dass Sie meistens homogene Güter Aufweisen. Branchenungleiche Agglomerationen hingegen fördern oft das Geschäft weil sie der Attraktivität des „ganzen“ dienen, wovon auch der einzelne profitiert. Deswegen ist eine Konkurrenzanalyse wichtig! Gesamtumsatz des Einzuggebietes = durchschn. Flächenumsatz * ermittelte VK-Fläche. Dieser Umsatz muss dann mit dem branchenspezifischen Nachfragevolumen gegenübergestellt werden. => Fragestellung: „Welche Betriebe werden meine Konkurrenz darstellen, und welche nicht!“
- Verkehrslage (Mikro-Standort) Zwischen folgenden Kategorien wird differenziert:
- Groß-, Mittel-, Kleinstädte
- Innen-, Vorstadt, Randgebiete
- Haupt-, Mittel-, Nebenverkehrslage
- Geschäftskern und Nebenkern
Selbst gut gelegene Standorte müssen näher geprüft werden ob z.B. Parkmöglichkeiten gegeben sind, kaufstimulierende Nachbarschaft, breite Gehsteige etc.
Standortforschung
- Empirisch-Induktive-Verfahren Bei diesem Verfahren möchte man den voraussichtlichen Umsatz eines potentiellen Standort und einer bestimmten Größe des Betriebes ermitteln:
- Standortspezifisches Nachfragevolumen im Einzugsgebiet in der betreffenden Warengruppe
+ Nachfragezuflüsse aus anderen Einzugsgebieten
./. Nachfrageabflüsse in andere Einzugsgebiete
= Tatsächliche Gesamtnachfragevolumina im Einzugsgebiet
./. bereits ansässiges Wettbewerbspotential
=eigene Umsatzchancen am geplanten Standort
- Nun muss noch das Einzugsgebiet ermittelt werden, denn je genauer die wir das Einzugsgebiet abgrenzen, desto exakter sind unsere Berechnungen. Folgende Methoden haben sich durchgesetzt:
- Kreismethode Je näher die Einkaufsstätte, desto eher wird eingekauft. Ein Gebilde mit konzentrischen Kreisen entsteht, wobei der Mittelpunkt der Standort ist. Im Umkreis von 1 km Umsatzanteil von 60 %. => Unrealistische Annahme!
- Zeitdistanzmethode Hier wird der tatsächlich in Anspruch genommene Zeitaufwand zur Grundlage genommen (in Zeit oder Weg!!!). Gebilde hat eine unregelmäßige Form. => Konkurrenten und die Attraktivität werden außer acht gelassen
- ÖkonometrischeMethode Bei dieser Methode wird zusätzlich die Attraktivität berücksichtigt. Zeitdistanzreduzierende Attraktivität = der Einkaufsstätte inhärente (innenliegende) Attraktivität - durch die Distanz bewirkte Einkaufskosten. Das Absatzgebiet ist ebenfalls in Zonen eingeteilt. Die in den Zonen liegenden Einwohner werden mit der bereinigten Kaufkraft multipliziert - so erhält man den zu erwartenden Einkaufsstättenumsatz für den jeweiligen Standort. => Frage: „Welche Umsatzerwartung hat eien geplante Einkaufsstätte mit bestimmten Attraktivitätsgrad bei der gegebenen Konkurrenzsituation?“
- Punktbewertungsverfahren Im Rahmen großer Einzelhandelsketten werden die Standortentscheidungen standardisiert. Zuerst findet die Objektsuche und dann die Objektbewertung statt. Der Vorteil ist dass die Planer auf einen großen Erfahrungskatalog zurückgreifen können. Da viele Merkmale verschiedene Gewichtung haben, müssen auch Gewichtungsfaktoren bestimmt werden. Das Punktbewertungsverfahren setzt also eine große Erfahrung von den Planern heraus.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Standort im Kontext der Marktforschung für Handelsunternehmen?
Ein Standort einer Handelsunternehmung ist der geografische Ort, an dem die Unternehmung Produktionsfaktoren (Arbeit, Betriebsmittel, Werkstoffe) kombiniert, um ihre Ziele zu erreichen. Die Standortwahl ist meist eine langfristige Entscheidung, die auch potenzielle Kunden und Konkurrenten mitbestimmt.
Wann spricht man von einer systematischen Standortbestimmung?
Von einer systematischen Standortbestimmung spricht man, wenn vorhandene Alternativen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten überprüft und ausgewählt werden. Dabei werden Standortanforderungen (Eigenschaften der Immobilie) und Standortfaktoren/ -bedingungen (Einschätzung der Absatzmöglichkeiten, Analyse von Ballungsräumen) berücksichtigt.
Welche absatzwirtschaftlichen Aspekte sind bei der Standortwahl wichtig?
Die Entfernung zum potenziellen Kunden wird durch den Standort fixiert. Je leichter der Einzelhändler (EH) zu erreichen ist, desto geringer ist die psychologische Hürde für den Kunden. Obwohl das Einzugsgebiet vieler EH größer geworden ist, wird dies durch die hohe EH-Dichte ausgeglichen, sodass Kunden keine langen Wege mehr zurücklegen müssen.
Wie werden Absatzmöglichkeiten analysiert?
Die Analyse der Absatzmöglichkeiten erfolgt quantifiziert und allgemein in mehreren Schritten:
- Kaufkraft = Anzahl der Haushalte * jeweiliges Netto-Einkommen.
- Die Kaufkraft der Bundesrepublik wird als 100,00 festgelegt. Die GfK ermittelt die Kaufkraft jeder Region einzeln.
- Berücksichtigung von Ab- und Zuwanderungen der Kaufkraft (Berufspendler, Touristen etc.) durch die Berechnung der Zentralitätsziffer (EH-Umsatz/Pro Kopf / Kaufkraft/pro Kopf).
- Ermittlung von Nachfragevolumina innerhalb einer Branche anhand von Verbrauchsausgabenanteilen, die vom Statistischen Bundesamt erhoben werden.
Was ist bei der Ermittlung von Nachfragevolumina zu beachten?
Die Ermittlung der Nachfragevolumina basiert auf der Anzahl der Haushalte, den Verbrauchsausgaben und der Ab- bzw. Zuwanderung der Kaufkraft. Allerdings werden geografische Konsumgewohnheiten dabei nicht berücksichtigt, was zu Ungenauigkeiten führen kann.
Welche Rolle spielt die Einkaufsstätten-Attraktivität?
Die Attraktivität einer Einkaufsstätte spielt eine wesentliche Rolle bei der Ab- und Zuwanderung, da sie distanzreduzierend wirkt. Ein Attraktivitätsindex wird erstellt, der verschiedene Aspekte mit einer Skala von 1-7 bewertet (Gesamteindruck, Gebäudewirkung, Schaufensterwirkung) und quantitative Kennziffern (Umsatz, VKFläche) einbezieht. Eine hohe Attraktivität bedeutet jedoch nicht automatisch hohen Umsatz.
Wie wirkt sich Konkurrenz auf einen Einzelhändler aus?
Konkurrenz kann sowohl negative als auch positive Folgen haben. Branchengleiche Agglomerationen (Anhäufungen) sind kritisch, wenn sie homogene Güter aufweisen. Branchenungleiche Agglomerationen fördern oft das Geschäft, da sie die Attraktivität des "Ganzen" steigern. Eine Konkurrenzanalyse ist daher wichtig, um zu beurteilen, welche Betriebe Konkurrenz darstellen und welche nicht.
Welche Kategorien werden bei der Verkehrslage (Mikro-Standort) unterschieden?
Es wird differenziert zwischen:
- Groß-, Mittel-, Kleinstädte
- Innen-, Vorstadt, Randgebiete
- Haupt-, Mittel-, Nebenverkehrslage
- Geschäftskern und Nebenkern
Auch gut gelegene Standorte müssen auf Parkmöglichkeiten, kaufstimulierende Nachbarschaft, breite Gehsteige etc. geprüft werden.
Wie funktioniert das empirisch-induktive Verfahren zur Standortforschung?
Das Ziel ist, den voraussichtlichen Umsatz eines potenziellen Standorts und einer bestimmten Betriebsgröße zu ermitteln:
Standortspezifisches Nachfragevolumen im Einzugsgebiet in der betreffenden Warengruppe
+ Nachfragezuflüsse aus anderen Einzugsgebieten
./. Nachfrageabflüsse in andere Einzugsgebiete
= Tatsächliche Gesamtnachfragevolumina im Einzugsgebiet
./. bereits ansässiges Wettbewerbspotential
= eigene Umsatzchancen am geplanten Standort
Welche Methoden gibt es zur Ermittlung des Einzugsgebiets?
- Kreismethode: Geht von konzentrischen Kreisen um den Standort aus, wobei der Umsatzanteil mit der Entfernung abnimmt (unrealistische Annahme).
- Zeitdistanzmethode: Berücksichtigt den tatsächlichen Zeitaufwand, um den Standort zu erreichen (in Zeit oder Weg) (lässt Konkurrenten und Attraktivität außer Acht).
- Ökonometrische Methode: Bezieht die Attraktivität mit ein (Zeitdistanzreduzierende Attraktivität = der Einkaufsstätte inhärente Attraktivität - durch die Distanz bewirkte Einkaufskosten).
- Punktbewertungsverfahren: Standardisiert Standortentscheidungen, wobei Objekte anhand von Kriterien mit Gewichtungsfaktoren bewertet werden. Setzt große Erfahrung der Planer voraus.
- Standortprofilvergleich: Visuelle Darstellung des Punktbewertungsverfahrens, bei dem Standortkriterien anhand einer Skala bewertet und die Punkte miteinander verbunden werden.
- Quote paper
- Frank Leue (Author), 2001, Standort als Spezialproblem der Marktforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102569