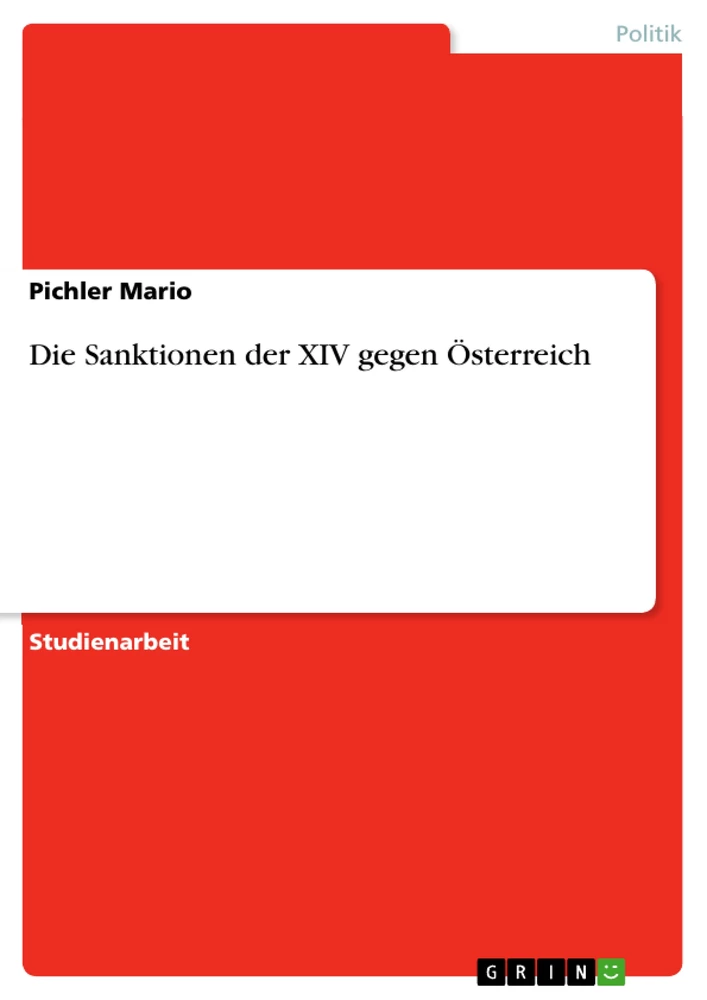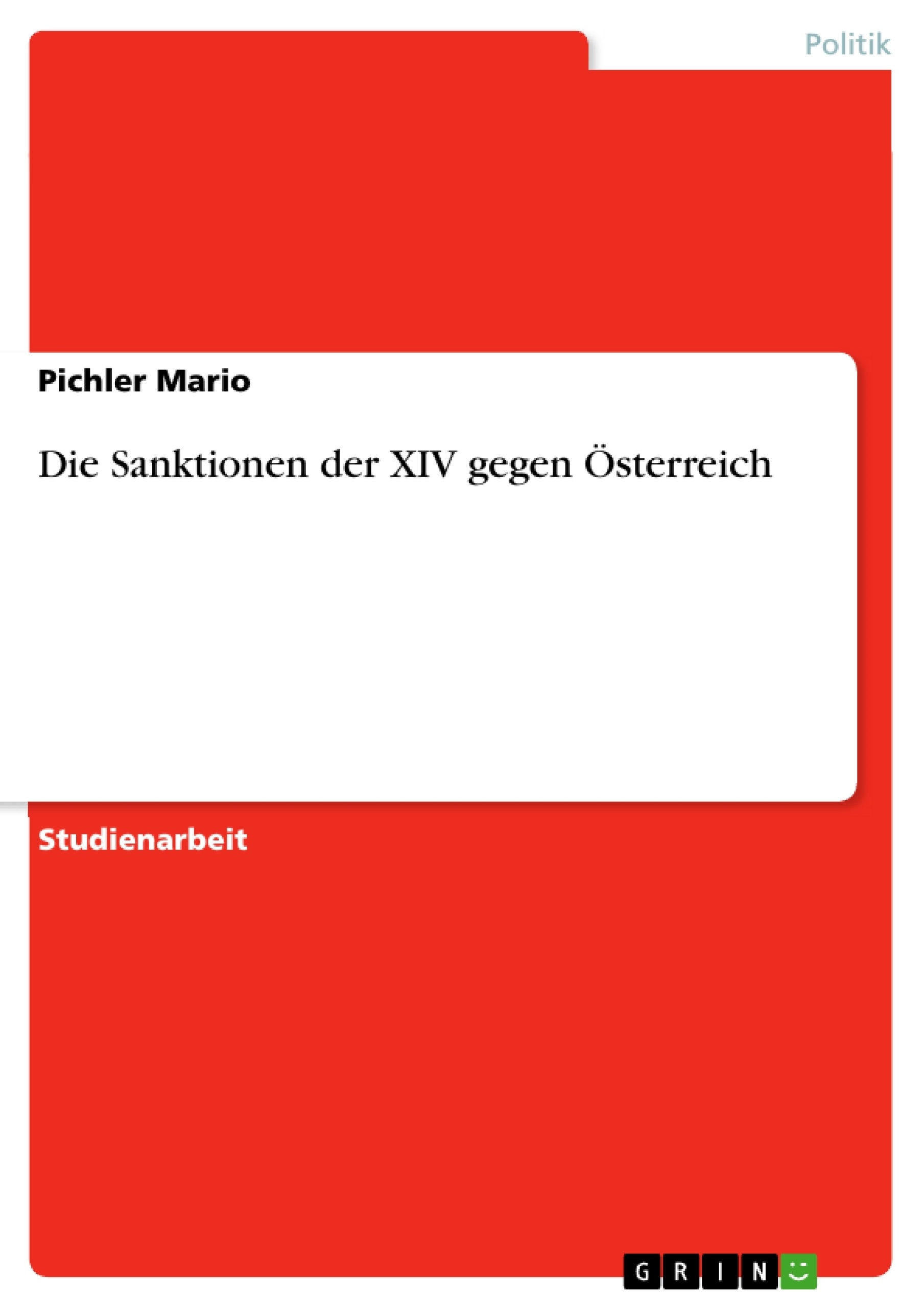1 Inhaltsverzeichnis
2 Vorwort und Themenabgrenzung
3 Gründe und Beginn der Sanktionen
3.1 Die Regierungsbildung
3.1.1 Die Wahlen
3.1.2 Erste Reaktionen im Ausland
3.2 Der Beginn der Sanktionen
3.3 Die Präambel
4 Die Entwicklung der Sanktionen
4.1 Die rechtliche Position
4.2 Bemühungen um eine Verbesserung der Beziehungen
4.2.1 Der Gipfel in Lissabon
4.2.2 Abseits der politischen Bühne
4.2.3 Eine Volksabstimmung gegen die Sanktionen?
4.2.3.1 Der Aktionsplan
4.2.3.2 Analyse des Aktionsplanes
4.2.3.3 Die peinliche Befragung
4.2.3.3.1 Die Stimmen zur Volksbefragung
4.2.3.3.2 Der konkrete Inhalt der Befragung
4.2.3.3.3 Analyse der Volksbefragung
5 Die drei Weisen
5.1 Ein Monitoring-Verfahren als Ausweg
5.2 Der EVP-Bericht als Vorbild
5.3 Kurze Vorstellung der drei Weisen
5.3.1 Martti Ahtisaari
5.3.2 Jochen Frowein
5.3.3 Marcelino Oreja
5.4 Tätigkeit der Weisen
5.4.1 Analyse der Position der drei Weisen
5.5 Der Bericht der Weisen
5.5.1 Inhaltliches
5.5.1.1 Das Eintreten der österreichischen Regierung für die gemeinsamen europäischen Werte, insbesondere für die Rechte von Minderheiten, Flüchtlingen und Einwanderern
5.5.1.2 Die Entwicklung der politischen Natur der FPÖ
5.5.1.3 Allgemeine Schlussfolgerungen
5.5.2 Kritische Äußerung zum Bericht
6 Das Ende und die Folgen der Sanktionen
7 Literaturverzeichnis
7.1 Offizielle Dokumente
7.2 Zeitungen und Zeitschriften
7.2.1 Tages und Wochenzeitschriften (chronologisch geordnet)
7.2.2 Artikel aus weiteren Periodika
7.3 Sonstiges
2 Vorwort und Themenabgrenzung
Die Sanktionen der XIV bedeuteten für Österreich wohl eine der schwersten außenpolitischen Krisen seit dem zweiten Weltkrieg. In jedem Fall stellen sie für mich persönlich das bedeutendste außenpolitische Ereignis dar, das ich selbst miterleben durfte.
Was lag also näher, als mich auch im Rahmen meiner Seminararbeit aus „Internationale Beziehungen“ mit diesem Thema zu beschäftigen und somit die Ereignisse des vergangenen Jahres nochmals Revue passieren zu lassen, zusammenzufassen und zu analysieren. Womit auch schon die thematische Abgrenzung der Arbeit ansatzweise dargestellt wäre. Die Arbeit soll die EU-Sanktionen und ihre Entwicklung, begonnen bei der Bildung der FPÖ/ÖVP-Regierung bis zum Weisenbericht und der Beendigung der Sanktionen darstellen. Darüber hinaus sollen auch die Folgen der Sanktionen für Österreich aber auch für die gesamte Europäische Union untersucht werden.
3 Gründe und Beginn der Sanktionen
3.1 Die Regierungsbildung
3.1.1 Die Wahlen
Am 3. Oktober 1999 fanden in Österreich die letzten Nationalratswahlen statt, deren Ergebnis wie folgt aussah: SPÖ: 33,4% (-4,7%), ÖVP: 26,9% (-1,4%), FPÖ: 27,2% (+5,3%), G: 7,1% (+2,3%) LF: 3,4% (-2,1%). Das Ergebnis dieser Wahl schlägt sich auch ganz erheblich in der Sitzverteilung im Parlament nieder. Einzig die ÖVP bleibt bei ihrem Status von 52 Mandaten. Die SPÖ verliert 6 Plätze und hält nun nur mehr 65 Sitze, die FPÖ verbessert sich um 8 Sitze auf 53, und hat somit die Volkspartei überflügelt.[1] Auch die Grünen können 4 Sitze gutmachen und erreichen nunmehr 13 Mandate. Kein einziges Mandat erreicht das Liberale Forum, kann es doch die geforderte „4% Hürde“ nicht überspringen.[2]
3.1.2 Erste Reaktionen im Ausland
Bereits dieses Wahlergebnis hatte heftige Reaktionen im Ausland sowohl von medialer als auch von politischer Seite zur Folge. Allen voran kritisierten Israels Politiker die Vorgänge in Österreich: Israels Ministerpräsident Ehud Barak warnte vor einer „Ausbreitung der Pest des Neonazismus, Außenminister David Levy nannte das Wahlergebnis ein „Nachbeben der Nazi-Zeit“[3] und drohte mit einem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich und Israel und Staatspräsident Eser Weizman forderte die österreichischen Juden auf das Land zu verlassen.[4] Neben der Empörung von jüdischer Seite wurden auch negative Stimmen aus verschiedenen anderen Ländern laut.
Der spätere Bundeskanzler Wolfgang Schüssel soll bereits zu dieser Zeit über eventuell drohende Sanktionen im Fall einer Regierungsbeteiligung der FPÖ informiert worden sein.[5] Die Schweizer befürchteten nun auch in ihrem eigenen Land einen Aufstieg der Kräfte von rechtsaußen, konkret von Christoph Blocher dem Führer der SVP.[6] Eine Ausnahme stellte hier Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber dar, der der ÖVP empfahl mit der FPÖ in die Koalition zu gehen.[7]
In den darauf folgenden Wochen fanden die Sondierungsgespräche zwischen den einzelnen Parteien statt. Am Fr, 21.01.2000 um 3:17 Uhr wurde das entgültige Scheitern der Verhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ von Viktor Klima bekannt gegeben.[8] Gleich darauf begannen die Verhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ.[9]
Auch hier folgten erneute erboste Reaktionen aus dem Ausland. So sprach man in Berlin bereits von einer Teilquarantäne gegen Österreich auch wenn Haider nicht in die Regierung käme. Der deutsche Bundeskanzler Gerd Schröder, der französische Ministerpräsident Lionel Jospin sowie auch der spanische Ministerpräsident José Maria Aznar äußerten Beunruhigung und Bedenken. Neben den sozialdemokratischen Regierungschefs kam sehr starke Kritik auch vom französischen Staatspräsidenten Chirac sowie auch vom EU-Kommissionspräsidenten Romano Prodi. Auch andere christlich demokratische Granden äußerten sich negativ. So etwa Siegfried Brugger, Obmann der Südtiroler VP, Italiens Ex-Präsident Francesco Cossiga, EU- Parlamentspräsidentin Nicole Fontaine. Die stärkste Kritik wurde aus Belgien laut.
Premierminister Guy Verhofstadt und allen voran Außenminister Lois Michel äußerten sich zu den Regierungsverhandlungen in Österreich.[10]
3.2 Der Beginn der Sanktionen
Die tatsächliche Angelobung der ÖVP/FPÖ Regierung durch Bundespräsident Thomas Klestil fand am 4. Februar 2000 statt. Diese vom Staatsoberhaupt mit offensichtlich geringer Begeisterung vorgenommene Amtshandlung erregte weltweite Aufmerksamkeit.[11]. Israel etwa zog sofort nach der Angelobung seinen Botschafter aus Wien ab. "Israel kann angesichts des Aufstiegs von rechtsextremen Parteien nicht schweigen", ließ das Außenministeriums in Jerusalem verlauten, "besonders in Ländern die eine Rolle in den Ereignissen spielten, die zur Vernichtung eines Drittels des jüdischen Volkes im Holocaust geführt haben". Besonders problematisch sei es wenn "Parteien, so wie jene, die von Jörg Haider geführt wird", an Regierungen beteiligt würden. Auch Wesley Clark, Oberkommandierender der Nato in Europa sagte seinen Termin für ein Treffen mit Vertretern des Verteidigungsministeriums kurzfristig ab, offiziell aus zeitlichen Gründen.[12]
Auch von Seiten der USA, im speziellen von deren Außenministerin Albright wurde verlautet „man werde hart und entschieden reagieren“. Albrigth versuchte noch vor der Angelobung Schüssel von seinem Vorhaben einer blau-schwarzen Regierung abzubringen.
Bereits im Vorfeld der Angelobung, wurden seitens der EU die entsprechenden Reaktionen darauf vorbereitet.[13] In der Erklärung der portugiesischen EU- Präsidentschaft vom 31. Jänner heißt es:
"Die Regierungen der 14 Mitgliedsstaaten werden keinerlei offizielle bilaterale Kontakte auf politischer Ebene mit einer österreichischen Regierung unter Einbindung der FPÖ betreiben oder akzeptieren. Es wird keine Unterstützung für österreichische Kandidaten geben, die Positionen in internationalen Organisationen anstreben. Österreichische Botschafter werden in den EU-Hauptstädten nur noch auf technischer Ebene empfangen." Weiters werde es auf bilateraler Ebene mit einer Regierung unter Einbeziehung der FPÖ "kein business as usual" geben". Die Maßnahmen wurden noch am 4. Februar in Kraft gesetzt. [14]
Von der Inkraftsetzung der Maßnahmen war selbst die Kommission überrascht. Lediglich Kommissionspräsident Prodi war informiert worden. Ein weiteres Indiz dafür, dass die EU die Maßnahmen als rein bilateralen Akt der einzelnen Mitgliedsstaaten verstanden wissen will.[15]
3.3 Die Präambel
Ein spezieller Aspekt der Regierungsbildung und im speziellen der Regierungserklärung ist die Präambel (Titel: Deklaration Verantwortung für Österreich – Zukunft im Herzen Europas) welche der Regierungserklärung vorangestellt ist, und die von den beiden Parteichefs bereits einen Tag vor der Angelobung im Beisein von Bundespräsident Klestil unterschrieben wurde.[16] Die Präambel wurde von Klestil verfasst um der starken internationalen Kritik an der zukünftigen österreichischen Regierung zu begegnen. Jedoch auch seitens ÖVP und FPÖ bestand der Wunsch nach dieser Präambel, vermutlich in der Hoffnung dem international bereits angedrohten Sanktionen doch noch zu entgehen. [17]
Zum Inhalt der Präambel ist zu sagen, dass sie ein Signal an die internationale Gemeinschaft von Kritikern darstellte, und vor allem die Befürchtungen, die seitens dieser Kritiker gegenüber der FPÖ gehegt wurden und noch immer werden, zerstreuen hätte sollen.
Nach meinem persönlichen Dafürhalten lässt sich die Präambel in 4 große Themenbereiche gliedern. Zu Beginn stehen vor allem die Menschenrechte und das Bekenntnis der Bundesregierung zu diesen Rechten im Mittelpunkt (Haider hatte diese ja in früherer Zeit in Frage gestellt).
Danach folgt ein starkes Bekenntnis zu Europa, wohl ein sehr wichtiges Signal an die 14 Partnerstaaten der EU.
Ein weiterer großer Themenblock beschäftigt sich mit anderen politischen Fragestellungen, hier ist vor allem das Bekenntnis zur Sozialpartnerschaft bemerkenswert, was wohl als reine innenpolitische Aussage zu werten ist.
Der letzte Teil der Präambel hat schließlich die Österreichische Geschichte, und hier natürlich im speziellen die Rolle Österreichs im Dritten Reich zum Thema. Ebenfalls eine Themenstellung zu der Haiders Position oft internationales Aufsehen erregt hat.[18]
Grundsätzlich, so meine ich, beinhaltet die Präambel, all jene Themenstellungen, zu denen Haider bereits österreichisches aber vor allem internationales Missfallen ausgelöst hat. Die Situation ließ Haider kaum eine andere Möglichkeit, als das Schriftstück zu unterschreiben, andernfalls hätte er sich und seine Partei als absolut nicht regierungstauglich deklariert. In ihrer Formulierung steht die Präambel teilweise naturgemäß im starken Gegensatz zu bisherigen Äußerungen der FPÖ. Wie passt etwa ein Bekenntnis „zum Friedensprojekt Europa“ oder ein „Bekenntnis zur Mitgliedschaft Österreichs in der Europäischen Union“[19] mit einer Forderung zum Austritt aus der Union zusammen, wie Haider in etwa, die Vereinbarung der Präambel brechend, in einem Zib2 Interview fordert.[20] Wie lässt sich eine Verurteilung von Diskriminierung, Intoleranz und Verhetzung mit den Wiener Wahlplakaten „Stopp der Überfremdung“ vereinbaren.
All diese krassen Gegensätze ergeben sich klarerweise aus der Natur der Sache. Hätte die FPÖ nicht in früherer Zeit, derartiges Verhalten an den Tag gelegt, so wäre die Präambel nicht notwendig gewesen, ja dann wäre die FPÖ immer noch eine liberale Partei, und niemand hätte eine Regierungsbeteiligung als anstößig erachtet, war doch die FPÖ bereist einmal an der Regierung beteiligt.
Die Frage die allerdings zu stellen ist, ist woher der plötzliche Sinneswandel kommen soll. Warum ist auf einmal alles anders? Als Obmann einer Oppositionspartei spricht man von der „ordentlichen Beschäftigungspolitik im 3. Reich“[21] (Zugegebenermaßen hat dieses Zitat ob seiner häufigen Verwendung im Diskurs über die FPÖ bereits eine gewisse Inflation erfahren, da es aber ein sehr eindringliches und auch folgenschweres Beispiel darstellt, kann auch ich der Versuchung es zu verwenden nicht widerstehen.) als Obmann einer Regierungspartei „stellt man sich der Verantwortung aus der verhängnisvollen Geschichte des 20. Jahrhunderts und den ungeheuerlichen Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes.“[22]
Insofern lässt sich wohl berechtigter Zweifel gegenüber der Glaubwürdigkeit der in der Präambel abgegebenen Bekenntnisse anmelden und besteht doch Grund zur Annahme, dass es sich dabei nicht lediglich um Lippenbekenntnisse handelt. Vor allem stellt sich die Frage, was bei Zuwiderhandeln als Konsequenz folgen würde. Vermutlich wollte Klestil sich hier eine Handhabe schaffen, um die Regierung im eventuellen Falle entlassen zu können und dies nicht als Willkürakt erscheinen zu lassen, sondern mit der Verletzung der Präambel argumentieren zu können.[23]
Diese Ansicht herrschte zweifellos auch international vor, erregte die Präambel doch relativ wenig Aufsehen und war auch nicht dazu geeignet Österreich vor den Sanktionen zu bewahren. Hier wurde die FPÖ wohl an ihren Taten gemessen, und nicht an Haiders Unterschrift unter der Präambel.
4 Die Entwicklung der Sanktionen
4.1 Die rechtliche Position
Eine Frage, die sich im Laufe der Sanktionen immer wieder stellte, war die nach der rechtlichen Deckung des politischen Vorgehend der EU Staaten. Ist es doch so, dass der EU-Vertrag rechtlich die Möglichkeit eines Ausschlusses nicht kennt. Es wurde allerdings im Vertrag von Amsterdam im Jahr 1999 eine Sanktionsklausel eingeführt die es ermöglicht einzelne Länder zur Räson zu zwingen.
Konkret heißt es im Artikel 6 (1): Die Union beruht auf den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit; diese Grundsätze sind allen Mitgliedstaaten gemeinsam.“[24] Jenes Land das diese Regeln „schwerwiegend und anhaltend“ verletze, über den können nach Anhörung der Regierung dieses Landes vom Rat mit qualifizierter Mehrheit Sanktionen verhängt werden. Eine solche Verletzung muss also schwerwiegend und andauernd, sein, was nach Rotter bedeutet, „dass sie durch eine einzelstaatliche Rechtsschutzeinrichtung nicht verhindert bzw. beseitigt werden, bzw. dass diese mit anderen Worten versagt oder ausgeschaltet ist.“[25] Die Sanktionen können bis zur Aussetzung der Stimmrechte im Rat reichen. (Artikel 7)[26] Bei den Sanktionen der Europäischen Union gegen Österreich handelte es sich nicht um derartige Maßnahmen, war doch zur damaligen Zeit niemand, mit Ausnahme Belgiens, der Meinung, dass Österreich Verstöße in der notwendigen Schwere geleistet hatte. Grün Abgeordneter Daniel Cohn-Bendit dazu in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Format auf die Frage zur Anwendung des Artikel 7 „Um den anzuwenden, muss die Haider- Regierung zwei KZ errichten“[27] Was aber soll die in Abschnitt 2.2. zitierte Sanktionserklärung nun konkret bedeuten? Grundsätzlich legte die Europäische Union, wie oben bereits dargelegt, die Sanktionsmaßnahmen als „bilaterale Privatsache der Europäischen Regierungschefs“[28] an.
[...]
[1] vgl. „Wende nach Rechts“ Format 40/99, S. 12 – 18 Rechtsruck ist völlig unverständlich, DER STANDARD, 6.10.1999
[2] gemäß § 100(1) NRWO Nationalrats-Wahlordnung ´92 mir Anmerkungen und Nebengesetzten; Hrsg: FISCHER, Heinz; BERGER Manfred, STEIN Robert, Wien 1993
[3] vgl. Schattenkanzler Haider, Der Spiegel, 5/00, S 140-150
[4] vgl. Backhendl und Wildreis, Der Spiegel, 41/99, S 226
[5] vgl. ROTTER, Manfred: Analyse der Sanktionen der 14, in Europäische Rundschau 3/2000, S. 21-37 vgl. SCHULMEISTER. Paul: Berliner Sackgasse, in Europäische Rundschau 2/2000, S. 3-12
[6] vgl. Rechte Wahlverwandtschaften, Die Weltwoche,
[7] vgl. Sind wir alle Nazis?, Format 41/99, S 40-46
[8] vgl. Protokoll eines Nervenkrieges, Format 4/00, S 38-39
[9] vgl. Fahrt ins Blaue, Format 5/00, S 24-32
[10] vgl. „Wir werden Österreich unter Teilquarantäne stellen“, Format 5/00, S. 38-40
[11] vgl. Die Pein des Frostes beim Schwur, DerStandard, 5./6.2.2000
[12] vgl. Israels Botschafter wurde offiziell abberufen, Der Standard, 5./6.2.2000
[13] vgl. Portugal macht Ernst, Der Standard, 4.2.2000
[14] "Kein business as usual", Der Standard, 12.5.2000
[15] vgl. Sperrfeuer auf den Alpenbunker, Der Spiegel, 6/00, S 140-146
[16] vgl. ÖVP und FPÖ: Präambel für Toleranz Parteichefs unterschreiben, Der Standard, 4.2.2000
[17] vgl. Die Kurswende im internationalen Scheinwerferlicht, Der Standard, 2.2.2000
[18] vgl. Präambel: Deklaration Verantwortung für Österreich – Zukunft im Herzen Europas
[19] ebd.
[20] vgl. Interview zib2, 19.4.2000
[21] 13.6.1991, Kärntner Landtag (Quelle: http://hinfo.brinkster.net/neu/default.asp)
[22] vgl. Präambel: Deklaration Verantwortung für Österreich – Zukunft im Herzen Europas
[23] gemäß Art 70 (1) B-VG
[24] Konsolidierte Fassung des Vertrages über die Europäische Union (Quelle: http://europa.eu.int/eur- lex/de/treaties/index.html)
[25] ROTTER, Manfred: Analyse der Sanktionen der 14, in Europäische Rundschau 3/2000, S. 27
[26] vgl. Ratspräsident Haider, Format, 6/00, S. 40
[27] vgl. „Haider soll mit mir ins TV...“, Format, 6/00, S. 50
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser Seite?
Diese Seite enthält eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Schwerpunktthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter umfasst. Es handelt sich um eine Analyse der EU-Sanktionen gegen Österreich im Jahr 2000.
Welche Themen werden in diesem Dokument behandelt?
Die behandelten Themen sind unter anderem: die Regierungsbildung in Österreich, die Reaktionen des Auslands darauf, der Beginn und die Entwicklung der Sanktionen durch die EU-14, die Rolle der "drei Weisen" und deren Bericht, das Ende der Sanktionen und die Folgen für Österreich und die Europäische Union.
Welche Gründe werden für die Verhängung der Sanktionen genannt?
Die Sanktionen wurden aufgrund der Regierungsbeteiligung der FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs) verhängt, da Bedenken hinsichtlich deren politischer Ausrichtung und möglicher Auswirkungen auf die Einhaltung europäischer Werte bestanden.
Was war die "Präambel" und welche Bedeutung hatte sie?
Die Präambel war eine Erklärung der neuen Regierung, unterzeichnet von den Parteichefs und dem Bundespräsidenten, in der sie sich zu Menschenrechten, Europa und der Verantwortung Österreichs für seine Rolle im Dritten Reich bekannte. Sie sollte internationale Kritiker besänftigen, konnte die Sanktionen aber nicht verhindern.
Was war die Rolle der "drei Weisen"?
Die "drei Weisen" waren ein von der EU eingesetztes Monitoring-Verfahren. Sie analysierten die politische Situation in Österreich und verfassten einen Bericht, der als Grundlage für die Entscheidung über die Aufhebung der Sanktionen diente. Die drei Weisen waren Martti Ahtisaari, Jochen Frowein und Marcelino Oreja.
Wie endeten die Sanktionen?
Die Sanktionen wurden nach der Veröffentlichung des Berichts der "drei Weisen" und Zusicherungen der österreichischen Regierung bezüglich der Einhaltung europäischer Werte aufgehoben.
Welche rechtliche Grundlage hatten die Sanktionen?
Die rechtliche Grundlage der Sanktionen war umstritten, da der EU-Vertrag keinen direkten Mechanismus für den Ausschluss von Mitgliedstaaten vorsieht. Die Sanktionen wurden als bilaterale Maßnahmen der EU-Mitgliedsstaaten interpretiert.
Was war die Reaktion des Auslands auf die Regierungsbildung in Österreich?
Es gab heftige Reaktionen aus dem Ausland, insbesondere aus Israel und anderen europäischen Ländern, die Bedenken hinsichtlich der Beteiligung der FPÖ an der Regierung äußerten. Viele Länder brachen oder reduzierten ihre diplomatischen Kontakte zu Österreich.
- Quote paper
- Pichler Mario (Author), 2001, Die Sanktionen der XIV gegen Österreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102560