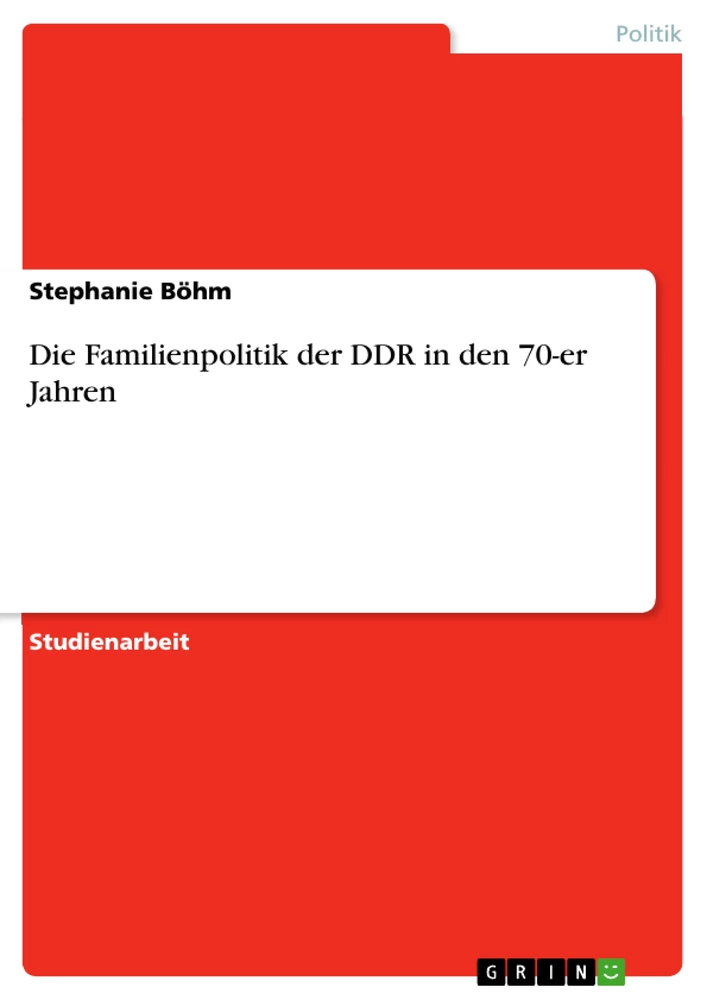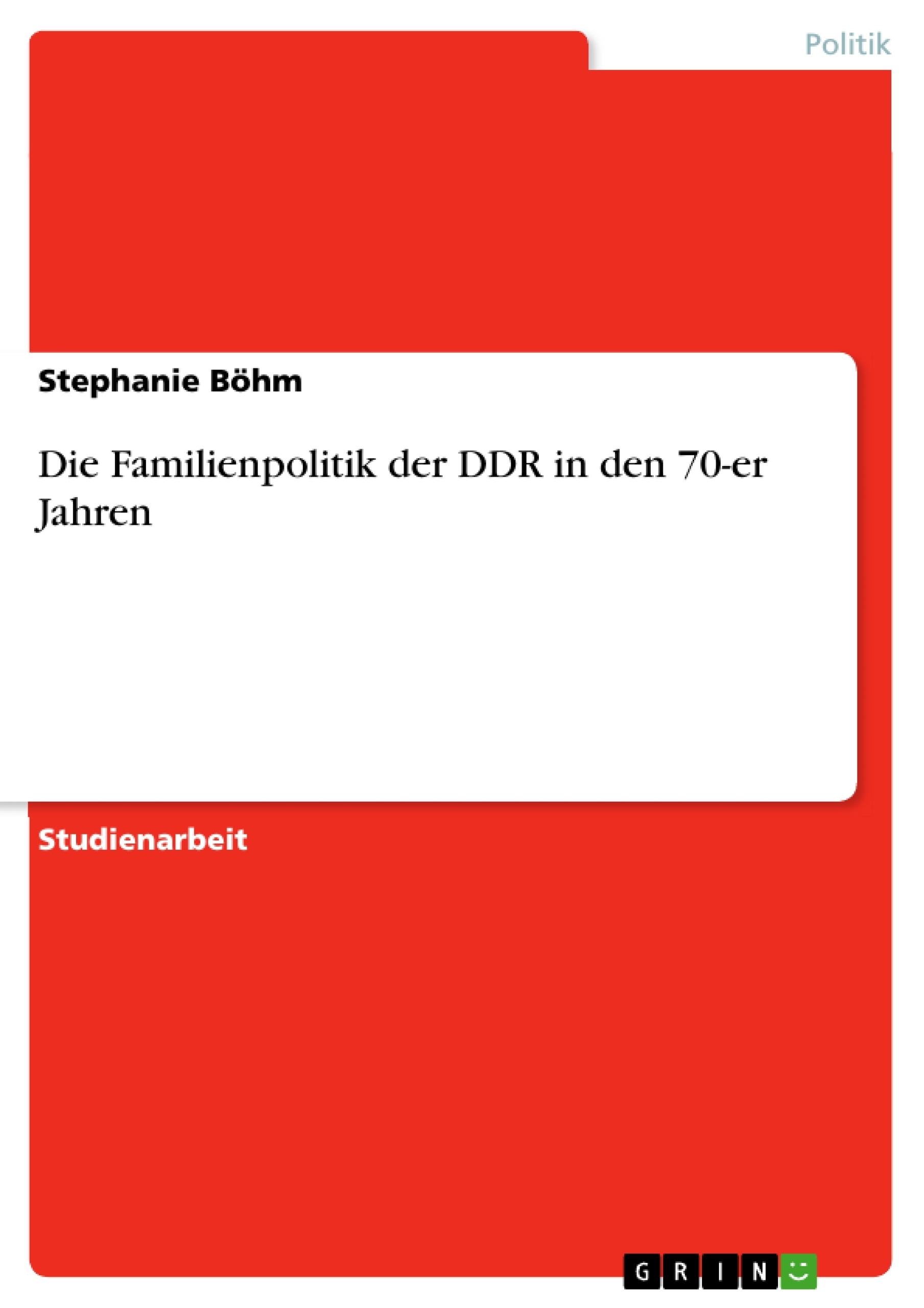Wie der Sozialismus die Familie formte: Eine aufschlussreiche Analyse der Familienpolitik in der DDR der 1970er Jahre. Entdecken Sie, wie das politische System der DDR, durchdrungen von sozialistischer Ideologie, tiefgreifende Auswirkungen auf die Familienbildungsprozesse und die Rolle der Frau hatte. Diese fesselnde Studie enthüllt, wie demografische Veränderungen, wirtschaftliche Zwänge und das Streben nach Gleichberechtigung die Familienpolitik prägten und welche ideologischen Motive hinter den Maßnahmen der SED-Führung standen. Tauchen Sie ein in die Welt des Familiengesetzbuches, das mehr als nur eine Sammlung von Rechtsnormen war – ein Spiegelbild des sozialistischen Familienideals. Erfahren Sie, wie die Erwerbstätigkeit der Frau, die staatliche Kinderbetreuung und die Förderung kinderreicher Familien ineinandergriffen, um eine spezifische Form der Bevölkerungspolitik zu gestalten. War die Gleichberechtigung der Geschlechter wirklich verwirklicht, oder diente die Familienpolitik primär dazu, ökonomische Ziele zu erreichen und den Arbeitskräftemangel zu beheben? Untersuchen Sie die Diskrepanz zwischen Ideal und Realität, zwischen Anspruch und Wirklichkeit im Leben der DDR-Familien. Diese kritische Auseinandersetzung mit der Familienpolitik der DDR wirft ein neues Licht auf die Instrumentalisierung der Familie im Dienste des Staates und bietet wertvolle Einblicke in die Wechselwirkungen zwischen Politik, Ideologie und dem privaten Leben der Menschen. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für die Geschichte der DDR, die Rolle der Frau im Sozialismus und die Mechanismen politischer Einflussnahme auf das Familienleben interessieren. Dieses Buch deckt auf, wie die sozialistische Ideologie in der DDR das Familienbild prägte, von der Rolle der Frau in der Arbeitswelt bis hin zur staatlichen Steuerung der Geburtenrate. Die Analyse der Familienpolitik der 70er Jahre bietet eine brisante Perspektive auf die Diskrepanz zwischen Ideal und Realität im sozialistischen Alltag und beleuchtet, wie ökonomische Interessen und demografische Ziele die politischen Entscheidungen beeinflussten. Ein Muss für jeden, der die komplexen Zusammenhänge zwischen Staat, Gesellschaft und Familie in der DDR verstehen will. Lassen Sie sich fesseln von einer Geschichte, die zeigt, wie Politik in die intimsten Bereiche des Lebens eindringen kann.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1.Der Sozialismus
´2.Die Entwicklung des Sozialismus auf dem Gebiet der DDR
2.1.Die 1. Phase von 1945 bis 1965
2.2.Die zweite Phase (1961 bis 1970)
2.3. Die 3. Phase ab 1971
3.Die Sozialpolitik der DDR
4.Die Familienpolitik der DDR
4.1. Die Anfänge der sozialistischen Familienpolitik
4.2. Die sozialistische Familie lt. FGB
4.2.1. Zum Verhältnis von Familie und Gesellschaft
4.2.2. Die Funktionen der sozialistischen Familie
4.3. Die weitere Entwicklung der Familienpolitik
4.4. Die Hintergründe der familienpolitischen Maßnahmen in den 70er Jahren
5.Die Erwerbstätigkeit der Frauen in den 70er Jahren
5.1.Die familienpolitischen Maßnahmen aus der Perspektive der Gleichberechtigung von Mann und Frau
5.2.Das Problem der Teilzeitbeschäftigung der Frauen
5.3.Die Familienpolitik der DDR als Bevölkerungspolitik
6.Zusammenfassung und Schluss
Anhang
Literatur
„... Politik wird nicht um ihrer selbst Willen betrieben, sondern sie kann als Instrument zur Erfüllung der Ideen und Ziele der jeweils „herrschenden Klasse“ und somit des Staates, in realitas der Partei, betrachtet werden.“
(Cromm, J., 1998, S.270)
Einleitung
Um die Entwicklung einer an die Familie adressierten Politik darzustellen, ist es unumgänglich, die jeweils herrschende Gesellschaftsordnung als Grundlage einzubeziehen .
Der Prozess und Verlauf der Familienbildung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zeigt permanente Wirkungen auf Struktur und Entwicklung der Bevölkerung . Diese demographischen Prozesse wirken sich mit zeitlicher Verzögerung auf die wirtschaftlichen Verhältnisse eines Landes aus.
Weiterhin ist unbestritten, dass sich innerfamiliäre Prozesse auch auf die gesellschaftliche Entwicklung auswirken, indem Werte und Normen des politischen und gesellschaftlichen Systems an die nächste Generation weitergegeben werden. Dem komplexen System Familie kommt deshalb eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu.
Aus diesem Grund stellt sich die Frage, wie eine Gesellschaftsordnung mit diesem wertvollen Gut umgeht .
Hierbei werden aus ideologischen Gründen Unterschiede deutlich: Wird hierzulande eine Einmischung des Staates abgelehnt bzw. dem Subsidiaritätsprinzip unterworfen, ist eine spezifisch intendierte Politik in anderen Gesellschaftssystemen, wie z.B. dem Sozialismus, geradezu notwendig1.
Der Sozialismus als Gesellschaftsordnung und politische Ideologie bildete die Basis für eine Politik, die auf die Familienbildungsprozesse der DDR-Bevölkerung als solches und seit den 70er Jahren in besonderem Maße einwirkte.
Die vorliegende Arbeit beschreibt auf der Grundlage des politischen Systems der DDR und den damit einhergehenden sozialistischen Ideologien die praktizierte Familienpolitik der 70er Jahre und ihre Entwicklung.
Die demographischen Prozesse, die ökonomischen Aspekte und die Rolle der Frauenerwerbstätigkeit fließen in diese Darstellung ein und rücken die ideologischen Begründungen der politischen Führung der DDR in ein teilweise recht kritisches Licht.
1. Der Sozialismus
Sozialismus wird beschrieben als :
a) eine politische Lehre, die bestehende gesellschaftliche Verhältnisse verändern will, um den Zustand sozialer Gleichheit und Gerechtigkeit zu erreichen
b) eine politische Bewegung, die diese Lehre als Basis versteht und gesellschaftliche Veränderungen anstrebt
c) eine nach den Prinzipien dieser Lehre organisierte Gesellschaftsordnung
d) als dasÜbergangsstadium von der kapitalistischen zur kommunistischen Gesellschaftsformation im Marxismus-Leninismus (Meyers Großes Lexikon,1993)
Eine allgemein anerkannte Definition existiert nicht2, da sich der Begriff des Sozialismus durch eine große Vielfalt an Bedeutungen und historische Erscheinungsformen auszeichnet.
Sozialismus ist grundsätzlich gekennzeichnet durch Kritik an bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen . Die Interessen der Bevölkerungsgruppen, die nicht an der Ausübung der Herrschaft teilhaben, dienen als Orientierung bei der Entwicklung eines Gegenmodells zur bestehenden Ordnung nach dem Prinzip der sozialen Gleichheit und Gerechtigkeit. Ziel aller sozialistischen Ideen, Bewegungen und Organisationen ist der „Umsturz“ der kritisierten Ordnung, bzw. die Gründung einer Staats-, Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung , die soziale Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität für alle Angehörigen und Gruppen der Gesellschaft realisiert.
Mit der Durchsetzung der industriellen Produktionsweise und dem sich mit ihr entfaltenden kapitalistischen Wirtschaftssystem zu Anfang des 19.Jahrhunderts verbreitete sich die Lehre des Sozialismus.
Die Erkenntnis, dass aufgrund des wissenschaftlich-technischen Fortschritts nun v.a. ökonomische Faktoren die gesellschaftlichen Verhältnisse formten, führte zu ersten Überlegungen hinsichtlich planwirtschaftlicher Lenkung, Kollektivierung des Eigentums und genossenschaftlicher Organisationsformen.
Die wissenschaftliche Fundierung der Theorie des Sozialismus und die Aufstellung weiterer Grundsätze für die Gestaltung einer künftigen Gesellschaft durch Karl Marx und Friedrich Engels seit 1859, bildeten die Grundlage für weitere Schritte.
1915 bezeichnete Lenin den Sozialismus erstmals als Übergangsstadium zu einer kommunistischen Gesellschaft, welches sich durch die Diktatur des Proletariates auszeichnen solle.
Die marxistisch-leninistische Auffassung geht von einer Verwirklichung des Sozialismus in drei Phasen aus3.
Diese drei Phasen sind später bei der Errichtung einer sozialistischen Gesellschaftsordnung auf dem Gebiet der SBZ4 für politische Zielsetzungen von größter Bedeutung.
2. Die Entwicklung des Sozialismus auf dem Gebiet der DDR
2.1. Die 1. Phase von 1945 bis 1965
In der ersten Phase einer 5 sozialistischen Gesellschaftsordnung soll lt. der marxistischleninistischen Theorie die alte Gesellschaftsformation vernichtet und die neue kommunistische Formation errichtet werden.
In der Literatur wird dieser Zeitraum auch als „antifaschistisch-demokratische Umwälzung (1945 - 1949) und „Schaffung der Grundlagen des Sozialismus“ (1949- 1961) angegeben6.
Diese Phase des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus begann in der DDR mit der Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse.
Das Aktionsabkommen zwischen den seit Juni 1945 im Machtbereich der sowjetischen Besatzungszone zugelassenen Parteien SPD und KPD am 19.06.1945 und die damit einhergehende politische Einflussnahme ist somit der Anfang der sozialistischen Entwicklung in der DDR . Die Vorbereitung einer Einparteienherrschaft unter dem Vorbau einer politischen Programmatik, die auf eine sozialistische Wirtschaft und Gesellschaft hinarbeitete, gipfelte am 21./22.4.1946 mit der Gründung der SED durch den Zusammenschluss der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) und der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD). Diese Entwicklung wurde als „Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse“ bezeichnet, denn die SED nannte sich selbst eine „politische Organisation der deutschen Arbeiterklasse und aller Werktätigen“( Furtak,1979, S.75) und meldete ihren Führungsanspruch als „zielklare, geschlossene, kampfgestählte, marxistisch-leninistische Partei“ an.
Das politische System der DDR war im weiteren Verlauf der Entwicklung gekennzeichnet durch den Ausbau eines bürokratisch-administrativen Systems, welches alle gesellschaftlichen Bereiche durchdrang. Auch die wirtschaftspolitischen Entscheidungen oblagen der SED-Führung bzw. dem Ministerrat, der durch Abgeordnete der Volkskammer gewählt wurde7.
„Im Gegensatz zur kommunistischen Gesellschaft findet sich der Ursprung der sozialistischen Gesellschaft im Kapitalismus, weshalb eigene Produktionsgrundlagen, die für den Kommunismus kennzeichnend sind, im Zuge der sozialistischen Entwicklung herbeigeführt, bzw. gestaltet werden müssen“.( Ludz und Ludz, 1985) Der Grundstein für eine ökonomische Umgestaltung wurde gelegt, indem die kapitalistischen von sozialistischen Produktionsverhältnissen abgelöst wurden. Der sozialistische Wirtschaftssektor entstand, indem der Staat die Kontrolle über die größten Fabriken, Nachrichtendienste und Transportinstitutionen übernahm (Handbuch der DDR,1984).
Nach Gründung der DDR am 7.Oktober 1949 wurde durch die SED verstärkt der Auf- und Ausbau der Wirtschaft vorangetrieben, indem längerfristige Wirtschaftspläne erstellt wurden.
Als die sozialistischen Produktionsverhältnisse sich weitestgehend durchgesetzt hatten endete diese Phase.(Cromm, J.,1998)
2.2. Die zweite Phase (1961 bis 1970)
Die „Aufbauphase des Sozialismus“ löste die „Übergangsperiode“ ab und wurde auf dem 4. Parteitag der SED (1963) präzisiert, indem die weiteren Ziele in der „Vervollständigung“ Sozialismus gesehen wurden. Dazu gehörte die „Steigerung von Produktion und Arbeitsproduktivität“ und die Beachtung der Interessen des Volkes und der „Bedürfnisse der Werktätigen“(Parteiprogramm der SED zit. nach Handbuch der DDR, S.1174)
Die Verbesserung der Lage der Arbeiterklasse und der Genossenschaftsbauern durch Verkürzung der Arbeitszeit und Verlängerung des Grundurlaubs, der Ausbau des Bildungswesen und die „Förderung des sozialistischen Bewusstseins“ 7 waren als Ziele nur zusammen mit einer weiteren Erhöhung der Produktivität möglich.
Als das ZK der SED 1970 verlauten ließ, dass die Vorstellungen des wirtschaftlichen Entwicklungstempos zu hoch angesetzt gewesen waren (Tietze, 1989,zit. nach Cromm, J.,1998), begann die 3. Phase.
2.3. Die 3. Phase ab 1971
Die Merkmale dieser Phase bilden zugleich den Hintergrund für eine nähere Betrachtung der Sozial- und Familienpolitik der 70er Jahre und sind deshalb im Kontext der vorliegenden Arbeit von entscheidender Bedeutung.
Um die Defizite in der Wirtschaft mit einer weiteren Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft8 zu vereinbaren, wurde das neue Konzept von der „Einheit der Wirtschafts- und Sozialpolitik“ propagiert, indem die Wirtschaft als „Mittel zum Zweck“ für die „immer bessere Befriedigung der wachsenden [...] Bedürfnisse des Werktätigen Volkes“ erklärt wurde (ZK,1971, S.62). Um der Bevölkerung der DDR auf dieser Grundlage Erfolge im wirtschaftlichen Sektor als greifbare Erfolge des Sozialismus vorzuweisen, wurden Tarife, Dienstleistungen, Waren des Grundbedarfs staatlich subventioniert. Somit meint die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik gleichzeitig ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis : „Wirtschaftlicher Fortschritt wird als Vorraussetzung des sozialen Fortschritts verstanden, sozialer Fortschritt als Vorraussetzung und Stimulus für wirtschaftliche Erfolge angesehen.“10 Im Zuge dieser Veränderungen wird der Grundstein für eine sozialistische Sozialpolitik gelegt. Das folgende Kapitel geht detailliert auf die Ursachen und Notwendigkeiten dieser politischen Interventionen ein.
3. Die Sozialpolitik der DDR
In den 50er Jahren wurde Sozialpolitik als „dem Sozialismus wesensfremd“ abgelehnt. Es wurde unterstellt, diese Art von Politik „kuriere nur an den Symptomen einer durch und durch kranken Gesellschaftsordnung, anstatt die Gesellschaft von Grunde auf umzuwandeln.“ 9.Das Aufgabenfeld der Sozialpolitik wären also Probleme, die erst durch Grundwidersprüche in der Gesellschaftsform entstünden.(Leenen, W.R. ,1977) Weil Sozialpolitik damit als „spezifisches Phänomen des kapitalistischen Systems“ deklariert wurde, verschwand der Begriff „Sozialpolitik“ deshalb zunächst für nahezu 15 Jahre aus den offiziellen Sprachgebrauch von Wissenschaft und Politik.(Fußnote: Widerspruch, denn die Reorganisation der sozialen Sicherung fällt genau in diese Zeit...) Hier wird deutlich, dass die Abgrenzung zur alten Gesellschaftsformation des Kapitalismus in der ersten Phase des Sozialismus auf alle politische Disziplinen ausgedehnt wurde.
Die Notwendigkeit des verstärkt antikapitalistischen Propaganda erklärt sich damit, dass für die Einführung sozialistischer Produktionsverhältnisse eine ideologische Basis geschaffen werden musste. Diese überzeugte von der Überlegenheit des Sozialismus eben auch durch die Abwertung anderer Wirtschaftsformen .(Cromm,J., 1998)
Die ideologische Vorbehalte gegen eine sozialistische Sozialpolitik lösten sich ab Mitte der 60er Jahre, bzw. zu Anfang der 2. Phase des Sozialismus mehr und mehr auf. Um eine weitere Produktivitätssteigerung zu erreichen, sollte „das Einzelinteresse in Einklang mit einem gesamtgesellschaftlichen Interesse gebracht werden“ .(Cromm, J.,1998, S. 278)
Zu diesem Zweck war es unumgänglich, den Mensch mit „seinen materiellen Bedürfnissen und die Entfaltung seiner Persönlichkeit durch sozialpolitische Maßnahmen in den Mittelpunkt der Wirtschaftspolitik zu stellen . Sozialpolitik wurde in der darauffolgenden Zeit vor allem zur „Politik der sozialen Sicherung10 “, darüber hinaus gehende Aufgaben wurden als Beseitigung von „Relikten der kapitalistischen Vergangenheit“ interpretiert .(Handbuch der DDR,1984) Diese rechtliche Sicherung von Mindestbedingungen in den Bereichen Arbeit, Gesundheit, Wohnung, Erziehung und Bildung, die Gewährung von Mindesteinkommen und Mindestrenten, zählten zu den sozialpolitischen Errungenschaften in den 60er Jahren (Handbuch der DDR,1984).
Die Erkenntnis, dass offenbar unabhängig vom Gesellschaftssystem ein Bedarf an sozialpolitischer Einflussnahme besteht, weil im Verlauf des Lebenszyklus oder schicksalsbedingt individuelle Bedürftigkeit und Leistungsfähigkeit auseinanderfallen, führte am Ende der 60er Jahre zur offiziellen Anerkennung der Notwendigkeit einer Sozialpolitik11.
Diese sozialen Probleme seien aber ausschließlich von „nicht-antagonistischem“ Charakter und Folge des sozialen Wandels oder „unerwünschter Nebeneffekte planvollen Handelns“(Handbuch der DDR,1984).
Die Existenz von sozialen Problemen in der DDR wurde also eingeräumt und damit eine wesentliche ideologische Wendung vollzogen.
Auf dem 8. Parteitag der SED 1971 wurde beschlossen, die „sozial-integrativen Möglichkeiten der Sozialpolitik zu nutzen“.
Um die Einheit von technischem Fortschritt und Lebensstandard aufzuzeigen, verwies die SED auf die „Einheit der Wirtschafts- und Sozialpolitik“.
Damit wird ein Übergang sichtbar, der mit der 3. Phase des Sozialismus in Zusammenhang steht: Sozialpolitische Leistungen wurden auf dieser Basis in hohem Maße an für die Gesellschaft nützliche Arbeits- Produktionsprozesse gebunden . Cromm sieht die Hintergrunde dafür in den größer werdenden Defiziten der Wirtschaft gegen Ende der 60er Jahre und der daraufhin erforderlichen Neukonzeption bzw. Umstrukturierung der ideologischen Basis um Reformen im wirtschaftlichen Sektor zu legitimieren12.
Im Gegensatz zu dieser Theorie stellen sich die Gründe für die Notwendigkeit einer verstärkten Sozialpolitik nach Obertreis (1986, S. 288) wie folgt dar: „Durch das „neue ökonomische System der Planung und Leitung“, kurz NÖSPl sollte eine größere Selbständigkeit der Betriebe vor dem Hintergrund eines industriellen Übergangs vom extensiven zum intensiven Wirtschaftswachstum herbeigeführt werden. Gleichzeitig sollte das „Prinzip der materiellen Interessiertheit“ zum Leitmotiv sowohl auf betrieblicher als auch auf persönlicher Ebene avancieren.
Dem so geschaffenen ökonomischen Schub und den damit einhergehenden materiellen Unterschieden , die von vielen als ungerecht empfunden wurden, musste eine korrigierende, sozial ausgleichende Instanz entgegengesetzt werden.“
Die ideologische Mobilisierung der Werktätigen zu einer höheren Arbeitsproduktivität erfolgte demnach gleichzeitig mit der Wirtschaftsreform und war nicht deren Ausgangspunkt oder Ursache. Erst durch die Erkenntnis der Auswirkungen (wie materielle Unterschiede, größerer Selbständigkeit der Betriebe) der Wirtschaftsreformen wurde die Notwendigkeit einer sozialistischen Sozialpolitik eingeräumt. Nach Schmunck, G., (1974) sieht die SED dabei in der Sozialpolitik ein gesellschaftspolitisches Instrument zur Verwirklichung ihrer politischen Ziele. Die Steuerungsfunktionen der Sozial- bzw. Familienpolitik sollen deshalb im folgenden Abschnitt ausführlich dargestellt werden.
4. Die Familienpolitik der DDR
4.1. Die Anfänge der sozialistischen Familienpolitik
Obertreis gibt als Ausgangspunkt für erste sozialpolitische Schritte auf dem Gebiet der Familienpolitik den 7. Parteitag der SED vom17. - 22. April 1967 an. Walter Ulbricht wies dort der Sozialpolitik der DDR offiziell die Aufgabe zu, „solche Arbeits- und Lebensbedingungen zu schaffen, die der Entwicklung aller Bürger und der Erhaltung und Förderung der Arbeitskraft dienen13.Doch schon auf dem 6. Parteitag der SED auf dem der „Sieg der sozialistischen Produktionsverhältnisse“ verkündet wurde, beschloss die Parteiführung, den Ausbau und die Vervollkommnung der juristischen Normen für das gesellschaftliche Zusammenleben der Menschen als politisches Ziel zu verwirklichen .
1968 wird das Recht auf Förderung der Familie in die Verfassung der DDR aufgenommen (Art. 38, Abs.1)
Die Familienpolitik der 70er Jahre wurde maßgeblich vom Inkrafttreten des Familiengesetzbuches am 20.Dezember 196514 geprägt, da die Umsetzung der darin beschriebenen Förderungsmaßnahmen von Ehe und Familie in diese Zeit fielen.
Das Familiengesetzbuch und die vorangestellte Präambel15 stellt keine Sammlung von Rechtsnormen im üblichen Sinne dar, sondern ist vielmehr eine weitreichende Definition der Familie im Sozialismus, die das theoretische Familienkonzept repräsentieren soll.(Cromm, J.,1998)
Die Aufgaben des FGB sollten darin bestehen, die Familienbeziehungen in der sozialistischen Gesellschaft zu fördern und „jedem Bürger...Orientierung für die Gestaltung seiner Ehe und Familie“ zu geben.(FGB der DDR, 1971, S.2)
Die ideologische Komponente bildet einen Schwerpunkt bei der Familienpolitik der DDR, da das popagierte Bild eines idealen, einheitlichen sozialistischen Familientypus den Hintergrund für die politischen Maßnahmen darstellt, auf dessen Basis sie begründet und legitimiert werden. Mehrere Autoren, die sich mit diesem Thema befasst haben16, verweisen auf Unterschiede zwischen Ideal und alltäglicher Wirklichkeit in der DDR, sowie zwischen offiziellen und inoffiziellen Informationen und Darstellungen hinsichtlich der Familienpolitik nach dem FGB(siehe Kapitel 4.3). Die charakteristischen Merkmale einer sozialistischen Ehe und Familie lt. FGB sollen im folgenden Abschnitt dargestellt werden.
4.2. Die sozialistische Familie lt. FGB
Die Präambel des FGB bezieht sich im ersten Teil auf die Stellung der Familie in der sozialistischen Gesellschaft der DDR.
Die Familie wird als „kleinste Zelle der Gesellschaft“ beschrieben, welche „in der Deutschen Demokratischen Republik große gesellschaftliche Bedeutung“ hat . Weiterhin hätten „Ehe und Familie großen Einfluss auf die Charakterbildung der heranwachsenden Generation ..“ .(FGB der DDR (1971),S.19) Auch in der kommentierten Fassung des FGB liegt hierbei die Betonung auf der Bedeutung der Familie für die Gesellschaft, woraus sich ableiten lässt, dass familienpolitische Maßnahmen darauf abzielten, die Familie zur Erfüllung der sozialistischen Ziele nutzbar zu machen.
Gleichberechtigungsprinzips“. (Handbuch der DDR,1984) - lt. Statistik betrug die Anzahl der Einrichtungen zur Kinderbetreuung
4.2.1. Zum Verhältnis von Familie und Gesellschaft
In der Theorie des Sozialismus wird ein besonders enges Verhältnis zwischen der Abhängigkeit der Familie von der Gesellschaftsverfassung und der Rückwirkung der Familie auf die Gesellschaft angenommen .
Der Sozialismus schuf laut FGB die Grundlage dafür, dass sich neuere und höhere Formen des zwischenmenschlichen Zusammenlebens herausbilden konnten, in dem die Familie in Form eines einheitlichen sozialistischen Familientypus, keinen von der Gesellschaft getrennten Lebensbereich darstellt, sondern nun vollständig in diese integriert sei.
Die Familie dient nicht mehr als Rückzugsbereich, weil die Mitglieder diesen Schutz in der von Ausbeutung und Unterdrückung freien sozialistischen Gesellschaft nicht mehr brauchen17.(Grandke, A.(1970)zit. nach Cromm, J.,1998.)
Die Tatsache, dass der familiale Kinderwunsch mit den demographischen Zielen der sozialistischen Gesellschaft übereinstimme und beide an deren Realisierung interessiert seien steht als Beispiel dafür, dass das Verhältnis zwischen Familie und Gesellschaft durch die grundlegende Übereinstimmung der Interessen gekennzeichnet ist 16. Die Familie trägt außerdem zur Verwirklichung der sozialistischen Gesellschaft bei, indem die „Entfaltung der Persönlichkeit der Gesellschaftsmitglieder“ ihre Hauptaufgabe darstellt.
Busch (Busch, F.(1972), zit. nach Cromm, J.,1998) äußert sich kritisch zu der hervorgehobenen Bedeutung der Familie, indem er annimmt, dass damit der im zunehmenden Maße beobachteten Privatheit begegnet werden sollte und auf der anderen Seite die Familie als Mittel zur Verhaltensbeeinflussung ihrer Mitglieder entdeckt wurde.
Dabei ist es von großer Bedeutung, ob die Familie „funktioniert“, d.h., ob sie ihre Funktionen erfüllt.
4.2.2. Die Funktionen der sozialistischen Familie
Den Beitrag für die Entwicklung der Gesellschaft leistet eine Familie durch die Erziehung der Kinder, durch die Arbeit und durch sonstige künstlerisch-geistige Aktivitäten.
Die familialen Funktionen unterliegen einem historischen Wandel und sind mitbestimmt durch die politischen und ökonomischen Ziele der jeweiligen Gesellschaft. Auf jeden Fall ist die Funktion der Familie auch in der Reproduktion zu sehen17. Runge18 sieht die Reproduktionsfunktion der Familie darin, „Kinder so heranwachsen zu lassen, dass sie späterhin die Elterngeneration strukturell und funktionell ablösen können. Über ihre Herkunftsfamilien werden Kinder in die jeweilige soziale Gruppe, Schicht und Klasse integriert. Die soziale und kulturelle Reproduktion der Gesellschaft ist auf diese Weise garantiert.“
In den Ziel- und Aufgabenstellungen der sozialistischen Gesellschaft, bzw. in allen Tätigkeiten der Familienmitglieder zur Realisierung dieser Ziele und Aufgaben ist die Funktion der sozialistischen Familie zu sehen.(Programm der SED, zit. nach Cromm, J.) Die Hauptfunktion der Familie in der sozialistischen Gesellschaft ist demnach die Erziehung der Eltern und Kinder zu sozialistischen Persönlichkeiten. Die bio-soziale Funktion, welche zum einen die Zeugung und Geburt von Kindern umfasst und zum anderen die nicht auf dem Willen zur Fortpflanzung beruhende Befriedigung sexueller Bedürfnisse, soll ein natürlicher Bestandteil der sozialistischen Familie sein.
Ihr wird Rechnung getragen, indem zum einen die stabile Zwei- bis Dreikindfamilie propagiert wird, andererseits die Abtreibung ab 197219 legalisiert wurde und hormonelle Verhütungsmittel für alle Frauen kostenlos zur Verfügung standen. Die „bewusste Elternschaft“ wurde als Errungenschaft des Sozialismus verkündet, indem die Menschen nun frei von gesellschaftlichen, religiösen und ökonomischen Motiven ihrem Wunsch, Kinder zu bekommen, nachgehen konnten. Diese Maßnahmen sollten nicht nur Ausdruck der Gleichberechtigung der Frau sein, sondern die Entscheidung für ein Kind als bewussten Akt der eigenen Selbstverwirklichung darstellen, der den gesellschaftlichen Erwartungen entsprach.(Cromm, J.,1998)
Im Sozialismus waren Kinder für das Zustandekommen eines Familienlebens von wesentlicher Bedeutung und stellten eine Ergänzung der Persönlichkeitsentwicklung der Eltern dar.
Die Einflussnahme auf die Familiengröße zählte zu den Aufgaben des Staates, da die Familiengröße für den Bestand und das Wachstum der Gesellschaft entscheidend ist. Die konkreten Familienpolitischen Maßnamen zur Unterstützung kinderreicher Familien zeichnen dabei das gesellschaftliche Leitbild.
Das Familiengesetz leistet die ideologische Arbeit für die Verbreitung der gewünschten Zwei- und Dreikindfamilien , indem dort von einem für Gesetzestexte recht untypischen und präzisen Stilmittel der Widerholung gebrauch gemacht wird. Cromm wertet dies als Versuch, Einstellungen ins Bewusstsein überführen zu wollen und auf ihre Verinnerlichung hinzuwirken20,während Obertreis und andere Autoren keine Stellung zu diesem Aspekt beziehen.
Die ökonomische Funktion der Familie besteht in der Existenzsicherung der einzelnen Familienmitglieder.
Die erwachsenen Mitglieder der Familie sind Produzenten, wobei in der sozialistischen Gesellschaft Mann und Frau gleichermaßen durch ihre Arbeitstätigkeit zur materiellen Absicherung der Familie beitragen.
Außerdem entwickelt und bestimmt die Familie auch weitgehend die Formen der Bedürfnisbefriedigung, im Sozialismus wird die Konsumtion von materiellen Gütern in diesem Zusammenhang jedoch nicht als Anhäufung von Privateigentum verstanden, sondern als Verbesserung der familiären Lebensbedingungen zum Beispiel durch ein hohes Niveau der Haushaltsausstattung.(Handbuch der DDR)
Arbeitsleistungen in Form von Versorgungsleistungen an Kindern, kranken und alten Familienmitgliedern zählen auch zum qualitativen Arbeitsvermögen einer Familie . Das im Sozialismus geltende Prinzip der Verteilung nach der Arbeitsleistung wird durch Zuschüsse an die Familien aus gesellschaftlichen Fonds verwirklicht. Familien mit Kindern müssen demnach nur 3 - 5% ihres Einkommens für die Miete aufwenden und die Aufwendungen für Versorgung, Betreuung und Ausbildung der Kinder sind sehr gering.(Obertreis, G.,1986)
Die geistig-kulturelle Funktion der Familie umfasst die Erziehung und Sozialisation der Familienmitglieder durch Interaktion, Kommunikation und Freizeitverhalten der Familienmitglieder.
Die herausragende Stellung gerade der geistig-kulturellen Familienfunktion ergab sich nach Gysi 21 aus ihrer Bedeutung für die Reproduktion der ideologischen Verhältnisse in der DDR.
Familienpolitisch konnte auf diesem Gebiet nur rein ideologisch Einfluss genommen werden.
Zahlreiche Kinderbücher, die sozialistisches Gedankengut in kindgerechter Form beinhalteten, sowie Beratungsstellen und Veröffentlichungen zur Kindererziehung sollten den Prozess der Entfaltung der sozialistischen Persönlichkeit begleiten. Es sei aber erwähnt, dass politisch-ideologische Beeinflussung durch die Eltern nicht nur auf Grund des Vorlebens und der Gespräche , sondern auch durch das Einwirken auf die Kinder, gesellschaftlichen Institutionen22 beizutreten und die Arbeit der Schule zu würdigen, vollzogen werden konnte.
Die Funktionen der sozialistischen Familie und ihre Bedeutungen bilden die Grundlage für die im Familiengesetzbuch formulierte Art familialen Zusammenlebens. Ohne familienpolitischen Einfluss in Hinblick auf die Verwirklichung der sozialistischen Gesellschaftsziele hätten die vielfältigen Funktionen von Familie auch gegensätzliche Ideologische Werte erzeugen und verfestigen können, zumal der staatliche Einfluss auf das innerfamiliäre Klima nach Cromm und Obertreis nicht groß bzw. in der Literatur umstritten ist.
4.3. Die weitere Entwicklung der Familienpolitik
Zur Zeit der Verabschiedung des FGB war eine starke Zunahme der Teilzeitarbeit von verheirateten Frauen, sowie ein rapider Rückgang der Geburtenraten zu verzeichnen.
Die seit 1969 fortdauernde Disproportion zwischen Geburtenrate und Sterberate führte zu einem Mangel an erwerbsfähiger Bevölkerung (siehe Tabelle II.), gleichzeitig stellten die teilzeitbeschäftigten Frauen zu dieser Zeit die letzte Reserve am Arbeitsmarkt dar.
Seit 1970 wurde die Zahl der Kinderbetreuungseinrichtungen ständig erhöht. Ab 1972 lag die Versorgung mit Kinderkrippenplätzen bei 90% bis 100% (Großstadt-Land- Gefälle).
Kindergärten für 3-6 jährige Kinder, sowie Horte zur Betreuung der Schulkinder nach dem Unterricht und Schulessen bis zur 12. Klasse waren staatlich gestützte Maßnahmen, für die die Eltern nur einen geringen Beitrag entrichten mussten.
Die Schwangerschaftsunterbrechung wurde 1972 legalisiert.
Seit 1972 wurde außerdem der Schwangerschaftsurlaub nach der Entbindung von 6 auf 20 Wochen verlängert, die staatliche Geburtshilfe auf 1000 Mark erhöht und zweckgebundene, zinslose Kredite an junge Ehepaare unter 26 Jahren gewährt, wobei je nach Anzahl der geborenen Kinder um 1000-5000 Mark bei der Rückzahlung erlassen wurden.
Das Kindergeld wurde auf 50 Mark pro Kind festgesetzt (was bei einem durchschnittlichen Nettomonatseinkommen von Frauen von 700 Mark einen hohen Betrag darstellt). Studentinnen und Auszubildende mit Kind wurden seit 1972 finanziell gestützt und gefördert.
Vollbeschäftigte Mütter mit mehr als einem Kind brauchten nur 40 Stunden pro Woche, statt bisher 43,5 Stunden pro Woche zu arbeiten und erhielten gleichzeitig einen höheren Mindesturlaub. Der monatliche Haushalttag für Mütter ab 18 Jahren zählte ebenfalls zu den Errungenschaften der sozialpolitischen Maßnahmen von 1972.
1976 wurde das Babyjahr eingeführt, wonach sich berufstätige Mütter im Anschluss an den sog. Wochenurlaub bis zur Vollendung des 1. Lebensjahres ihres Kindes von der Arbeit freistellen lassen konnten.
4.4. Die Hintergründe der familienpolitischen Maßnahmen in den 70er Jahren
Im letzten Abschnitt wurde deutlich, dass sich familienpolitische Maßnahmen sowohl theoretisch als auch praktisch in erster Linie an Frauen richteten. Ohne dass es klar benannt wurde, stellten diese familienpolitischen Maßnahmen vom ursprünglichen sozialistischen Emanzipationskonzept dar, in welchem Frau und Mann sich Kindererziehung und Haushaltsaufgaben teilen und die Kinderbetreuung von der Gemeinschaft organisiert wird.(Erler,G. u.A.,1991)
Die Einrichtungen der Kinderbetreuung waren teilweise recht starker Kritik ausgesetzt. Die Enteignung der Mutter-Kind Beziehung durch allzu lange Abwesenheit der Kinder wurde von den Familien als mitunter als stark belastend wahrgenommen23. Gleichzeitig gab es Probleme mit der Qualität der Kinderbetreuung. Da Erzieherinnen nicht gut bezahlt wurden, herrschte Personalmangel, was sich auf den Betreuungsschlüssel besonders in den Kinderkrippen auswirkte. Außerdem führte die Gruppenerziehung von Säuglingen und Kleinkinder zu gesundheitlichen Belastungen für diese.Mit Einführung des bezahlten Babyjahres konnten diese Missstände aufgefangen werden.
5. Die Erwerbstätigkeit der Frauen in den 70er Jahren
Die Gewinnung der Frau als Arbeitskraft im Produktionsprozess bei gleichzeitiger Erhöhung der Geburtenrate, wie es das Ziel der politischen Führung seit den 60er Jahren proklamiert hatte, war nur möglich, wenn sich Beruf und Familie miteinander vereinbaren ließen und der Anreiz, mehrere Kinder zu bekommen, verstärkt wurde. Um dies zu gewährleisten, sollten sich Mann und Frau die Hausarbeit teilen, während der Staat die Kinderbetreuung während der Abwesenheit der Eltern übernahm.
Die Gleichberechtigung im beruflichen, wie im privaten Bereich, bildete dafür die Grundlage.
Dem Verlangen der Frauen nach finanzieller Unabhängigkeit, Entlastung und beruflicher Karriere wird bei der Bevölkerungspolitik der DDR Rechnung getragen, indem die Geburt eines oder mehrerer Kinder kein Grund mehr war, dass Frauen sich aus der Arbeitswelt zurückzogen.
5.1. Die familienpolitischen Maßnahmen aus der Perspektive der Gleichberechtigung von Frau und Mann
Die Arbeitsgruppe um Erler gibt an, dass es seit Einführung des Babyjahres im Durchschnitt 90% der Mütter in Anspruch nahmen.
Gleichzeitig werden die Möglichkeiten einer bezahlten Freistellung von der Arbeit bei Krankheit des Kindes voll ausgeschöpft.
Hierin kommt die Doppel- und Dreifachbelastung (Vollzeitberuf, Familie und zeitintensive Alltagsbesorgungen) der Frauen zum Vorschein, die davon zeugt, dass die Frauen in der DDR in der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung der Familie nicht gleichberechtigt waren.
Nach der Einführung des Babyjahres und der Freistellung von der Arbeit im Krankheitsfall des Kindes wurde die Gleichberechtigung der Frauen in Beruf und Qualifikationsprozessen wesentlich erschwert.
Es zeigt sich eine eindeutige Korrelation in der Leitungspyramide: je höher der Rang, desto geringer der Frauenanteil, da die Frau als Arbeitskraft öfter durch familienbedingte Freistellung ausfiel.
Zur Frage der Gleichberechtigung der Frau hatte Erich Honnecker schon auf dem VIII. Parteitag der SED 1971 verkündet, sie sei verwirklicht, die Realität widerspricht dem aber.
Nach Obertreis(1986) setzte es sich zum Beispiel nicht durch, diese Erleichterungen alternativ für Mütter oder Väter anzubieten , um damit einen Beitrag zur Überwindung der Rollenklischees zu leisten.
Die Arbeitsgruppe um Erler gibt allerdings an, dass das Babyjahr und die finanzielle Unterstützung in sog. „begründeten Fällen“ auch dann gewährt wird, wenn die Großmutter oder der Ehemann diese Aufgabe übernimmt, wobei Väter das Babyjahr „so gut wie gar nicht“ und Großmütter14 nur zu 2% dies in Anspruch genommen hätten.
(Erler u.a.(1991), S.9)
Die Unvereinbarkeit von voller Berufstätigkeit, Familienleben und der Aufwendigkeit täglicher Besorgungen prägte das Leben der Mütter in der DDR maßgeblich, die familienpolitischen Maßnahmen schafften zwar Erleichterungen, insbesondere finanzieller Art, doch von innerfamilialer Gleichberechtigung konnte zu dieser Zeit noch nicht die Rede sein. Trotz dieser Schwierigkeiten wurde an der Richtung der Familienpolitik unbeirrt festgehalten.
Die Frauen sollten auf jeden Fall in den gesellschaftlichen Arbeitsprozess einbezogen werden. Das Problem der verbreiteten Teilzeitbeschäftigung steht dem zu Anfang der 70er Jahre noch entgegen.(Obertreis, G.,1986)
5.2. Das Problem der Teilzeitbeschäftigung der Frauen
1970 arbeiteten 32,5% aller berufstätigen Frauen verkürzt.( Kuhrig, H.,1982, zit.nach Obertreis, G.,1984)
In den gesetzlichen Bestimmungen des Arbeitsgesetzbuches von 1961 wird die Teilzeitbeschäftigung als Übergangslösung beschrieben, die den nichtberufstätigen Frauen den Übergang ins Berufsleben erleichtern soll.
Als jedoch zu Anfang der 70er Jahre mehr und mehr auch vollzeitbeschäftigte Frauen zur Teilzeitarbeit übergehen, beschließt die Parteiführung der SED gegen diese Tendenz anzugehen. Durch verstärkte Hinweise auf den volkswirtschaftlichen Verlust und der Verkündung, dass es zu diesem Arbeitsverhalten keinerlei Anlässe gäbe, weil „sich die Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen um Sozialismus von Jahr zu Jahr verbessern würden“15 sollte den Frauen zu Bewusstsein gebracht werden, wie schädigend und unrechtmäßig ihre Halbtagstätigkeit sei.
Ideologisch wird verstärkt das Bild der gleichberechtigten Frau hochgehalten, die sich mit ihrer Vollzeitbeschäftigung identifiziert und dafür gesellschaftliche Achtung und Ehrung erfährt .(Obertreis, G.,1986)
Der Hintergrund dieser Gegenmaßnahmen ist aber nur sekundär in der Verwirklichung der Gleichberechtigung zu sehen, vielmehr stellten die teilzeitarbeitenden Frauen in den 70er Jahren die letzte nennenswerte Reserve am Arbeitsmarkt dar. Zum Appell an die Frauen, sich die Gleichberechtigung durch Aufnahme einer Berufstätigkeit bzw. Qualifikation für diese zu erwerben äußert sich Obertreis kritisch, „dass dieser Frauenpolitik keine familienpolitischen Intentionen zu Grunde lagen, sondern diese rein ökonomisch bedingt war“.
Doch nicht nur der Arbeitskräftemangel der 70er Jahre prägte die Familienpolitik.
Die prekäre demographische Lage war nach Cromm16 der zweite ausschlaggebende Punkt für das hohe Maß an Familienförderungsmaßnahmen.
5.3. Die Familienpolitik der DDR als Bevölkerungspolitik
Hier wird deutlich, dass die meisten familienpolitischen Maßnahmen in den 70er Jahren bevölkerungspolitische Maßnahmen waren, welche die Herausbildung einer stabilen Zwei- bis Dreikindfamilie zum Ziel hatten .
Die Zahl der Lebendgeborenen war seit 1964 rückläufig gewesen und seit 1968 war die einfache Bevölkerungsreproduktion nicht mehr sichergestellt.
Auch nach der Verabschiedung des Familiengesetzbuches nahm die Anzahl der Geburten unbeirrt ab.
Erst ab 1975 stieg die Zahl der Kinder wieder an.(Statistisches Jahrbuch der DDR, 1985) Cromm24 begründet diese Entwicklung mit dem Erfolg der familienpolitischen Maßnahmen der 70er Jahre .
Besonders die Unterstützung kinderreicher Familien ,welche 1975 gesetzlich vorgeschrieben wurde, überzeugte die Familien sowohl materiell als auch ideell von den Vorteilen einer größeren Anzahl der Kinder.
Auch die seit 1972 praktizierte Förderung junger Eheleute unter 26 Jahren trug erste Früchte. Obertreis25 gibt als weitere Gründe für den Anstieg der Geburten die bestehende Wohnungsknappheit an .
Seit 1972 bekamen Verheiratete bevorzugt Wohnraum zugesprochen, wodurch sich junge Leute in der Lage befanden, nur durch Heirat zu einer Wohnung zu kommen.
Die finanzielle Förderung von Müttern in Ausbildung und Studium, der hohe Versorgungsgrad mit Betreuungseinrichtungen und die finanzielle und zeitliche Unabhängigkeit erlaubten es den Frauen, ihrem Kinderwunsch ohne Bedenken nachzukommen.
Auch das propagierte Bild von einer gesicherten, strahlenden, sozialistischen Zukunft für die nächste Generation trug nach Gumpel,1998 zu dieser positiven Entwicklung bei. So zeigt die Familienpolitik der 70er Jahre ersichtliche Erfolge.
Betrachtet man diese Aussage unter der von Erler dargestellten Tatsache, dass die Finanzierung aller sozialpolitischer Maßnahmen seit den 70er Jahren nicht mit den Betrieben und der Volkswirtschaft abgestimmt waren und der Staat sie sich wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage gar nicht leisten konnte, so war die beschriebene Familienpolitik der DDR nur möglich, weil die Finanzierung nicht direkt an die Wirtschaft gekoppelt war.
6. Zusammenfassung und Schluss
Zur Herbeiführung sozialistischer Verhältnisse in der DDR wurde ideologisch begründetes Vertrauen in die Plan- und Steuerbarkeit sozialer Prozesse gesetzt.
Die Familienpolitik der 70er Jahre bildete hierbei die Grundlage, wenngleich sie aber nicht isoliert vom sozialistischen System der DDR betrachtet werden kann. Die Bevölkerungspolitik als wichtigstes Element der Familienpolitik basierte auf der Herausbildung eines sozialistischen Familientypus, bei dem die Gleichberechtigung der Frau eine tragende Rolle spielte.
Ökonomische Gründe waren sowohl bei der Gleichberechtigungspolitik als auch bei der Bevölkerungspolitik die leitenden Intentionen.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch staatliche Unterstützung und Absicherung der Kinderbetreuung kennzeichnen die Familienpolitik der DDR.
Auf die familienpolitischen Transfers haben die Adressaten mit Geburten ´reagiert´, das Ziel Anhebung der Geburtenrate wurde erreicht.
Am Beispiel der DDR wurde deutlich, dass auch Idealbilder durch verstärkten Propaganda Einflüsse auf Familienstrukturen haben, in dem die Mitglieder sie verinnerlichen.
Doch noch gravierender ist die Reaktion auf Förderungsmaßnahmen finanzieller Art bei Geburt eines oder mehrerer Kinder: der natürliche Kinderwunsch von Menschen in ihrer Reproduktionsphase kommt zum Tragen.
Auch dem Wunsch der Frauen nach finanzieller Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung kann auf diese Weise Rechnung getragen werden.
Auch für die Zukunft können aus der Familienpolitik der DDR in den 70er Jahren Schlüsse gezogen werden.
Durch familienpolitische Intervention auf dem finanziellen Sektor könnte auch die Geburtenrate in unserem Land wieder erhöht werden.
Eine andere Art der Einflussnahme auf die Familienbildung ist in unserem politischen System nicht zulässig.
Anhang
Literatur
Brockhaus Enzyklopädie (1986),Mannheim: Bibliographisches Institut
Cromm, J.(1998): Familienbildung in Deutschland, Wiesbaden :Westdeutscher Verlag
Einundzwanzigste Tagung zum Stand der DDR-Forschung in der BRD : Veränderungen in Gesellschaft und Politischem System der DDR-Ursachen- Inhalte- Grenzen(24.-27.Mai 1988), Köln: Verlag Wissenschaft und Politik Nottbeck
Erler,G. u.A.(1991):Ergebnisse einer explorativen Studie zu familienpolitischen Maßnahmen in der DDR. Berlin: Institut f. Erziehungswissenschaften
Familiengesetzbuch der DDR (1975), Berlin: Ministerium der Justiz
Fu rtak, R.(1979),Die politischen Systeme der sozialistischen Staaten. München: Lembert
Gumpel,W., Hrsg., (1982):Alltag im Sozialismus. Köln: Bachem GmbH
Handbuch der DDR(1984),Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen, Köln: Verlag Wissenschaft und Politik
Ludz, P. u. C.(1985):Marxismus-Leninismus. Köln: Verlag Wissenschaft und Politik
Meyers Grosses Lexikon (1993), Mannheim: Bibliographisches Institut
Obertreis, G.(1986): Familienpolitik in der DDR 1945-1980.Opladen: Leske und Budrich
Schäfer, H. (1989):Wirtschaftsgeschichte der deutschsprachigen Länder. Freiburg: Plötz
Schmunck, G.(1975):Marxistisch-leninistische Sozialpolitik. Berlin: Technische Universität
Timmermann, H.,Hrsg., (1988):Sozialstruktur und sozialer Wandel in der DDR, Saarbrücken: Verlag Rita Dadder
[...]
1 Vgl. hierzu ausführlich Cromm, J.(1998)
2 Vgl. hierzu Brockhaus-Enzyklopädie, 1986
3 Brockhaus, 1986
4 sowjetische Besatzungszone
5 vgl. auch Schneider et al .1982,a.a.O.
6 nach Cromm, J.,1998
7 vgl. dazu ausf. Schäfer, H.(Hrsg.), 1989
8 Hier wird deutlich, dass das Ideal einer kommunistischen Gesellschaftsordnung wird mehr und mehr vom Ideal einer weiterentwickelten, vollkommenen sozialistischen Gesellschaft überlagert wird. (Cromm, 1998)
10 Handbuch der DDR, 1984, S.1214
9 Handbuch der DDR, 1984
10 Soziale Sicherung meinte lt. Timmermann allerdings nicht Maßnahmen zur Sicherung des einzelnen Bürgers in „Not- und Wechselfällen des Lebens“, sondern eine Gestaltung der Verhältnisse so, dass eine gleichberechtigte Entwicklung aller Bürger ermöglicht werden kann.(Timmermann S.140)
11: Einerseits bezeichnet der Begriff Sozialpolitik in der DDR ab Ende der 60ger Jahre das Gebiet der sozialen Sicherung, andererseits wird Sozialpolitik auch als Maßnahmenkomplex definiert, der die soziale Lage der Gesamtheit bzw. der einzelnen Menschengruppen betrifft und politische Tätigkeit auf sozialem Gebiet im Allgemeinen bezeichnet.(Handbuch der DDR,1984)
12 Cromm gibt als weitere Begründung für die Notwendigkeit eines neuen Konzeptes an, dass die SED darauf bedacht war, ihren Einfluss auf die Bevölkerung zu vergrößern . (Cromm, J. ,1998.)
13 ( W. Ulbricht .“Die gesellschaftliche Entwicklung der DDR ist zur Vollendung des Sozialismus ,BLN, 1967, S.233 f., zit. nach Obertreis S.288)
14 Die mit der Ausarbeitung eines Familiengesetzbuches beauftragte Kommission legte im April 1965 den endgültige Entwurf des FGB vor. 1954 wurde der erste Entwurf eines Familiengesetzbuches vorgelegt, welcher jedoch nie in Kraft trat. Die damalige Justizministerin Hilde Benjamin begründete das Scheitern mit dem noch nicht erreichten Ziel der ersten Phase des Sozialismus und mit „Hemmnissen bei der Durchsetzung des 1965 87188 Plätze mehr als 1954, das bedeutet, dass die Anzahl um 258% gestiegen war !(dazu Tabelle I., Anhang
15 Allen neueren sozialistischen Gesetzeswerken hat der Gesetzgeber eine Präambel vorangestellt, in deren Kontext der nachfolgende Text in einen ideologischen Zusammenhang gebracht wird.
16 Obertreis, G.(1986),Erler, G. u.A.(1991), Cromm, J.(1998)
17 Widersprüchlich daran ist, dass gerade die sozialistischen Gesellschaft gekennzeichnet ist durch die Entlastung der Familie im Bereich der Erziehung und häuslichen Dienstleistungen, wonach einer Isolierung der Familie Vorschub geleistet wäre.(Storbeck, D.(1964), nach Cromm, J. a.a.O.)
16 Diese Theorie von der Einheit von Familie und Gesellschaft kann nach Cromm nur umgesetzt werden, wenn eine individualistische Absonderung der Familie vermieden wird.Hier wird staatliche Einflussnahme nötig und Cromm nimmt an, dass die Gesetzesaussage über das Verhältnis von Familie und Gesellschaft auch ein Mittel der Bewusstseinsbildung ist, um keinen Zweifel daran aufkommen zu lassen, dass das Familienrecht nicht die Aufgabe haben kann, die Einflussnahme des Staates auf die Familie zu begrenzen.(Cromm, J.: a.a.O.)
17 vgl. hierzu Cromm, J.(1998),S.369
18 Runge, I.,1987: Ganz in Familie. Gedanken zu einem vieldiskutierten Thema. Köln: Kohlhammer
19 ab dem 09. März 1972 trat das Gesetz zur Unterbrechung der Schwangerschaft in Kraft, nachdem der Schwangerschaftsabbruch bis zum 4. Schwangerschaftsmonat legalisiert wurde.
20 Cromm, J.(1998), S. 372
21 Gysi, J.(1989) zit. nach Cromm, J.
22 Ab dem ersten Schuljahr bestand für die SchülerInnen die Möglichkeit, in die Pionierorganisation „Ernst Thälmann“ als „Jungpioniere“ einzutreten . Später wurden diese SchülerInnen dann in die Organisation „Freie Deutsche Jugend“ (FDJ) aufgenommen. Das Verweigern des Eintritts in diese Organisationen zog aber repressive Konsequenzen nach sich, so dass von einem freiwilligen Beitritt nicht unbedingt die Rede sein kann. Vgl. dazu ausf. Gumpel, W.[Hrsg.],1982
23 Die Kinderbetreuung der DDR wird in der Literatur oft als Ideologische Erziehungsmaßnahme dargestellt, d.h., dass der Staat seinen Einfluss auf die Familien durch die Ideologische Persönlichkeitsbildung der Kinder ausübt. Mehr dazu in Krüger/Marotzki [Hrsg.],1994
14 Da 70% der Frauen unter 25 Jahren schon mind.1 Kind hatten, lag das Alter der Großmütter sehr oft unter dem Rentenalter und sie waren selber noch berufstätig.
15 Zitat von Inge Lange, Kandidatin des Politbüros des Zentralkomitee der SED nach Dunskus/Weichert (1975)
16 Cromm, J.,1998
24 Cromm, J.,1998
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes?
Der Text untersucht die Familienpolitik in der DDR, insbesondere in den 1970er Jahren, und analysiert sie im Kontext des sozialistischen Systems, der demografischen Entwicklung, der Rolle der Frauenerwerbstätigkeit und der ideologischen Grundlagen.
Was sind die Phasen der Entwicklung des Sozialismus in der DDR?
Die Entwicklung des Sozialismus in der DDR wird in drei Phasen unterteilt: 1. Phase von 1945 bis 1965 (antifaschistisch-demokratische Umwälzung und Schaffung der Grundlagen des Sozialismus), 2. Phase von 1961 bis 1970 (Aufbauphase des Sozialismus), und 3. Phase ab 1971 (Einheit der Wirtschafts- und Sozialpolitik).
Was ist die "Einheit der Wirtschafts- und Sozialpolitik"?
Die "Einheit der Wirtschafts- und Sozialpolitik" war ein Konzept der DDR, das die Wirtschaft als Mittel zur besseren Befriedigung der Bedürfnisse der Bevölkerung betrachtete. Es bedeutete eine gegenseitige Abhängigkeit: wirtschaftlicher Fortschritt als Voraussetzung für sozialen Fortschritt und sozialer Fortschritt als Anreiz für wirtschaftliche Erfolge.
Welche Rolle spielte die Sozialpolitik in der DDR?
In den frühen Jahren der DDR wurde Sozialpolitik als "wesensfremd" für den Sozialismus abgelehnt. Später wurde sie jedoch als Instrument zur sozialen Sicherung und zur Harmonisierung der Einzelinteressen mit den gesamtgesellschaftlichen Interessen anerkannt. Sie diente auch zur Beseitigung von "Relikten der kapitalistischen Vergangenheit".
Was war das Familiengesetzbuch (FGB) der DDR?
Das Familiengesetzbuch der DDR vom 20. Dezember 1965 war nicht nur eine Sammlung von Rechtsnormen, sondern auch eine Definition der Familie im Sozialismus. Es sollte die Familienbeziehungen fördern und Orientierung für die Gestaltung von Ehe und Familie geben. Die Präambel des FGB betonte die Bedeutung der Familie für die sozialistische Gesellschaft.
Welche Funktionen hatte die sozialistische Familie laut FGB?
Die sozialistische Familie hatte verschiedene Funktionen, darunter die Erziehung der Kinder zu sozialistischen Persönlichkeiten, die bio-soziale Funktion (Zeugung und Geburt von Kindern), die ökonomische Funktion (Existenzsicherung der Familienmitglieder) und die geistig-kulturelle Funktion (Erziehung und Sozialisation durch Interaktion und Kommunikation).
Welche familienpolitischen Maßnahmen wurden in den 1970er Jahren in der DDR ergriffen?
Zu den familienpolitischen Maßnahmen der 1970er Jahre gehörten der Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen, die Legalisierung der Schwangerschaftsunterbrechung, die Verlängerung des Schwangerschaftsurlaubs, die Erhöhung der staatlichen Geburtshilfe, zinslose Kredite für junge Ehepaare, die Festsetzung des Kindergeldes, die finanzielle Unterstützung von Studentinnen und Auszubildenden mit Kind, die Verkürzung der Arbeitszeit für Mütter und die Einführung des Babyjahres.
Welche Rolle spielte die Frauenerwerbstätigkeit in der Familienpolitik der DDR?
Die Gewinnung der Frau als Arbeitskraft im Produktionsprozess bei gleichzeitiger Erhöhung der Geburtenrate war ein Ziel der politischen Führung. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wurde durch staatliche Unterstützung und Kinderbetreuung gefördert. Die Gleichberechtigung im beruflichen und privaten Bereich sollte die Grundlage dafür bilden, doch es gab weiterhin Herausforderungen hinsichtlich der tatsächlichen Gleichberechtigung und der Doppelbelastung der Frauen.
Was war das Problem der Teilzeitbeschäftigung von Frauen in der DDR?
Die Parteiführung der SED versuchte, gegen die zunehmende Teilzeitbeschäftigung von Frauen vorzugehen, da sie die teilzeitarbeitenden Frauen als letzte nennenswerte Reserve am Arbeitsmarkt betrachtete. Es wurde ideologisch das Bild der gleichberechtigten Frau hochgehalten, die sich mit ihrer Vollzeitbeschäftigung identifiziert.
Inwieweit war die Familienpolitik der DDR auch Bevölkerungspolitik?
Viele familienpolitische Maßnahmen in den 1970er Jahren waren bevölkerungspolitische Maßnahmen, die die Herausbildung einer stabilen Zwei- bis Dreikindfamilie zum Ziel hatten. Der Rückgang der Geburtenrate sollte durch die Unterstützung kinderreicher Familien und die Förderung junger Eheleute aufgehalten werden.
- Quote paper
- Stephanie Böhm (Author), 2001, Die Familienpolitik der DDR in den 70-er Jahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102559