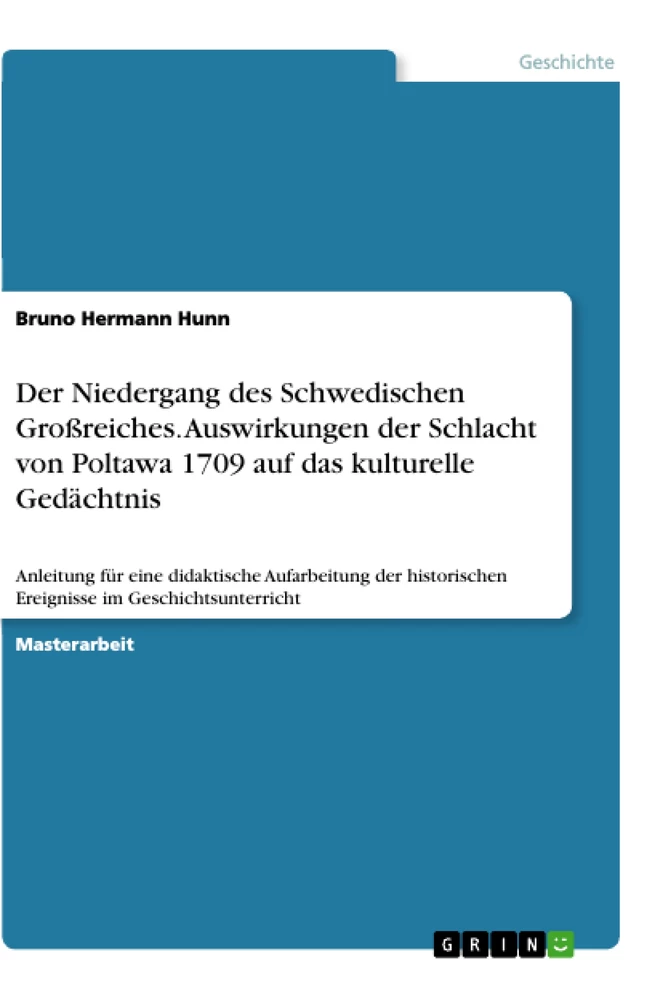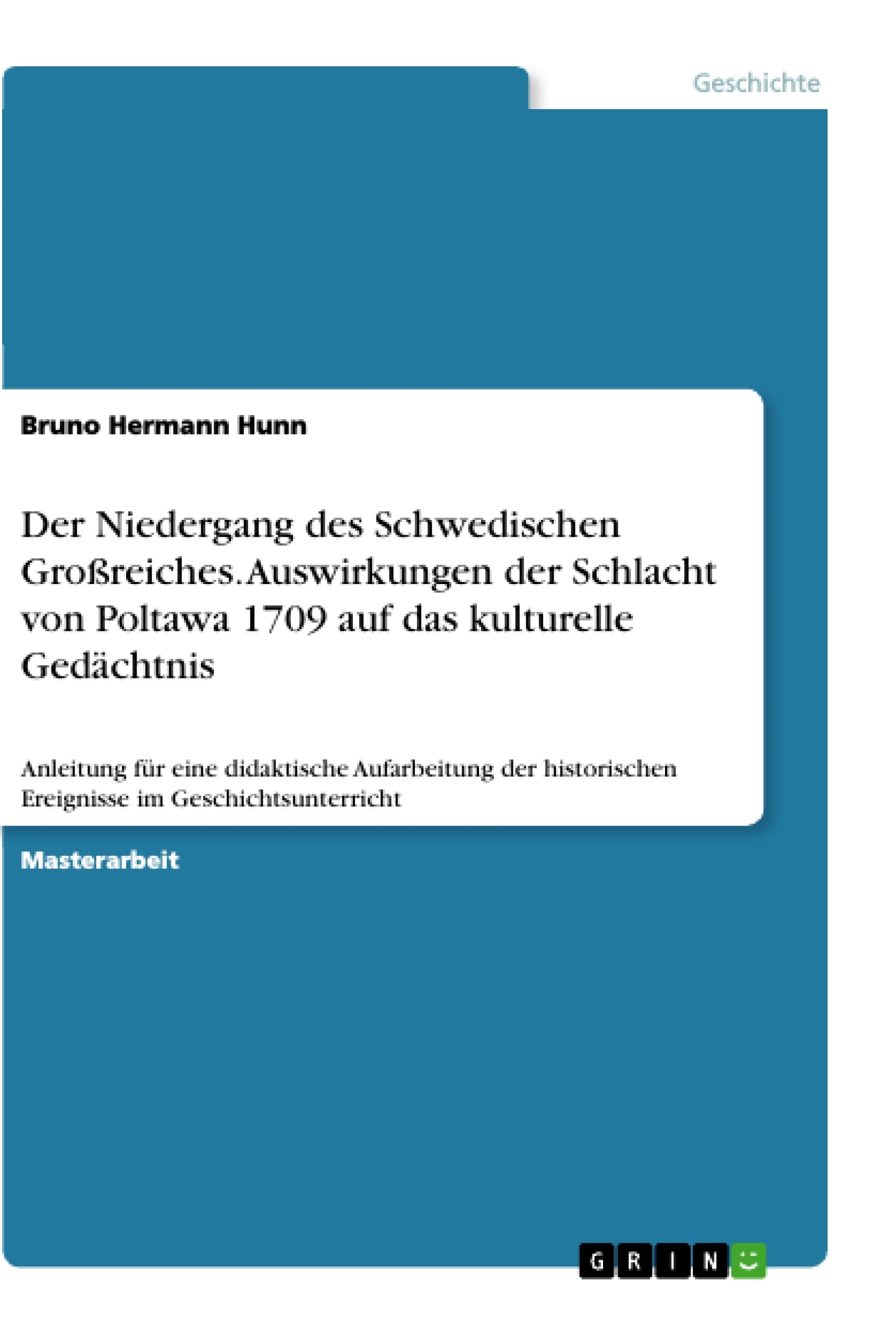Diese Forschung verfolgt zwei Ziele. Anhand des Aufstiegs sowie Niedergangs des Schwedischen Großreiches (1611-1721) und der darin eine herausragende Rolle einnehmenden Schlacht von Poltawa (1709) soll aufgezeigt werden, wie sich das kulturelle und kollektive Gedächtnis von Gesellschaften bilden. Konkret dargestellt wird dies an den heutigen Nationen Schweden, Russland und Ukraine.
Zweitens sollen sich Schülerinnen und Schüler mit einem Schlüsselereignis der europäischen Geschichte beschäftigen, welches in Mitteleuropa wenig Beachtung findet, dem Großen Nordischen Krieg, als dessen Resultat das russische Zarenreich Schweden als Großmacht ersten Ranges beerbte.
Die durch den gewaltsamen Tod des US-Amerikaners George Floyd ausgebrochenen gesell-schaftlichen Unruhen in den USA und einigen europäischen Ländern, die sich unter dem Slogan „Black Lives Matter“ zu einer internationalen Bewegung formierten, lassen in den westlich geprägten Nationen das Phänomen des Geschichtsrevisionismus beobachten. Statuen von historischen Persönlichkeiten, welche von der Gesellschaft bis anhin der öffentlichen Huldigung als würdig erachtet wurden, landen, wie in Bristol geschehen, im Hafenbecken oder wer-den musealisiert.
Es stellt sich im Angesicht solcher Vorgänge die Frage, welchen Stellenwert kann oder soll Erinnerungen zugeschrieben werden, die lange vergangene Ereignisse betreffen und erst zu einem viel späteren Zeitpunkt wieder – unter Umständen nicht ohne politische Nebenabsichten – aktualisiert werden?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aktualität, Relevanz, Aufbau
- Themenwahl
- Forschungsstand
- Zielsetzung
- Fragestellung und Teilbereiche
- Begriffe
- Großreich, Imperium, Weltreich
- Das Schwedische Reich
- Unabhängigkeit und frühe Phase
- Kampf um die Herrschaft über den Ostseeraum – dominium maris Baltici
- Der Dreißigjährige Krieg – Schwedens Aufstieg zur Großmacht
- Absolutismus und Heeresreform
- Das Schwedische Reich ab 1660
- Karl XI.
- Errichtung des Absolutismus
- Die neue Infanterie – Reformierung und Professionalisierung des Heeres
- Die Zeit der großen Siege und des Untergangs
- Peter I. „der Große“ und Karl XII. – „der Beinahe-Große“?
- Peter I. Alexejewitsch Romanow
- Karl XII. von Wittelsbach
- Gegenüberstellung
- Der Große Nordische Krieg bis 1709
- Der Russlandfeldzug
- Die Schlacht von Poltawa
- Anfangsposition
- Durchbruch der Infanterie
- Vorbereitungen zur finalen Phase
- Der Entscheidungskampf
- Flucht
- Die Auswirkungen der Schlacht bei Poltawa
- Die Schlacht von Poltawa als „Entscheidungsschlacht“?
- Unmittelbare Auswirkungen der Schlacht
- Heutiger Wirksamkeitsgrad der Schlacht von Poltawa
- Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität
- Gedächtniskonstruktionen
- Erinnern und Vergessen
- Das nationale Gedächtnis
- Kulturelles Gedächtnis
- Schweden
- Russland
- Ukraine
- Didaktischer Teil
- Lehrplan 21
- RZG 6.1, 3 Weltgeschichtliche Kontinuitäten und Umbrüche erklären
- RZG 7.2, 3 Geschichtskultur analysieren und nutzen
- Konzentration auf epochaltypische Schlüsselprobleme im Geschichtsunterricht
- Die didaktische Analyse nach Klafki
- Kooperative Lernmethode
- Definition
- Vorgehen
- Fazit
- Was sind die Auswirkungen der Schlacht von Poltawa als Entscheidungsschlacht?
- Teilbereich 1: Wie kam es zur Bildung und zum Niedergang des Schwedischen Großreiches?
- Teilbereich 2: Die Schlacht von Poltawa – Entscheidungsschlacht oder bloßes Gemetzel?
- Teilbereich 3: Wie wird historischen Ereignissen gedacht?
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Schlacht von Poltawa im Jahre 1709 und untersucht, wie sich das kulturelle und kollektive Gedächtnis von Gesellschaften bildet. Sie beleuchtet dabei die Auswirkungen der Schlacht auf Schweden, Russland und die Ukraine, als die drei Nationen, die von den Ereignissen am stärksten betroffen waren.
- Die Entstehung und der Niedergang des Schwedischen Großreiches
- Die Rolle der Schlacht von Poltawa als Wendepunkt in der europäischen Geschichte
- Die Auswirkungen der Schlacht auf die kulturelle Identität der beteiligten Nationen
- Die Bedeutung des kollektiven und kulturellen Gedächtnisses
- Die Konstruktion von Geschichtsnarrativen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung behandelt die Aktualität des Themas und stellt den Aufbau der Arbeit vor. Kapitel 2 beschreibt die Geschichte des Schwedischen Reiches von seiner Unabhängigkeit im 16. Jahrhundert bis zu seinem Niedergang im frühen 18. Jahrhundert. Dabei werden die wichtigsten Ereignisse wie der Dreißigjährige Krieg und die Einführung des Absolutismus unter Karl XI. beleuchtet. Kapitel 3 widmet sich dem Großen Nordischen Krieg und insbesondere der Schlacht von Poltawa, die als Wendepunkt des Konflikts gilt. Es werden die Hintergründe der Schlacht und ihre unmittelbaren Auswirkungen auf Schweden, Russland und die Ukraine dargestellt.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Einstufung der Schlacht von Poltawa als „Entscheidungsschlacht“ und analysiert deren Folgen für die beteiligten Nationen. Weiterhin werden die Konzepte des kollektiven und kulturellen Gedächtnisses nach Assmann und Demantowsky erläutert und anhand der Beispiele Schweden, Russland und Ukraine angewendet. Das letzte Kapitel, Kapitel 5, beinhaltet einen didaktischen Teil, der die Umsetzung des fachwissenschaftlichen Wissens in den Geschichtsunterricht aufzeigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen des Schwedischen Großreiches, des Großen Nordischen Krieges, der Schlacht von Poltawa, des Absolutismus, des kollektiven und kulturellen Gedächtnisses, der Erinnerungskultur und der nationalen Identitätsbildung.
- Arbeit zitieren
- Bruno Hermann Hunn (Autor:in), 2020, Der Niedergang des Schwedischen Großreiches. Auswirkungen der Schlacht von Poltawa 1709 auf das kulturelle Gedächtnis, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1025444