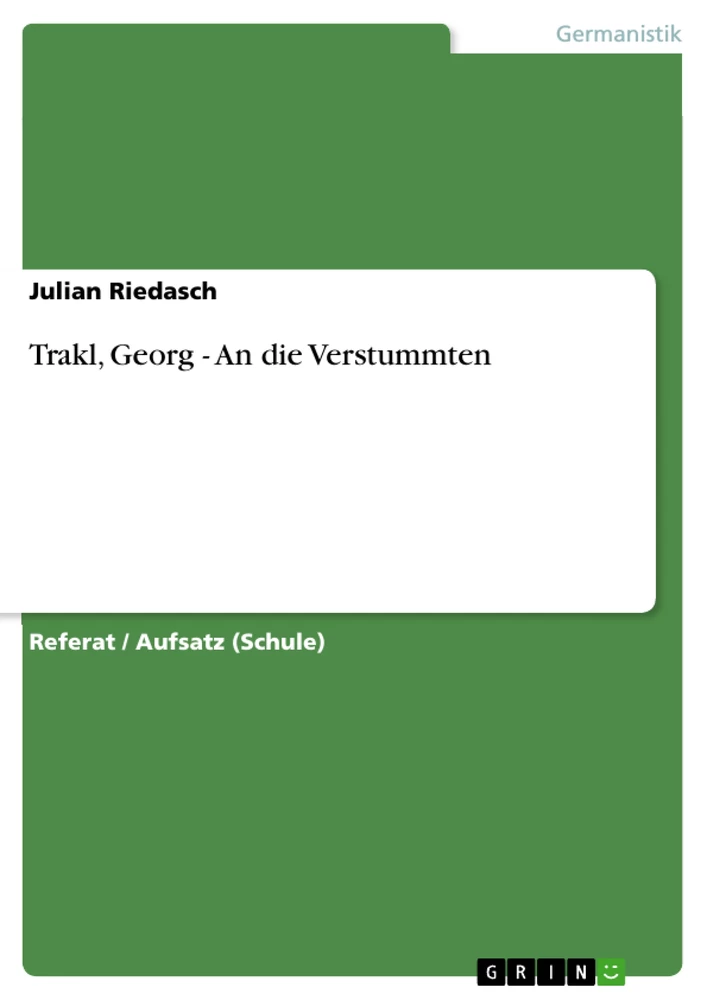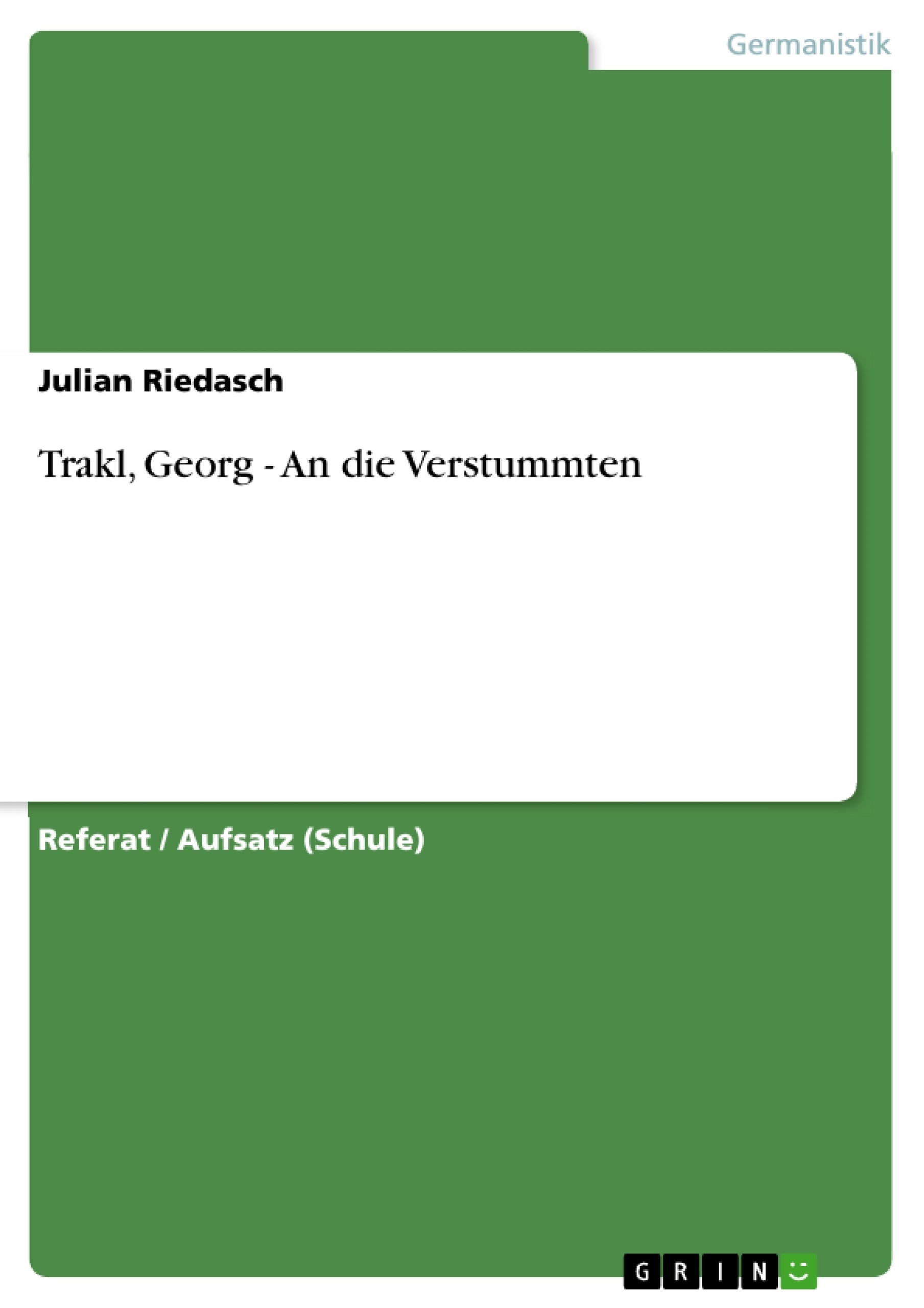Was verbirgt sich hinter der glitzernden Fassade der modernen Großstadt? Georg Trakls eindringliches Gedicht "An die Verstummten" entführt uns in eine düstere Vision urbaner Entfremdung, wo Wahnsinn, Verfall und spirituelle Leere allgegenwärtig sind. Der Leser wird Zeuge einer schonungslosen Darstellung der Schattenseiten des Fortschritts: verkrüppelte Bäume vor schwarzen Mauern, der Geist des Bösen hinter silbernen Masken, und das versunkene Läuten der Abendglocken, das im Lärm der Stadt ungehört verhallt. Eine Hure gebiert ein totes Kindlein, ein erschütterndes Bild für den Verlust von Hoffnung und Menschlichkeit. Gottes Zorn peitscht die Stirn der Besessenen, während Seuche und Hunger die grünen Augen der Unschuld brechen. Doch inmitten dieser trostlosen Szenerie keimt ein Funke Hoffnung: In dunklen Höhlen schmiedet eine stumme Menschheit aus harten Metallen ein erlösendes Haupt. Ist es ein Zeichen der Resignation oder ein Aufruf zum Widerstand gegen die entmenschlichenden Kräfte der modernen Welt? Trakls expressionistische Sprache, reich an Symbolik und düsteren Bildern, fängt die innere Zerrissenheit des modernen Menschen ein und fordert uns heraus, über die wahren Kosten des Fortschritts nachzudenken. Tauchen Sie ein in die verstörende Schönheit dieses Gedichts und entdecken Sie eine tiefgründige Auseinandersetzung mit den existenziellen Fragen unserer Zeit. "An die Verstummten" ist mehr als nur ein Gedicht; es ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, ein Mahnmal für die Vergessenen und ein Aufruf zur Menschlichkeit in einer zunehmend entfremdeten Welt. Es ist eine expressionistische Reise in die Abgründe der Großstadt, die den Leser mit unbequemen Fragen und einer nachhaltigen Wirkung zurücklässt. Entdecken Sie die verborgenen Botschaften und die tiefere Bedeutung hinter Trakls meisterhafter Dichtung und lassen Sie sich von der Intensität seiner Sprache gefangen nehmen. Ein Muss für alle Liebhaber der expressionistischen Literatur und für jeden, der sich mit den Herausforderungen des modernen Lebens auseinandersetzen möchte.
17.05.2001 Seite 1 von 1
Georg Trakl: „An die Verstummten“:
O, der Wahnsinn der großen Stadt, da am Abend
An schwarzer Mauer verkrüppelte Bäume starren
Aus silberner Maske der Geist des Bösen schaut;
Licht mit magnetischer Geißel die steinerne Nacht verdrängt. O, das versunkene Läuten der Abendglocken.
Hure, die in eisigen Schauern ein totes Kindlein gebärt. Rasend peitscht Gottes Zorn die Stirne des Besessenen, Purpurne Seuche, Hunger, der grüne Augen zerbricht. O, das gräßliche Lachen des Golds.
Aber stille blutet in dunkler Höhle stummere Menschheit, Fügt aus harten Metallen das erlösende Haupt.
Gedichtinterpretation
Georg Trakl, einer der Hauptvertreter des Expressionismus (1910-1925) in Deutschland versuchte mit seinen Gedichten das Empfinden und die Phantasie seiner Leser anzuregen, indem er kroteske Figuren verwendete und scheinbar disparate Inhalte zusammenfügte. Auch das mir vorliegende Gedicht enthält solch typische Merkmale.
Das Gedicht besteht aus drei Strophen mit abnehmender Verszahl.
Die erste Strophe enthält fünf Verse, die zweite vier und die letzte nur noch zwei.
Das Thema des Gedichts „An die Verstummten“ von Georg Trakl ist die arstellung der als unmenschlich und kalt empfundenen Stadt. Das Gedicht ist eine Botschaft „an die Verstummten“ mit stark appellativen Charakter. Wer diese Personen sind, erfährt man zunächst nicht: die Verstummten sind eine Gruppe von Menschen, die in der Anonymität der Stadt untergegangen sind und keine Chance haben sich zu artikulieren.
Gleich die erste Zeile des Gedichts gleicht einer Klage des Erzählers, der an dieser Kälte leidet: „O, der Wahnsinn der großen Stadt, da am Abend / an schwarzen Mauern verkrüppelte Bäume starren“. Das Wort „Wahnsinn lässt die Abscheu und Enttäuschung des Erzählers scheint „am Abend “ durch die Großstadt zu laufen, dabei sieht er im Dunklen mystische, ja bedrohliche Gestalten. Trakl gibt diese erfahrenen Eindrücke durch den für den Expressionismus typischen Reihungsstil wieder. Man bekommt den Eindruck, dass der Erzähler es nicht schafft die zahlreichen Impressionen an den Leser zu vermitteln und es entsteht ein Gefühl von Hektik und Verzweiflung, was durch das unregelmäßige Metrum und das aufgelöste Reimschema noch verstärkt wird. Die „schwarzen Mauern“ erinnern an verschmutzte Häusermauern, wie sie noch heute noch in Städten im Ruhrgebiet in denen Kohle abgebaut wurde zu sehen ist. Hinter diesen Mauern schirmen sich Menschen von anderen ab und schaffen so Anonymität und Gefühlskälte. Die Symbolik der Farbe Schwarz forciert dabei noch diese negativen Eindrücke. Vor den Mauern stehen „verkrüppelte Bäume“, Bäume, die eigentlich das Stadtbild verschönern sollen und normalerweise bei dem Leser Assoziationen wie Geborgenheit und Schutz wecken.
Aber diese Bäume „starren“, eine eindeutige Personifikation, wirken dadurch auf den Leser bedrohlich und entsprechen damit nicht dem typischen Ideal eines Baumes, denn sie sind verkrüppelt und so werden die üblichen Erwartungen enttäuscht.
Dazu schaut auch noch „Aus silberner Maske der Geist des Bösen“ auf den Menschen. Die „silberne Maske“ könnten die großen Hochhäuser, wie Bürogebäude oder Bankgebäude sein, die mit ihren silbern erscheinenden Fassaden der Stadt ihre Pracht verleihen. Doch diese Fassaden sind wie eine „Maske“, sie verdecken das Eigentliche den „Geist des Bösen“, der dem Betrachter verborgen bleiben soll. Der „Geist des Bösen“ könnte ein Symbol für den Materialismus sein oder sogar ein Zeichen für die Ausbeuterbetriebe in der Zeit, die Menschen als billige Arbeitskraft aus nutzten.
Das Licht, das mit „magnetischer Geißel die steinerne Nacht verdrängt“ sind die Straßenlaternen und zahlreichen Lichter der Großstadt, die eine „magnetische“ Anziehungskraft auf die Menschen, die in die Vergnügungsviertel einer Großstadt strömen, ausübt.
Die Finsternis, die „Nacht“ wird durch diese technische Errungenschaft „verdrängt“. Sie ist „steinern“ und hinterlässt dadurch ein Gefühl von Kälte und belastet die Menschen.
Daraus folgt der Ruf nach dem „versunkenen Läuten der Abendglocken“, wie es damals in ländlichen Gebieten nach Feierabend zu hören war. Damit steht es in Kontrast zu dem Leben in der Stadt, welches in der vorangegangenen Zeile beschrieben wurde. Die Menschen kommen nach Feierabend nicht zu Ruhe, sondern machen sprichwörtlich die Nacht zum Tag. Das „Läuten der Abendglocken“ geht in der Stadt in der Hektik und dem Lärm unter, es versinkt.
In der zweiten Strophe beschreibt der Erzähler weitere negative Impressionen, die er Impressionen, die er von der Stadt bekommen hat. So wird das Bild einer „Hure, die in eisigen Schauern ein totes Kindlein gebärt“ gezeigt. Dies erinnert sofort an ein religiöses Ereignis: die Geburt Jesus, der Erlöser der Menschheit, der aber in Geborgenheit und in Schutz der Mutter und des Vaters in einer Grippe zu Welt kam. Trakl zeigt den krassen Gegensatz dazu. Die Jungfrau Maria ist eine „Hure“, ein Zeichen für die Oberflächigkeit der Menschheit, und anstatt im Schutz der Grippe gebärt sie in „eisigen Schauern“. Dies könnte ein Symbol für die Gefühlskälte der Menschen untereinandersein, die nicht mehr bereit sind anderen zu helfen, sondern sich nur noch um ihre eigenen Probleme kümmern. Das „Kindlein“ ist eine Totgeburt, alle Hoffnungen der Frau auf ein neues Leben sterben mit dem Kind. Es gibt in dieser Welt keinen Erlöser mehr. Darauf folgt in der nächsten Zeile der „Zorn“ Gottes auf das Fehlverhalten des „Besessenen“, den Mensch, der von oberflächigen Werten, wie zum Beispiel Geld, geleitet ist. Diese Wut Gottes wird durch den Zischlaut in dem Wort „peitscht“ lautmalerisch zur Geltung gebracht.
Die „Purpurne Seuche“, Krankheiten wie zum Beispiel Syphilis, die um die Jahrhundertwende und auch noch in den Städten weit verbreitet waren, sowie der „Hunger“ haben „grüne Augen“ zerbrechen lassen. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Die Menschen, die mit „grünen Augen“, also mit Hoffnung auf ein besseres Leben in die Stadt gekommen waren, werden durch Krankheiten und Hunger in ihren Erwartungen enttäuscht. Die Hoffnung auf Besserung zerbricht. Das „Gold“, repräsentativ für den Materialismus und Kapitalismus, scheint diese Menschen, wie in der folgenden Zeile beschrieben auf spöttische Weise auszulachen. Durch den Ausruf „O“ kommt die Hilflosigkeit des Erzählers gegenüber der scheinbaren Übermacht des Goldes zum Ausdruck.
Die letzte Strophe beginnt mit einer Antithese verdeutlicht durch die Konjunktion „Aber“: „Aber stille blutet in dunkler Höhle stummere Menschheit“. Man stolpert beim Lesen dieser Zeile über den Komparativ „stummere“, da normalerweise eine Steigerung des Adjektivs stumm wenig Sinn macht.
Die „stummere Menschheit“ ist die Gruppe von Menschen an die das Gedicht appelliert. Durch die Übersteigerung „stummere“ und das Adverb „stille“ wird deutlich gemacht wie wenig Einfluss diese Menschen haben. Sie halten sich abgeschirmt von anderen in einer „dunklen Höhle“ auf. Die erinnert an die Situation der ersten Christen im alten Rom. Diese konnten sich aufgrund von Unterdrückung und Verfolgungen oft nur an geheimen Orten, wie den Höhlen ähnlichen römischen Katakomben treffen. Diese Menschheit „blutet“, sie ist schon angeschlagen, verletzt und schwach, aber trotzdem „Fügt“ sie „aus harten Metallen das erlösende Haupt“. Dieses „erlösende Haupt“ könnte der Leib Christi sein, der in vielen Kirchen aus Metall am Kreuz hängt. Diese Gruppe von Menschen erhält ihren Glauben. Doch dies ist eine schwere Aufgabe, da es sich um harte Metalle handelt. Sie lassen sich nicht so leicht verarbeiten wie das Gold. Der christliche Glaube ist viel schwerer zu erhalten, als eine oberflächige Wertvorstellung. Auch durch die abnehmende Verszahl pro Strophe zeigt, dass diese gläubige Menschheit gegenüber den anderen in die Minderheit geraten ist.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Georg Trakls Gedicht „An die Verstummten“?
Das Gedicht „An die Verstummten“ von Georg Trakl thematisiert die Darstellung der als unmenschlich und kalt empfundenen Großstadt. Es ist eine Botschaft an die „Verstummten“, eine Gruppe von Menschen, die in der Anonymität der Stadt untergegangen sind und keine Möglichkeit haben, sich zu artikulieren.
Welche Merkmale des Expressionismus finden sich in dem Gedicht?
Das Gedicht enthält typische Merkmale des Expressionismus, wie krasse, groteske Bilder, die Verwendung scheinbar disparater Inhalte, Reihungsstil und ein unregelmäßiges Metrum und aufgelöstes Reimschema, was ein Gefühl von Hektik und Verzweiflung erzeugt.
Was symbolisiert die „schwarze Mauer“ im Gedicht?
Die „schwarzen Mauern“ erinnern an verschmutzte Häusermauern und symbolisieren die Abgrenzung der Menschen voneinander, die Anonymität und Gefühlskälte in der Stadt schaffen. Die Farbe Schwarz verstärkt diese negativen Eindrücke.
Was könnte mit dem „Geist des Bösen“ gemeint sein?
Der „Geist des Bösen“, der hinter der „silbernen Maske“ (Hochhäuser, Bürogebäude) schaut, könnte ein Symbol für den Materialismus, die Ausbeutung der Menschen als billige Arbeitskraft oder die verborgenen negativen Aspekte der modernen Stadt sein.
Was bedeuten die „verkrüppelten Bäume“?
Die „verkrüppelten Bäume“ sind eine Personifikation und wirken bedrohlich. Sie enttäuschen die Erwartungen, die man normalerweise an Bäume hat (Geborgenheit, Schutz), und spiegeln so die negative Atmosphäre der Stadt wider.
Welche Bedeutung hat die „Hure, die in eisigen Schauern ein totes Kindlein gebärt“?
Dieses Bild steht im krassen Gegensatz zur christlichen Geburt Jesu. Die „Hure“ symbolisiert die Oberflächigkeit der Menschheit, die „eisigen Schauern“ die Gefühlskälte, und das „tote Kindlein“ das Scheitern aller Hoffnungen auf ein neues Leben und das Fehlen eines Erlösers in dieser Welt.
Was symbolisiert das „Gold“ im Gedicht?
Das „Gold“ steht repräsentativ für den Materialismus und Kapitalismus, der die Menschen spöttisch auslacht und die Hilflosigkeit des Erzählers angesichts seiner Übermacht zum Ausdruck bringt.
Wer ist die „stummere Menschheit“ und was tun sie?
Die „stummere Menschheit“ ist die Gruppe von Menschen, an die das Gedicht appelliert. Sie halten sich abgeschirmt in einer „dunklen Höhle“ auf und erinnern an die Situation der ersten Christen. Sie „fügen aus harten Metallen das erlösende Haupt“, was als der Glaube interpretiert werden kann, der schwer zu erhalten ist.
Wie wird die Bedeutung der „Verstummten“ verdeutlicht?
Durch die Übersteigerung „stummere“ und das Adverb „stille“ in der letzten Strophe wird deutlich gemacht, wie wenig Einfluss diese Menschen haben. Auch durch die abnehmende Verszahl pro Strophe wird gezeigt, dass diese gläubige Menschheit gegenüber den anderen in die Minderheit geraten ist.
- Quote paper
- Julian Riedasch (Author), 2001, Trakl, Georg - An die Verstummten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102507