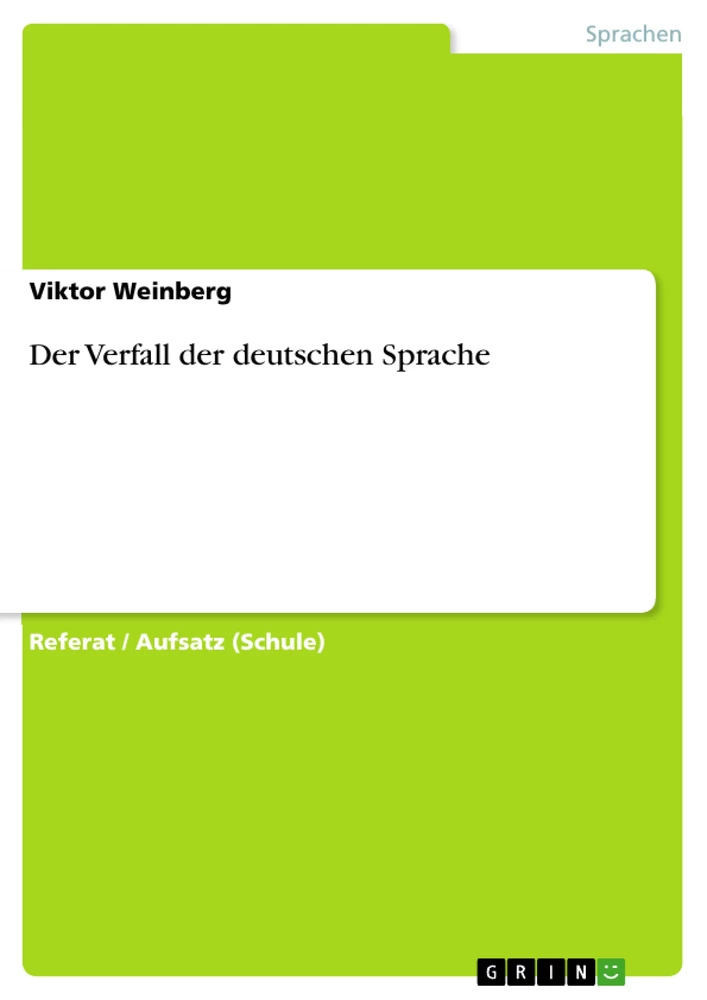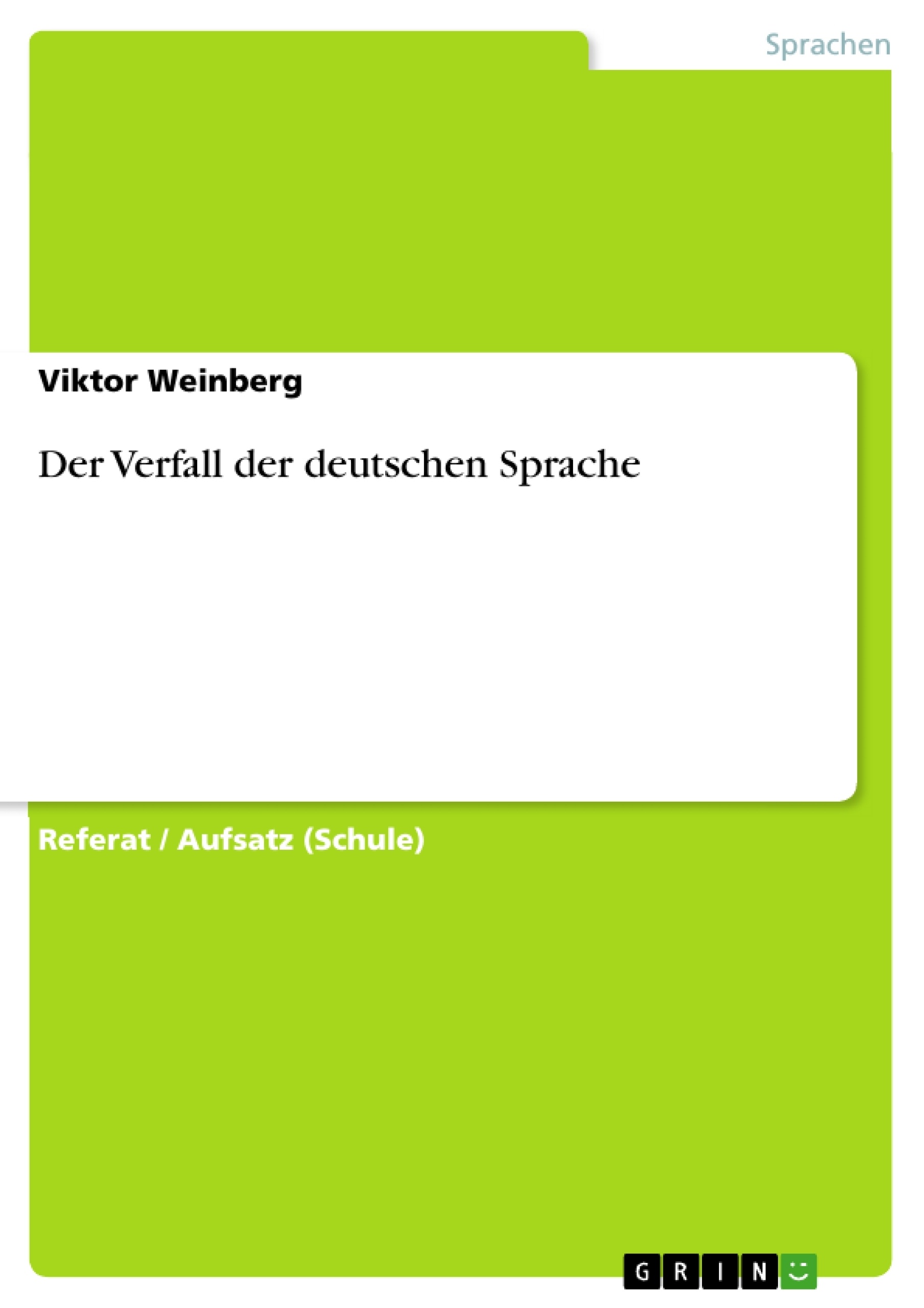Ein schleichender kultureller Ausverkauf oder unvermeidlicher Fortschritt? Tauchen Sie ein in eine brisante Analyse über den Zustand der deutschen Sprache im Zeitalter der Globalisierung. Dieses Buch ist ein Weckruf für alle, die sich um die Reinheit und den Fortbestand unserer Muttersprache sorgen. Es enthüllt auf erschreckende Weise, wie eine unkontrollierte Flut von Anglizismen und Amerikanismen nicht nur unseren Wortschatz verarmt, sondern auch unsere kulturelle Identität untergräbt. Anhand zahlreicher Beispiele aus Alltag, Medien und Politik wird schonungslos aufgezeigt, wie gedankenlos deutsche Begriffe durch englische Pendants ersetzt werden, selbst wenn erstere an Ausdruckskraft und Ästhetik in nichts nachstehen. Ist "Highlight" wirklich attraktiver als "Höhepunkt", oder handelt es sich hierbei um eine kritiklose Übernahme eines vermeintlich modernen Lebensgefühls? Der Autor argumentiert leidenschaftlich gegen die Vorstellung, dass der Verzicht auf die eigene Sprache ein Zeichen von Weltoffenheit sei, und warnt eindringlich vor den langfristigen Konsequenzen für unsere Gesellschaft. Er deckt auf, wie der Bedeutungsverlust des Deutschen in Wissenschaft und Technik nicht nur auf äußere Einflüsse, sondern auch auf ein mangelndes Selbstbewusstsein im Umgang mit der eigenen Sprache zurückzuführen ist. Diese Zustandsbeschreibung ist mehr als eine bloße Sprachkritik; sie ist ein Plädoyer für den bewussten Umgang mit unserer Sprache als einem fundamentalen Bestandteil unserer Kultur und Identität. Es ist eine Einladung zur Debatte über die Zukunft des Deutschen in einer globalisierten Welt, ein Appell an Politik, Medien und jeden einzelnen Bürger, Verantwortung für den Erhalt und die Pflege unserer sprachlichen Vielfalt zu übernehmen. Verpassen Sie nicht diese aufrüttelnde Auseinandersetzung mit einem Thema, das uns alle betrifft: den drohenden Verfall der deutschen Sprache und die Notwendigkeit, unsere sprachlichen Wurzeln zu bewahren.
Der Verfall der deutschen Sprache
Die sinnlose Anfütterung der deutschen Sprache mit Amerikanismen ist nicht übersehbar und längst zum Ärgernis geworden.
Nie zuvor wurde so verschwenderisch mit Wörtern und Begriffen aus dem Englischen und Amerikanischen umgegangen wie heute.
Es gibt Leute, die in dieser Entwicklung nichts negatives sehen, ja sie sogar befürworten, da sie angeblich eine Bereicherung für die deutsche Sprache darstelle, etwa aufgrund der Griffigkeit und Lockerheit vieler moderner englischer Lehnwörter gegenüber möglichen deutschen Entsprechungen. Und gegen diese Spracherweiterung wäre auch nichts einzuwenden, wenn diese maß- als auch sinnvoll geschehen würde, so daß der Organismus der Sprache nicht geschädigt würde. Denn auch Goethe stellte schon seinerzeit fest, daß sich die Kraft einer Sprache darin auszeichne, daß sie Fremdwörter nicht ausmerzt, sondern sie ,,verschlingt" und damit den Wortschatz erweitert.
Aber der Umfang und die Geschwindigkeit, mit denen sich das Amerikanische in der deutschen Sprache breitmacht, kann von ihr nicht bewältigt werden, und das umso weniger, als diesem Vorgang in den meisten Fällen jeder Sinn abgesprochen werden muß. Denn die Übernahme des Wortguts aus anderen Sprachen dient ja bekanntlich der Würzung und, wenn man so will, Erfrischung der eigenen Sprache und trägt zu deren Wachstumsprozeß bei. Genau davon, meine Damen und Herren, kann aber nicht die Rede sein, wenn deutsche Begriffe einfach massenweise durch Amerikanismen bzw. Anglizismen ersetzt werden.
Die Sprache wird dabei nicht gewürzt oder bereichert, sondern in ihrer Entwicklung gestört und vergiftet. Man kann diesen Prozeß mit dem Biertrinken vergleichen. Wenn man zwei, drei Glas Bier trinkt, verkraftet das der Körper gut, die Wirkung kann sogar erfrischend sein. Trinkt man aber zehn Glas Bier hintereinander, so wird man besoffen. In beiden Fällen ist der Organismus letztendlich vergiftet - hier der menschliche, dort der sprachliche.
Die gedankenlose Übernahme englischer Ausdrücke in Fällen, in denen bereits vorhandene deutsche Äquivalente mindestens genauso gut und ästhetisch wären (wie z. B: joggen statt laufen, traben, recyceln statt wiederverwerten oder Ticket statt Fahrkarte) zeigen, daß es hier weder um das griffige Wort noch um den klassischen Fall der Übernahme von Sachen mit ihren Namen geht, sondern um den Versuch ein bestimmtes, als modern empfundenes Image zu vermitteln.
Es ist der amerikanische ,,Life style", der hier kopiert wird. Der deutsche Lebensstil wird plötzlich nicht mehr als attraktiv empfunden. Deswegen wundert es mich gar nicht, daß viele Leute meinen, die früher gebrauchten deutschen Ausdrücke seien hausbacken., unmodern und überholt. Es empört mich, und ich glaube, es wird Ihnen ähnlich gehen, meine Damen und Herren, daß aus irgend einem, mir nicht verständlichen Grund viele ein mit Amerikanisch verpapptes Deutsch als frischer, spannender, ,,fetziger" empfinden.
Natürlich passiert es, daß wenn ich mir die eigene Sprache abgewöhne und sie mir dann irgend wann wieder höre, sie mir sie mir seltsam fremd und altmodisch oder, um im Kitsch der Zeit zu sprechen, ,,out" erscheint. Nun verraten Sie mir doch bitte, meine Damen und Herren, wieso ,,Highlight" attraktiver und moderner als ,,Höhepunkt" sein soll, oder warum ein Lied nun auf ein Mal zu einem Song geworden ist? Etwa weil es zu lang und unästhetisch ist? Nein, meine Damen und Herren, ich kann und will das nicht verstehen!
Der Eindruck ist, und das muß ich jetzt leider feststellen, daß sich die deutschen selbst von ihrer Muttersprache abwenden, so nach dem Motto ,,was deutsch ist, ist nicht modern, und was modern ist, ist nicht deutsch", wobei man meint, daß mit dem Verzicht auf die eigene Sprache und damit auf die eigene Kultur Weltoffenheit und Internationalismus demonstriert werden könne.
Die deutschen vertreten ihre Muttersprache nicht selbstbewußt nach außen und lassen sie nach innen verkommen. Deswegen ist es nicht verwunderlich, daß die deutsche Sprache, obwohl Kommunikationsmittel der größten Sprachgemeinschaft Europas, in den Organisationen und Institutionen des zusammenwachsenden Europas mehr als stiefmütterlich behandelt und blockiert wird.
Es ist nicht die Wortschatzerweiterung, sondern etwas anderes, was die deutsche Sprache bedroht: und zwar ihre Preisgabe zugunsten des Englischen, ihre Nichtverwendung in immer mehr Kommunikationsbereichen, vor allem als Sprache der Wissenschaft und der Technik. Dies erstaunt umso mehr, wenn man bedenkt, daß die deutsche Sprache zum Anfang des 20.Jahrhunderts als Technik - und Wissenschaftssprache schlechthin galt und ein so hohes Ansehen besaß, daß es schon fast undenkbar war, daß ein Wissenschaftler oder Universitätsprofessor nicht Deutsch konnte. Um 1920 erschienen weitaus mehr wissenschaftliche Publikationen aus aller Welt auf Deutsch als auf Englisch. Die deutsche Sprache hatte zu dieser Zeit einen erheblichen Einfluß auf andere Sprachen Europas gehabt. So gibt es auch in meiner Muttersprache sehr viele deutsche Begriffe und Ausdrücke nicht nur im Bereich der Technik oder Wissenschaft.
Doch diese führende Stellung in der wissenschaftlichen Kommunikation verlor Deutsch in den späten 30-er und den 40-er Jahren, also in der Zeit des Nazismus. Der NS-Staat und sein Antisemitismus, schließlich die deutsche Kriegsaggression und der Holocaust im 2.Weltkrieg führten nicht nur zu einer internationalen Abwendung von der deutschen Sprache. Es war auch die Flucht vieler deutscher (oft jüdischer) Wissenschaftler und der sich nach dem Kriegsende fortsetzende ,,brain drain" in die USA, der dem Deutschen als Wissenschaftssprache zunächst auch personell Grundlage entzog. Dazu kam in der Nachkriegszeit eine sich steigernde Hinwendung zum Englischen unter den Wissenschaftlern der Nachbarländer.
Die immer öftere Nichtverwendung der eigenen Sprache seitens deutscher Wissenschaftler bei Publikationen oder Kongressen hat diesen Rückgang des Deutschen in der Wissenschaft auch von innen heraus beschleunigt. Denn wenn immer häufiger deutsche Wissenschaftler ihre Forschungsergebnisse nur noch in Englisch veröffentlichen (obwohl sie auch in Deutsch zur Kenntnis genommen würden), dann entfällt mit der Zeit für ausländische Wissenschaftler oder Professoren die Motivation, eine Sprache zu erlernen, die die Deutschen selbst nicht mehrt gebrauchen; sie entfällt auch wenn Fachkongresse in Deutschland die eigene Sprache nicht mehr als Konferenzsprache vorsehen, oder wenn Politiker oder Geschäftsmänner im internationalen Kontakt auf die deutsche Sprache verzichten.
Die Verantwortung für diesen Skandal tragen u.a. die Mächtigen in den Medien und die fehlende Führung durch eine politische und gesellschaftliche Schicht, die sich der Muttersprache und damit der Kultur verantwortlich fühlt. In Frankreich zum Beispiel gibt es diese Schicht, und von dort aus werden die Deutschen gemahnt, ihre Sprache genauso zu verteidigen wie es die Franzosen mit der ihrigen tun.
In Deutschland hingegen wartet man vergeblich auf den ,,Ruck", den sich die politische Führung geben müßte, um die deutsche Sprache zu retten. Im Gegenteil, von der Produktwerbung in den Medien fasziniert, wand sich die CDU bei den letzten Bundestagswahlen auf Englisch mit ,,keep Kohl" an die Wähler. Eine Werbeschrift ihrer Jugendarbeit lautete: ,,let's talk abot you".
Die Junge Union (JU) rief unterdessen der deutschen Jugend zu: ,,Touch the future".
Der Erfolg dieser erstaunlichen Strategie, den dt. Wähler in fremder Sprache anzureden, bleibt zumindest fraglich.
Denn in der deutschen Öffentlichkeit besteht ein viel größeres Empfinden für die eigene Sprache als es in die Köpfe dieser Werbestrategen will. 60 Prozent der deutschen halten nämlich die gegenwärtige Sprachentwicklung für ,,bedenklich", und diejenigen, die darüber erfreut sind, erreichen nicht einmal die 5 Prozent.
Fest steht jedenfalls, daß eine lebende Sprache, vergleichbar mit einem Organismus, nur dann voll leistungsfähig bleiben kann, wenn alle ihre Funktionen regelmäßig genutzt werden. Anderenfalls kommt es zu Degenerationserscheinungen und zum Absterben bestimmter Funktionen. Ist aber dieses Stadium erst einmal eingetreten, besteht die Gefahr, daß auch andere Funktionsbereiche betroffen werden oder gar die Sprache als Kommunikationsmittel ausstirbt.
Läuft daher die Sprachentwicklung in Deutschland weiter wie bisher, muß nach Einschätzung des Tokioter Soziolinguisten Florian Coulmas die Möglichkeit anerkannt werden, daß die deutsche Sprache durch ihren ständig zurückgehenden Gebrauch auf lange Sicht Funktionseinschränkungen erleidet, die zu ihrer Wertminderung führen können.
Aber die Tatsache, daß sich in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit in erstaunlich kurzer Zeit ein kritisches Bewußtsein gegenüber der Verschmutzung und Vergiftung unserer Umwelt in Politik und Wirtschaft herausgebildet hat, läßt hoffen, daß die Gesellschaft früher oder später auch erkennt, daß man mit der Vernachlässigung und der nicht selbstbewußten Vertretung der eigenen Sprache keine Weltoffenheit und Internationalismus demonstrieren kann, sondern so die Zerstörung der deutschen Kultur und des deutschen Nationalbewußtseins bewirkt.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in "Der Verfall der deutschen Sprache"?
Der Text thematisiert den zunehmenden Gebrauch von Amerikanismen und Anglizismen in der deutschen Sprache und die daraus resultierenden negativen Auswirkungen. Er argumentiert, dass die massenhafte Übernahme englischer Begriffe die deutsche Sprache nicht bereichert, sondern vielmehr stört und vergiftet.
Was sind die Hauptargumente des Textes?
Die Hauptargumente sind:
- Die Übernahme von Anglizismen geschieht oft gedankenlos und ohne Notwendigkeit.
- Sie dient oft eher dazu, ein modernes Image zu vermitteln, als die Sprache tatsächlich zu bereichern.
- Die deutsche Sprache wird dadurch in ihrer Entwicklung gestört und verliert an Eigenständigkeit.
- Die Vernachlässigung der deutschen Sprache führt dazu, dass sie in internationalen Kontexten weniger Beachtung findet.
- Die führende Rolle der deutschen Sprache in Wissenschaft und Technik ist durch die Hinwendung zum Englischen gefährdet.
Warum sieht der Autor die zunehmende Verwendung von Anglizismen kritisch?
Der Autor sieht die zunehmende Verwendung von Anglizismen kritisch, weil er befürchtet, dass die deutsche Sprache dadurch verarmt und ihre Eigenständigkeit verliert. Er argumentiert, dass die massenhafte Übernahme englischer Begriffe die Sprache nicht bereichert, sondern vielmehr stört und vergiftet. Er vergleicht dies mit dem Trinken von zu viel Bier: In kleinen Mengen kann es erfrischend sein, in großen Mengen jedoch schädlich.
Welche Rolle spielte die deutsche Sprache früher in der Wissenschaft?
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt die deutsche Sprache als Technik- und Wissenschaftssprache schlechthin. Wissenschaftliche Publikationen aus aller Welt erschienen häufiger auf Deutsch als auf Englisch. Viele Wissenschaftler und Universitätsprofessoren beherrschten Deutsch.
Warum hat die deutsche Sprache ihre führende Rolle in der Wissenschaft verloren?
Die deutsche Sprache verlor ihre führende Rolle in der Wissenschaft aufgrund des Nazismus, des Antisemitismus, der deutschen Kriegsaggression und des Holocaust. Die Flucht vieler deutscher (oft jüdischer) Wissenschaftler in die USA und der "brain drain" nach dem Krieg trugen ebenfalls dazu bei. Hinzu kam eine zunehmende Hinwendung zum Englischen unter Wissenschaftlern anderer Länder und die Tatsache, dass deutsche Wissenschaftler immer häufiger ihre Forschungsergebnisse nur noch auf Englisch veröffentlichten.
Wer trägt die Verantwortung für den "Verfall der deutschen Sprache"?
Die Verantwortung tragen u.a. die Mächtigen in den Medien und das Fehlen einer politischen und gesellschaftlichen Schicht, die sich der Muttersprache und damit der Kultur verantwortlich fühlt.
Welche Hoffnung besteht hinsichtlich des Erhalts der deutschen Sprache?
Die Hoffnung besteht darin, dass die Gesellschaft, ähnlich wie beim Umweltschutz, ein kritisches Bewusstsein für die Vernachlässigung und die nicht selbstbewusste Vertretung der eigenen Sprache entwickelt. Man muss verhindern, dass die deutsche Sprache, die eine so große Rolle in der Weltkultur und -geschichte gespielt hat, in Bedeutungslosigkeit gerät.
- Citar trabajo
- Viktor Weinberg (Autor), 1998, Der Verfall der deutschen Sprache, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102503