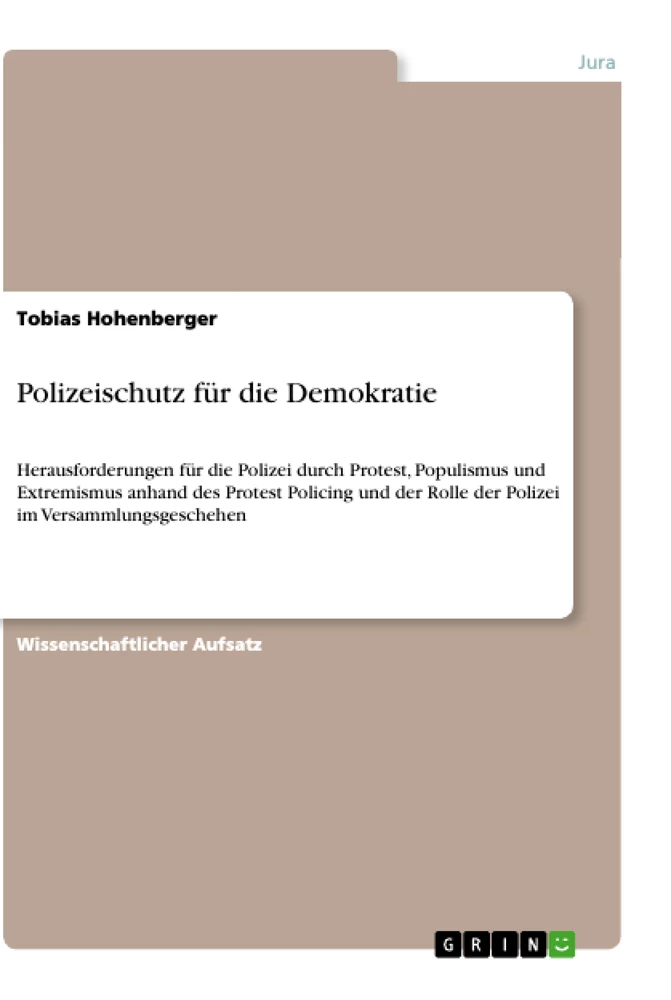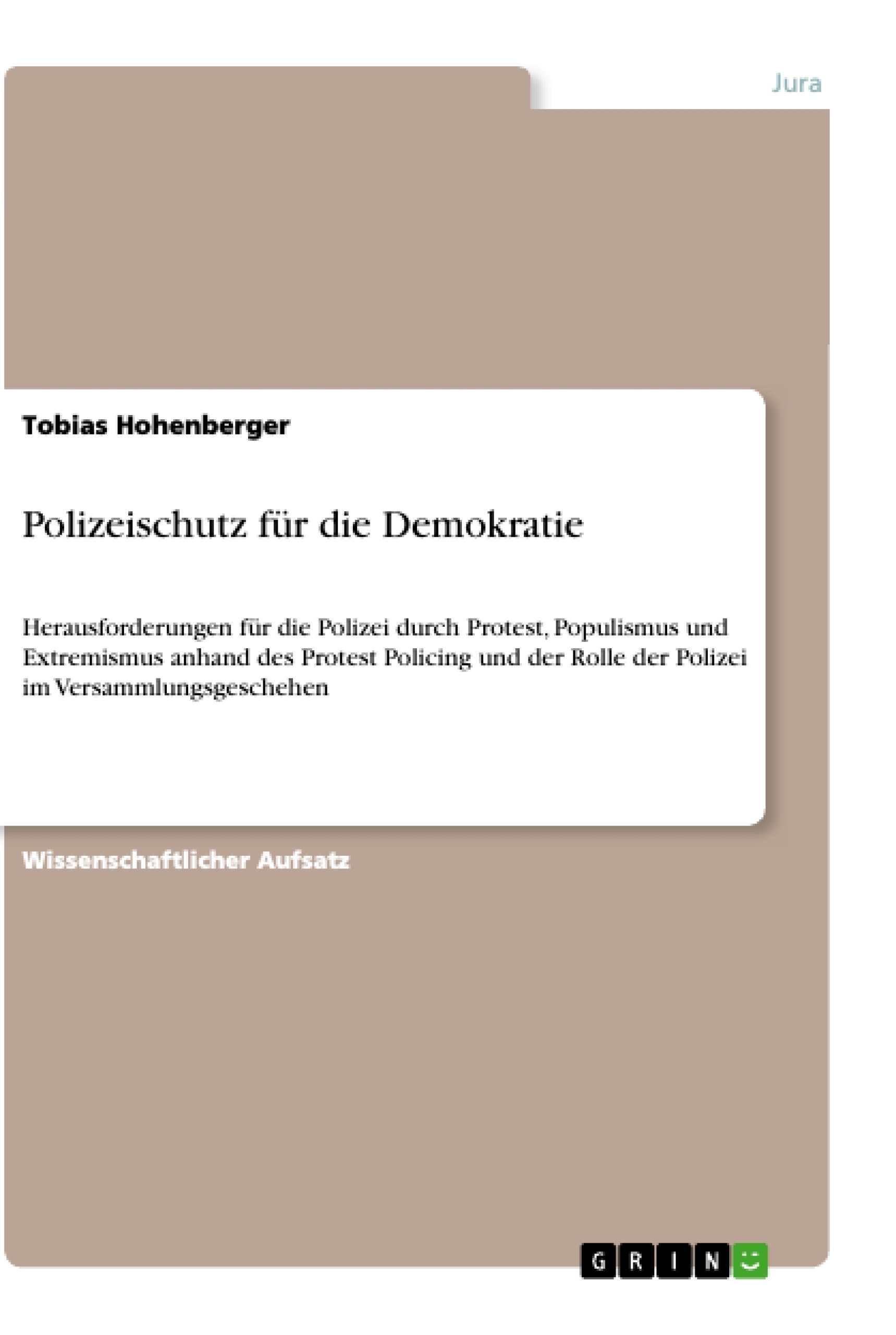Der wissenschaftliche Aufsatz setzt sich mit der Rolle der Polizei im Versammlungsgeschehen auseinander. Zunächst werden einige Begriffe beleuchtet und definiert. Im Anschluss wird die historische Entwicklung des Versammlungsrechts kurz dargestellt. Daran anschließend folgt die Betrachtung einiger rechtlicher Aspekte im Zusammenhang mit dem Versammlungsrecht. Die Rolle der Polizei im Versammlungsgeschehen stellt den nächsten Schwerpunkt der Arbeit dar. Die Nutzung sozialer Medien im Protest Policing rundet den Aufsatz ab, bevor dieser mit einem Fazit zu den vorgenannten Punkten schließt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsbestimmungen
- 2.1. Protest
- 2.2. Populismus
- 2.3. Radikalismus / Extremismus
- 2.4. Protest Policing
- 3. Historische Entwicklung des Versammlungsrechts
- 4. Rechtliche Gesichtspunkte
- 4.1. Europarechtliche Vorgaben
- 4.2. Art. 8 GG
- 4.3. Die Versammlungsgesetze der Länder am Beispiel des bayerischen Versammlungsgesetz (BayVersG)
- 4.4. Der Brokdorf-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG)
- 5. Die Rolle der Polizei im Versammlungsgeschehen
- 5.1. Regelungen im BayVersG
- 5.2. Rückgriff auf das allgemeine Polizeirecht
- 5.3. Abwägungen im Rahmen der praktischen Konkordanz
- 5.4. Selbstwahrnehmung der Polizei
- 5.4.1 Police Culture
- 5.4.2 Cop Culture
- 5.5. Herausforderungen für die Polizei im Umgang mit Menschenmengen
- 6. Polizeiliche Nutzung sozialer Medien im Protest Policing
- 6.1. Nutzung sozialer Medien in der Bevölkerung
- 6.2. Nutzung sozialer Medien durch Polizeibehörden
- 6.3. Problemstellungen im Zusammenhang mit der Nutzung sozialer Medien
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Herausforderungen für die Polizei im Umgang mit Protest, Populismus und Extremismus, insbesondere im Kontext des Protest Policing und der Rolle der Polizei bei Versammlungen. Sie analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen und die historische Entwicklung des Versammlungsrechts in Deutschland. Die Arbeit beleuchtet zudem die Selbstwahrnehmung der Polizei und die Herausforderungen im Umgang mit Menschenmengen.
- Die historische Entwicklung des Protestes und des Polizeieinsatzes in Deutschland.
- Die rechtlichen Grundlagen des Versammlungsrechts und die Rolle der Polizei.
- Die Herausforderungen des Protest Policing im Umgang mit verschiedenen Protestformen.
- Die Bedeutung der sozialen Medien im Kontext von Protest und Polizeiarbeit.
- Die Selbstwahrnehmung der Polizei und ihre Auswirkungen auf den Umgang mit Protest.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Geschichte des Polizeieinsatzes bei Protesten in der Bundesrepublik Deutschland, beginnend mit der Studentenbewegung der 1960er Jahre bis hin zu aktuellen Ereignissen wie den "Black Lives Matter"-Protesten und den Ausschreitungen in Stuttgart. Sie zeigt die Eskalationspotenziale und die anhaltende Relevanz des Themas auf, indem sie verschiedene historische Meilensteine wie den Tod Benno Ohnesorgs und die Auseinandersetzungen um Atomkraftwerke hervorhebt. Der Wandel der Protestformen und die damit verbundenen Herausforderungen für die Polizei werden als zentrale Problemstellung eingeführt. Die Einleitung legt den Fokus auf die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung des Themas und dient als Grundlage für die folgenden Kapitel.
2. Begriffsbestimmungen: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie "Protest", "Populismus", "Extremismus" und "Protest Policing". Es legt die Grundlage für ein präzises Verständnis der im weiteren Verlauf der Arbeit behandelten Themen. Die Definitionen dienen als analytische Werkzeuge, um die komplexen Zusammenhänge zwischen Protest, gesellschaftlicher Polarisierung und polizeilicher Intervention zu verstehen. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der verschiedenen Formen von Protest und den Herausforderungen, die sie für die Polizei darstellen.
3. Historische Entwicklung des Versammlungsrechts: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung des Versammlungsrechts in Deutschland. Es analysiert die Veränderungen im Umgang mit Protesten und die Rolle der Polizei in verschiedenen historischen Kontexten. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen und deren Einfluss auf die Polizeiarbeit im Umgang mit Protesten. Die Kapitel beschreibt die Entwicklung von gewaltsamen Auseinandersetzungen zu moderneren Formen des Protestes.
4. Rechtliche Gesichtspunkte: Dieses Kapitel befasst sich mit den rechtlichen Grundlagen des Polizeieinsatzes bei Versammlungen. Es analysiert europarechtliche Vorgaben, Artikel 8 des Grundgesetzes, die jeweiligen Landesversammlungsgesetze (am Beispiel Bayerns) und den Brokdorf-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Es beschreibt die rechtlichen Grenzen und Möglichkeiten des Polizeieinsatzes und die Abwägung der Grundrechte der Demonstranten mit den Aufgaben der Polizei zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Das Kapitel analysiert den komplexen juristischen Rahmen, innerhalb dessen die Polizei agiert.
5. Die Rolle der Polizei im Versammlungsgeschehen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle der Polizei bei Versammlungen und Protesten. Es untersucht die Regelungen im BayVersG, den Rückgriff auf das allgemeine Polizeirecht und die Abwägung im Rahmen der praktischen Konkordanz. Weiterhin werden Aspekte der Selbstwahrnehmung der Polizei (Police Culture und Cop Culture) und die Herausforderungen im Umgang mit Menschenmengen analysiert. Das Kapitel beleuchtet die komplexe Rolle der Polizei als Schützerin von Grundrechten und gleichzeitig als Garantin der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
6. Polizeiliche Nutzung sozialer Medien im Protest Policing: Dieses Kapitel analysiert die Nutzung sozialer Medien sowohl durch die Bevölkerung als auch durch Polizeibehörden im Kontext von Protesten. Es beleuchtet die Chancen und Risiken dieser Entwicklung und die damit verbundenen Herausforderungen für die Polizei. Die Kapitel geht auf die Möglichkeiten der Informationsbeschaffung und -verbreitung sowie auf die Herausforderungen im Umgang mit Fehlinformationen und der Aufrechterhaltung der Neutralität ein.
Schlüsselwörter
Protest, Populismus, Extremismus, Protest Policing, Versammlungsrecht, Polizei, Grundrechte, öffentliche Sicherheit, Ordnung, soziale Medien, Menschenmengen, Gewalt, Demokratie, Rechtliche Abwägung, Police Culture, Cop Culture, BayVersG, BVerfG.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Herausforderungen für die Polizei im Umgang mit Protest, Populismus und Extremismus
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Herausforderungen für die Polizei im Umgang mit Protest, Populismus und Extremismus, insbesondere im Kontext des Protest Policing und der Rolle der Polizei bei Versammlungen. Sie analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen, die historische Entwicklung des Versammlungsrechts in Deutschland, die Selbstwahrnehmung der Polizei und die Herausforderungen im Umgang mit Menschenmengen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Protestes und des Polizeieinsatzes in Deutschland, die rechtlichen Grundlagen des Versammlungsrechts und die Rolle der Polizei, die Herausforderungen des Protest Policing, die Bedeutung sozialer Medien im Kontext von Protest und Polizeiarbeit und die Selbstwahrnehmung der Polizei und deren Auswirkungen auf den Umgang mit Protest.
Welche Begriffe werden definiert?
Die Hausarbeit definiert zentrale Begriffe wie "Protest", "Populismus", "Extremismus" und "Protest Policing", um ein präzises Verständnis der behandelten Themen zu ermöglichen.
Wie wird die historische Entwicklung des Versammlungsrechts dargestellt?
Die Arbeit bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung des Versammlungsrechts in Deutschland, analysiert Veränderungen im Umgang mit Protesten und die Rolle der Polizei in verschiedenen historischen Kontexten, und beschreibt die Entwicklung von gewaltsamen Auseinandersetzungen zu moderneren Formen des Protestes.
Welche rechtlichen Gesichtspunkte werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert europarechtliche Vorgaben, Artikel 8 des Grundgesetzes, Landesversammlungsgesetze (am Beispiel Bayerns) und den Brokdorf-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Sie beschreibt die rechtlichen Grenzen und Möglichkeiten des Polizeieinsatzes und die Abwägung der Grundrechte der Demonstranten mit den Aufgaben der Polizei.
Wie wird die Rolle der Polizei im Versammlungsgeschehen beschrieben?
Die Hausarbeit untersucht die Regelungen im BayVersG, den Rückgriff auf das allgemeine Polizeirecht und die Abwägung im Rahmen der praktischen Konkordanz. Sie analysiert Aspekte der Selbstwahrnehmung der Polizei (Police Culture und Cop Culture) und die Herausforderungen im Umgang mit Menschenmengen.
Welche Rolle spielen soziale Medien im Kontext von Protest Policing?
Die Arbeit analysiert die Nutzung sozialer Medien durch die Bevölkerung und Polizeibehörden im Kontext von Protesten, beleuchtet Chancen und Risiken und die Herausforderungen für die Polizei im Umgang mit Fehlinformationen und der Aufrechterhaltung der Neutralität.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Begriffsbestimmungen, Historische Entwicklung des Versammlungsrechts, Rechtliche Gesichtspunkte, Die Rolle der Polizei im Versammlungsgeschehen, Polizeiliche Nutzung sozialer Medien im Protest Policing und Fazit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Protest, Populismus, Extremismus, Protest Policing, Versammlungsrecht, Polizei, Grundrechte, öffentliche Sicherheit, Ordnung, soziale Medien, Menschenmengen, Gewalt, Demokratie, Rechtliche Abwägung, Police Culture, Cop Culture, BayVersG, BVerfG.
- Quote paper
- Tobias Hohenberger (Author), 2020, Polizeischutz für die Demokratie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1024514