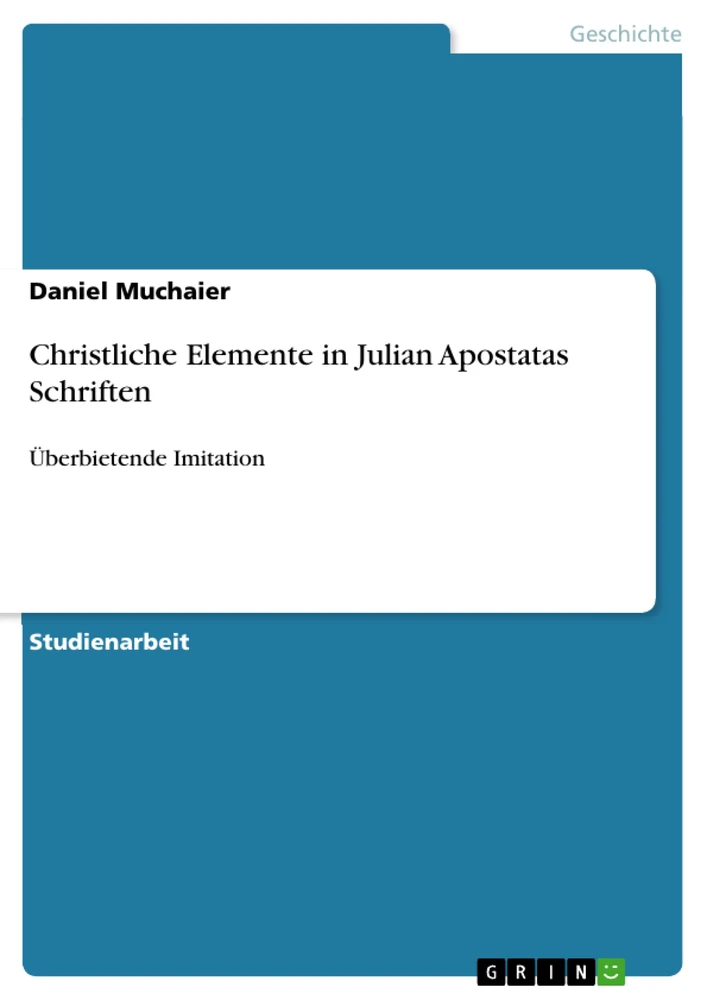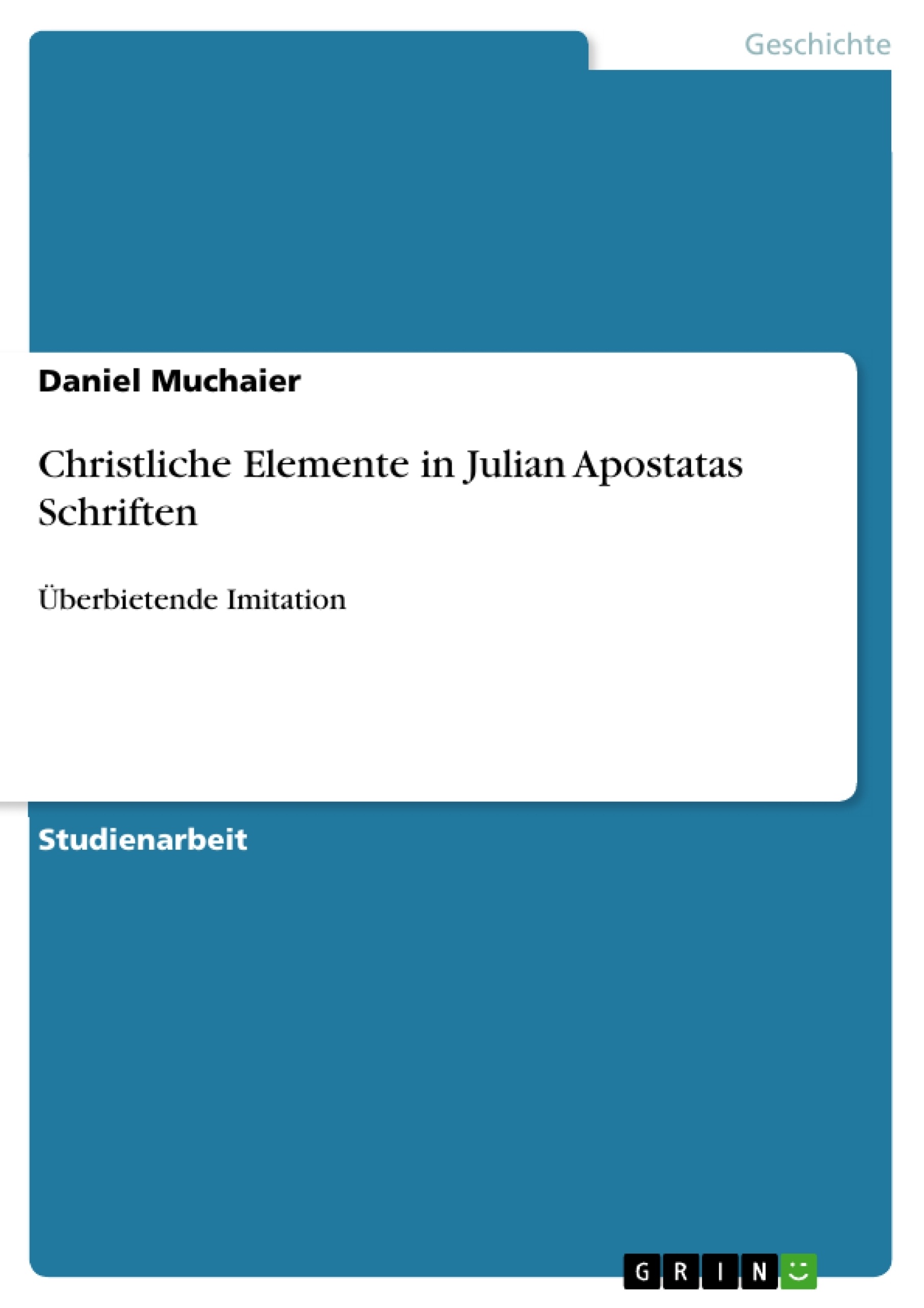In dieser Arbeit werden Schriften des Kaisers Julian Apostata auf christliche Einflüsse hin untersucht. Dazu wird zunächst auf Julians christliche Erziehung und seine Abkehr von ihr und seine Hinwendung zum Neoplatonismus eingegangen. Dass sich Julian aber immer wieder christlicher Elemente bediente und dabei auf seine Erziehung zurückgriff, um sein Vorhaben der Repaganisierung des Römischen Reichs voranzutreiben, wird anhand seiner Schrift gegen den Kyniker Herakleios und seiner Herakles Interpretation veranschaulicht.
Diese Arbeit zeigt, dass diese Art von gegenseitiger Einflussnahme zwischen Christentum und Heidentum kennzeichnend war für die religiösen und philosophischen Auseinandersetzungen der Epoche Julians war und greift dabei auf Christian Schäfers Idee einer "Überbietenden Imitation" zurück.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Julians christliche Erziehung und seine Abkehr vom Christentum
- Der Neoplatonismus und das Christentum
- Grundkonzepte des Neoplatonismus
- Parallelen zum Christentum
- Christliche Momente in Julians Schriften
- Gegen den Kyniker Herakleios
- Christliche Elemente in Julians Herakles-Deutung und seinem Mustermythos
- Christliche Elemente in anderen Schriften Julians
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie stark die christliche Erziehung und das christliche Weltbild Julians Apostata seine Schriften beeinflusst haben. Sie analysiert die Parallelen zwischen dem Neoplatonismus, der Julian anschloss, und dem Christentum und untersucht, wie Julian christliche Argumente in seinen eigenen Schriften einsetzt.
- Julians christliche Erziehung und seine Abkehr vom Christentum
- Der Einfluss des Neoplatonismus auf Julians Weltbild
- Parallelen zwischen Neoplatonismus und Christentum
- Die Verwendung christlicher Elemente in Julians Schriften
- Julians Einsatz christlicher Argumente gegen das Christentum
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt Julian Apostata, seinen Aufstieg zum römischen Kaiser und seine Abkehr vom Christentum vor. Sie skizziert Julians Wirken und seinen Einfluss auf seine Zeitgenossen und die Nachwelt. Die Einleitung betont die Bedeutung von Julians Schriften und den reichhaltigen Fundus an Forschungsliteratur, der sich zu ihm entwickelt hat.
Julians christliche Erziehung und seine Abkehr vom Christentum
Dieses Kapitel beschreibt Julians Kindheit und Erziehung unter der Obhut des Bischofs Eusebius und des Eunuchen Mardonius. Es schildert Julians anfängliche christliche Ausbildung, die ihn aber auch mit den Werken der großen griechischen Dichter vertraut machte, insbesondere mit Homer. Das Kapitel beleuchtet auch Julians Zeit in Macellum, wo er in Isolation lebte und sich intensiv mit philosophischen Schriften beschäftigte, darunter auch mit dem Neoplatonismus.
Der Neoplatonismus und das Christentum
Dieses Kapitel befasst sich mit den Grundkonzepten des Neoplatonismus und seinen Parallelen zum Christentum. Es erläutert die theurgischen Ansätze von Jamblichos, einem einflussreichen Neoplatoniker, der Julians philosophische und religiöse Anschauungen stark prägte.
Christliche Momente in Julians Schriften
Dieses Kapitel untersucht Julians Schriften, insbesondere die Rede Gegen den Kyniker Herakleios, auf Hinweise christlicher Beeinflussung. Es analysiert die Verwendung christlicher Elemente in Julians Schriften und untersucht, wie er diese gegen das Christentum einsetzt.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit behandelt die Themenbereiche Julians Apostata, christliche Erziehung, Neoplatonismus, Christentum, Repaganisierung, philosophische Schriften, christliche Elemente, christliche Argumente, religiöse und politische Weltanschauung, römisches Reich, 4. Jahrhundert n. Chr.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Julian Apostata?
Julian Apostata war ein römischer Kaiser des 4. Jahrhunderts, der versuchte, das Christentum zurückzudrängen und das Heidentum (Repaganisierung) im Reich wieder zu etablieren.
Wie beeinflusste Julians christliche Erziehung sein späteres Werk?
Obwohl er sich vom Christentum abwandte, nutzte er christliche Argumentationsmuster und rhetorische Elemente, um seine paganen Reformen voranzutreiben.
Was ist die „Überbietende Imitation“?
Dieses Konzept beschreibt Julians Strategie, christliche Praktiken und Strukturen zu kopieren und sie in einen heidnischen Kontext zu stellen, um das Christentum mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen.
Welche Rolle spielte der Neoplatonismus für Kaiser Julian?
Der Neoplatonismus bildete das philosophische Fundament für Julians Weltbild und seine religiösen Überzeugungen, wobei er starke Parallelen und Gegensätze zum Christentum aufwies.
In welcher Schrift wird Julians Herakles-Deutung thematisiert?
Julians Auseinandersetzung mit christlichen Elementen wird besonders in seiner Schrift „Gegen den Kyniker Herakleios“ deutlich.
- Quote paper
- Daniel Muchaier (Author), 2021, Christliche Elemente in Julian Apostatas Schriften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1023407