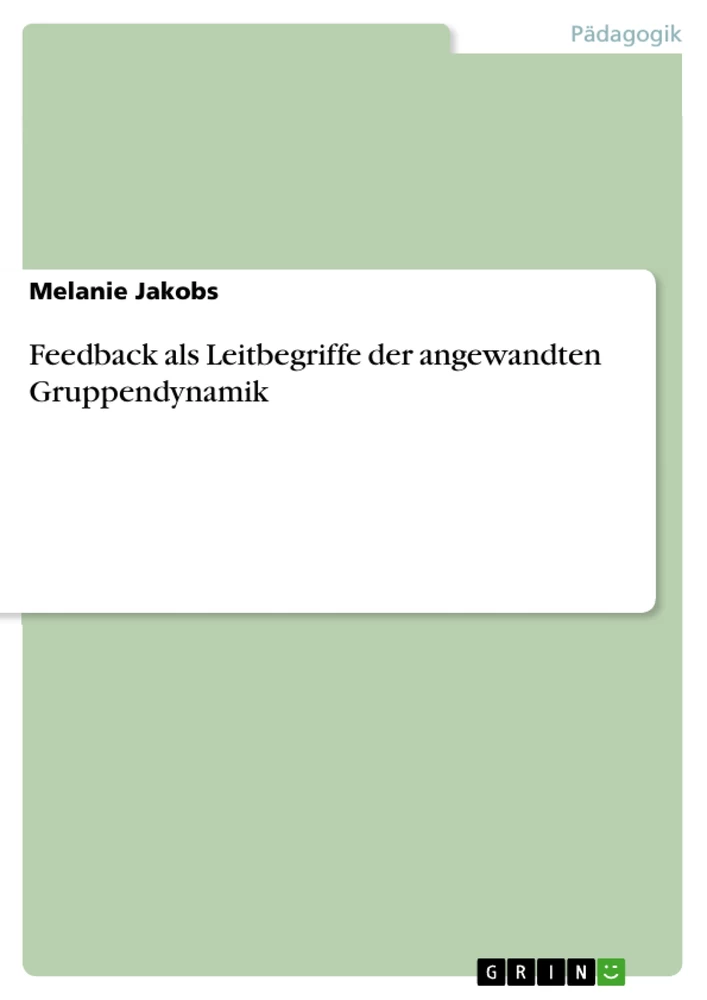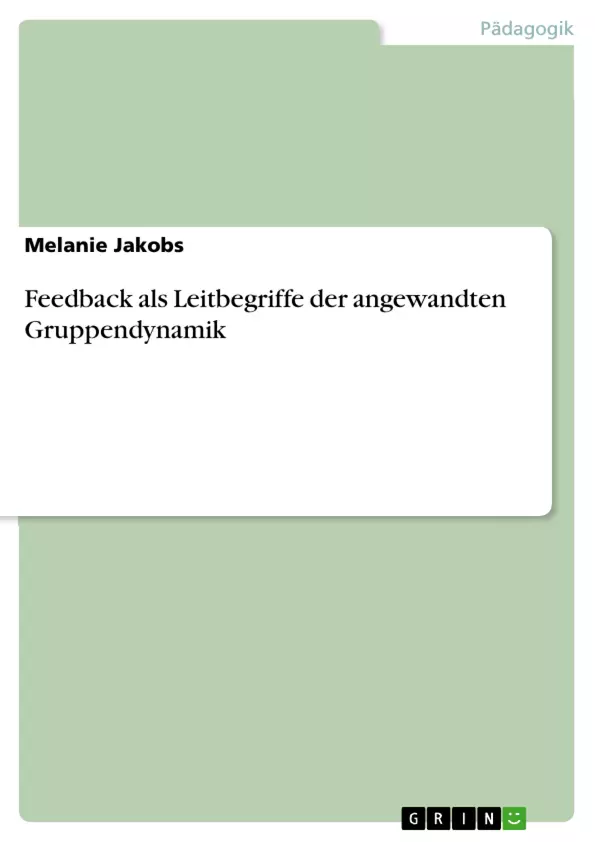Feedback, dieser Begriff ist uns allen sicherlich im Laufe unseres Studiums schon einmal zu Ohren gekommen. Aber was bedeutet er genau? Woher stammt das Konzept? Worum handelt es sich bei der Methode des Feedbacks? Wie führt man ein Feedback richtig durch? All diese Fragen sollen in der vorliegenden Ausarbeitung geklärt werden.
Gliederung
1. Feedback
1.1 Einleitung
1.2 Allgemeines zur Begrifflichkeit
1.3 Die Bedeutung von Feedback
1.4 Begriffsbestimmung im Hinblick auf die Verwendung in der angewandten Gruppendynamik
1.5 Definition von Feedback
1.6 Wie kann Feedback gegeben werden?
1.7 Positive Wirkungen des Feedbacks
1.8 Wie geht Feedback vor sich?
1.9 Feedback - Regeln
2. Johari - Fenster
2.1 Einleitung
2.2 Bildliche Darstellung
2.3 Beispiele
2.4 Wie erreiche ich das Idealbild?
Anhang: Literaturverzeichnis
1.Feedback
1.1 Einleitung:
Feedback, dieser Begriff ist uns allen sicherlich im Laufe unseres Studiums schon einmal zu Ohren gekommen. Aber was bedeutet es genau? Woher stammt es? Worum handelt es sich bei der Methode des Feedbacks? Wie führt man ein Feedback richtig durch? All diese Fragen und vielleicht noch ein wenig mehr sollen "hier und jetzt" geklärt werden.
1.2 Allgemeines zur Begrifflichkeit
„Feed“ bedeutet „füttern“.
Feed - back also „Zurückfüttern“??? Im weitesten Sinne: ja.
Feedback ist ein ursprünglich aus der Nachrichtentechnik und Kybernetik stammender Begriff, der soviel wie "Rückmeldung zum Zwecke der Beeinflussung des weiteren Verlaufs" bedeutet. (Meyers 1988, S.147). Gewöhnlich wird Feedback übersetzt mit "Rückkopplung, Rückwirkung oder Rückmeldung" (Pio Sbandi1973, S.155). Desweiteren meint Feedback jede Art von Rückmeldung, die darauf hinweist, daß der andere ein Verhalten/ eine Äußerung verstanden hat und darauf reagiert.
1.3 Die Bedeutung von Feedback
Ich fand in der Literatur folgende Aussage, deren Verfasser leider unbekannt ist: "Erst wenn ich die Antwort höre, weiß ich, was ich gesagt habe". Aus diesem Satz wird deutlich, wie förderlich Feedback für den Lernprozeß innerhalb einer Kommunikation, vor allem aber bei gruppendynamischen Trainings - um den Bezug zum Seminar zu geben - ist.
1.4 Begriffsbestimmung im Hinblick auf die Verwendung in der angewandten Gruppendynamik
"Feedback bezeichnet... die von anderen auf eine Verhaltenseinheit abgegebenen verbalen und nonverbalen Reaktionen, die zeitlich so eng wie möglich an das Verhalten anschließen und die von dem Individuum, von dem das Verhalten ausging, wahrgenommen und genutzt werden können. Es kann zur Steuerung und Orientierung des anschließenden Verhaltens dienen. Ebenso kann es zu Veränderungen in Verhalten, Gefühlen, Einstellungen, Wahrnehmungen und Kenntnissen des Verhaltensinitiators stimulieren.( Bradford, Gibb und Benne 1972, S.45)
1.5 Definition von FB
Im Bereich der angewandten Gruppendynamik wird unter Feedback verstanden: " Eine explizite und in der Regel verbale Rückmeldung vom Rezipienten an den Kommunikator, die diesem Aufschluß über die Aufnahme und Interpretation sowie die Wirkung von Kommunikationsvorgängen gibt" ( Rechtien 1992, S.202) Hierzu eine bildliche Verdeutlichung:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.6 Wie kann Feedback gegeben werden?
Verbal ("Nein"), nonverbal (das Zimmer verlassen), informell (Beifall klatschen) oder formell ( durch Fragebögen), spontan ("Vielen Dank") oder geplant, absichtlich (Zustimmung nicken) oder unabsichtlich (einschlafen)
Fazit: Jede von anderen wahrnehmbare Äußerung kann Feedback darstellen (Sbandi 1973, S.165)
1.7 Positive Wirkungen des Feedbacks
- Es stützt und fördert positive Verhaltensweisen, da diese anerkannt werden. (Bsp.: „Durch deine klare Analyse hast Du uns wirklich geholfen, das Problem klarer zu sehen.“)
- Es korrigiert Verhaltensweisen, die dem Betreffenden und der Gruppe nicht weiterhelfen oder die der eigentlichen Intention nicht genügend angepaßt und konform sind. (Bsp.: „Es hätte mir mehr geholfen, wenn du mit Deiner Meinung nicht zurückgehalten, sondern sie offen gezeigt hättest.“)
- Es klärt die Beziehung zwischen den Personen und hilft, den anderen besser zu verstehen (Bsp.: „Ich dachte, wir könnten nicht zusammenarbeiten, aber nun sehe ich, daß wir uns sehr gut miteinander verstehen.“)
(Antons 1973, S.108)
⇒ Eigenes Verhalten und das der Gruppe werden genauer erkundet
⇒ Gefühle und Wahrnehmungen werden zu wichtigen Informationen für die Veränderung des Verhaltens vom Einzelnen und von der Gruppe,
⇒ Verbesserungen sind nur möglich, wenn diese Informationen gegeben, aufgenommen und geprüft werden.
⇒ Feedback zeigt nicht nur, daß der Empfänger den Sender verstanden hat, es kann produktiv genutzt werden, um einen neuen Gedanken, eine neue Perspektive oder ein verändertes Verhalten, aber auch eine Bestätigung für sich daraus abzuleiten. (Rechtien 1992 S.202)
Vorraussetzung: Die Bereitschaft aller Gruppenmitglieder sich gegenseitig solche Hilfe zugeben, dann steht dem Vergleich der Selbstwahrnehmung mir der Fremdwahrnehmung nichts mehr im Weg und die Möglichkeiten des Voneinanderlernens steigen im erheblichen Maße. (Antons 1973, S.108)
Allerdings: Betrachtet man unsere Gesellschaft, muß man feststellen, das Rückmeldungen in den meisten Fällen als ungewöhnlich, ungebührlich, unhöflich oder sogar als Tabu gelten. Daher wird es im Alltag eher in indirekter Form gegeben. Zum Beispiel sagen wir nicht "das was Du erzählst, interessiert mich nicht", sondern wir hören einfach nicht zu und versuchen so schnell wie möglich das Thema zu wechseln.
Folge: oft wirkt so ein Verhalten destruktiv auf die Beziehung zwischen zwei Kommunikationspartnern
Leider wird Feedback auch oft nicht gegeben, aus Angst zu verletzen, beleidigen oder "weil man so etwas einfach nicht tut"
Folge: die eben erwähnte Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung sind gestört (Rechtien 1992, S.203)
Damit diese Probleme nicht auftreten muß man wissen, wie Feedback überhaupt richtig funktioniert
1.8 Wie geht FB vor sich?
a) Indem man den anderen wissen läßt, was man über sich selbst denkt und fühlt
b) Indem man die andere Person wissen läßt, was man über sie denkt und fühlt (Konfrontation)
c) Indem man sich gegenseitig sagt, was man über sich selbst und über den anderen denkt und fühlt (Feedback- Dialog)
(Antons 1973, S.108)
Für die Durchführung von Feedback gibt es bestimmte Regeln, die ich an dieser Stelle zusammengetragen habe. Mir persönlich hilft es sehr nach einem Referat oder für andere Tätigkeiten, z.B. Projekte bei der Arbeit ein Feedback zu bekommen. Fehler können so beim nächsten Mal vermieden werden und man erhält Anregungen und neue Ideen. Wichtig ist allerdings, daß man sich beim „Geben“ und auch beim „Nehmen“ des Feedbacks wirklich an die aufgestellten Regeln hält.
1.9 FEEDBACK-REGELN:
1. Feedback soll möglichst erbeten sein.
2. Feedback soll beschreibend sein und keine Interpretation und/ oder Bewertung enthalten.
3. Feedback soll konkret sein und nicht verallgemeinern.
4. Feedback soll sich auf etwas beziehen, was veränderbar ist.
5. Feedback soll gegenseitiges Verstehen sicherstellen.
6. Feedback soll auch positiv verlaufende Kommunikation hervorheben.
7. Feedback soll dazu dienen, die Kommunikation zu verbessern.
8. Feedback soll keine Kritik, sondern Anregungen beinhalten.
9. Feedback verläuft in zwei Phasen:
a) positive Punkte
b) Anregungen, Alternativen und Wünsche
Für den Feedbackempfänger gilt:
- nicht argumentieren und verteidigen
- nur zuhören, nachfragen und klären
- sehen, was man für sich daraus machen kann
( positiver Nutzen, Veränderungen, neue Perspektiven oder auch Bestätigung)
(Quellen: Antons 1973, S.110; Rechtien 1992, S.204ff, Paper Rollenspielseminar Bentler/Mader WS 98/99)
2.Das Johari - Fenster
Die Möglichkeit, Gruppenprozesse bildlich darzustellen
2.1 Einleitung
Das Johari - Window ist benannt nach den Autoren Joe Luft und Harry Ingham. Es ist ein einfaches, graphisches Modell, das die Veränderungen von Selbst- und Fremdwahrnehmung im Verlauf eines Gruppenprozesses (mit Feedback) darstellt. Das Johari - Fenster ist ein Quadrat, das in vier Rechtecke A, B, C und D eingeteilt ist. Die Basis bezeichnet das Selbstbild, also die Aspekte der eigenen Person, die dem Selbst bekannt bzw. nicht bekannt (unbewußt) sind. Durch die Senkrechte des Quadrats werden die Persönlichkeitseigenschaften symbolisiert, die der Öffentlichkeit, z. B.: den Gruppenmitgliedern bekannt/ unbekannt sind (Fremdbild). Die einzelnen Fensterflügel bezeichnen demnach ganz bestimmte Sichtweisen unserer Person, die uns und anderen mehr oder weniger bekannt sind.
2.2 Bildliche Darstellung:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wie erkenntlich ist, haben die vier Quadranten verschiedene Bedeutungen:
A: Bereich freier Aktivität, öffentlicher Sachverhalte und Tatsachen, wo Verhalten und Motivation sowohl mir selbst bekannt, als auch f ü r andere wahrnehmbar ist.
B: Bereich des Verhaltens, der nur mir selbst bekannt und bewu ß t ist, den ich anderen gegenüber nicht geöffnet habe oder öffnen will. Somit ist dieser Teil meines Verhaltens f ü r andere verborgen, versteckt.
C: Der „blinde Fleck“ der Selbstwahrnehmung, das heißt ein Teil des Verhaltens, der zwar f ü r andere sichtbar und erkennbar, mir selbst hingegen nicht bewu ß t ist. (z.B.: Abgewehrtes, Vorbewußtes und nicht mehr bewußte Gewohnheiten.
D: Dieser Bereich erfaßt Vorgänge, die weder mir noch anderen bekannt sind und sich in dem Bereich bewegen, der in der Tiefenpsychologie „unbewußt“ genannt wird. In der Regel wird dieser Bereich jedoch nicht in den Trainingsgruppen bearbeitet.
2.3 Beispiele
Das Modell des Johari - Fensters ermöglicht die Darstellung verschiedener Situationen innerhalb einer Gruppe. Hierzu zwei Beispiele:
a) die Situation zu Beginn einer neuen Gruppe
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
A: die öffentlichen Sachverhalte sind sehr gering, die Gruppe kennt mich nicht.
B und C dominieren: das Verhalten, was mir selbst bekannt ist und mein für andere sichtbares Verhalten nehmen den größten Teil in der Darstellung ein.
b) die Situation, wie sie in einer Gruppe sein sollte, also das Zielbild des Johari - Fensters
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
B und C sind verringert.
A hat den größten Anteil innerhalb des Fensters.
Eine Erweiterung der freien Aktivität hat stattgefunden (A), die blinden Flecke (C) werden aufgehellt.
Bei diesem Zielbild steht die Transparenz im Vordergrund, das heißt ich öffne mich für mich selbst und auch für die anderen in meiner Gruppe.
2.4 Wie erreiche ich das Idealbild
Um solch ein Bild zu erhalten, gibt es vorwiegend zwei Methoden:
1) Informationen über sich und Privates preisgeben
2) Feedback vermitteln und aufnehmen
Dies ist abhängig von der Lernbereitschaft und Lernfähigkeit des Einzelnen und der Gruppe. Wichtig ist, daß man in der Gruppe folgende „Techniken und Wirkweisen“ (Antons 1973, S.112) beachtet:
- Den anderen akzeptieren und sein Selbstbild wahrnehmen · Bei Erreichung der eigenen Grenzen sich selbst mitteilen
- Bereit sein, das Selbstverständnis zu erweitern. Hierdurch wächst die Bereitschaft Feedback zu geben und zu empfangen.
- Dem Gegenüber Sicherheit und Bereitschaft geben, vorurteilsfrei zu hören
- Den widerstand gegen Verhaltensänderungen und die Angst vor der Bearbeitung deren Hintergründe verringern
- Es wird möglich, die eigene Situation zu reflektieren und neue, zukunftsorientierte Aktivitäten auszuprobieren
- Durch das Feedback wird die eigene Wirkung auf andere erfahren, auch die Wirkung nonverbaler, präverbaler Verhaltensweisen.
(nach Antons 1973, S.111f)
Literaturverzeichnis:
- Antons, Klaus: Praxis der Gruppendynamik, Übungen und Techniken. Verlag für Psychologie, Göttingen 1973
- Bradford, Gibb und Benne 1972 aus:
- Rechtien, Wolfgang: Angewandte Gruppendynamik. München 1992
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes?
Der Text behandelt die Themen Feedback und das Johari-Fenster im Kontext der Gruppendynamik.
Was ist Feedback und warum ist es wichtig?
Feedback ist eine Rückmeldung zum Zweck der Beeinflussung des weiteren Verlaufs. Es ist wichtig für den Lernprozess innerhalb einer Kommunikation, insbesondere bei gruppendynamischen Trainings. Es hilft, Verhalten zu steuern, Beziehungen zu klären und das eigene Verhalten und das der Gruppe genauer zu erkunden.
Wie kann Feedback gegeben werden?
Feedback kann verbal oder nonverbal, formell oder informell, spontan oder geplant, absichtlich oder unabsichtlich gegeben werden. Jede wahrnehmbare Äußerung kann Feedback darstellen.
Welche positiven Wirkungen hat Feedback?
Feedback stützt und fördert positive Verhaltensweisen, korrigiert Verhaltensweisen, die nicht hilfreich sind, und klärt die Beziehungen zwischen Personen.
Welche Regeln gibt es für die Durchführung von Feedback?
Die Regeln umfassen, dass Feedback erbeten, beschreibend, konkret, auf etwas Veränderbares bezogen sein soll, gegenseitiges Verstehen sicherstellen, positive Kommunikation hervorheben und die Kommunikation verbessern soll. Es sollte Anregungen beinhalten, keine Kritik, und in zwei Phasen verlaufen (positive Punkte, Anregungen/Wünsche).
Was ist das Johari-Fenster?
Das Johari-Fenster ist ein graphisches Modell, das die Veränderungen von Selbst- und Fremdwahrnehmung im Verlauf eines Gruppenprozesses darstellt. Es besteht aus vier Quadranten: Bereich freier Aktivität (A), Bereich des Verborgenen (B), Blinder Fleck (C) und Unbekanntes (D).
Was bedeuten die einzelnen Quadranten des Johari-Fensters?
A: Verhalten und Motivation sind sowohl dem Selbst als auch anderen bekannt. B: Verhalten ist nur dem Selbst bekannt. C: Verhalten ist anderen bekannt, aber nicht dem Selbst (blinder Fleck). D: Verhalten ist weder dem Selbst noch anderen bekannt.
Wie erreiche ich das Idealbild im Johari-Fenster?
Das Idealbild, in dem der Bereich freier Aktivität (A) am größten ist, erreicht man durch das Preisgeben von Informationen über sich selbst und durch das Vermitteln und Aufnehmen von Feedback.
Welche Techniken und Wirkweisen sind wichtig in einer Gruppe, um das Johari-Fenster effektiv zu nutzen?
Akzeptanz, Selbstmitteilung bei Erreichen der eigenen Grenzen, Bereitschaft zur Erweiterung des Selbstverständnisses, Sicherheit und Vorurteilsfreiheit für den Gegenüber, Verringerung des Widerstands gegen Verhaltensänderungen und die Angst vor der Bearbeitung deren Hintergründe, Reflexion der eigenen Situation und das Ausprobieren neuer Aktivitäten, und die Erfahrung der eigenen Wirkung auf andere.
Welche Literatur wird in diesem Text verwendet?
Die verwendete Literatur umfasst Werke von Antons, Rechtien und Sbandi sowie ein Paper aus einem Rollenspielseminar von Bentler/Mader WS 98/99.
- Quote paper
- Melanie Jakobs (Author), 1999, Feedback als Leitbegriffe der angewandten Gruppendynamik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102321