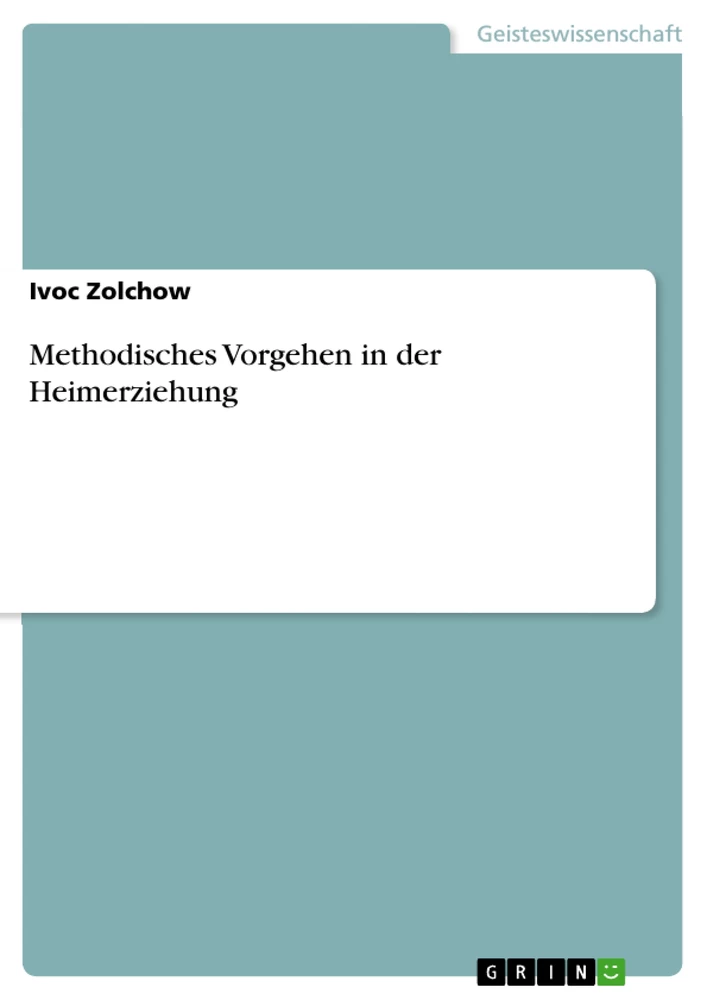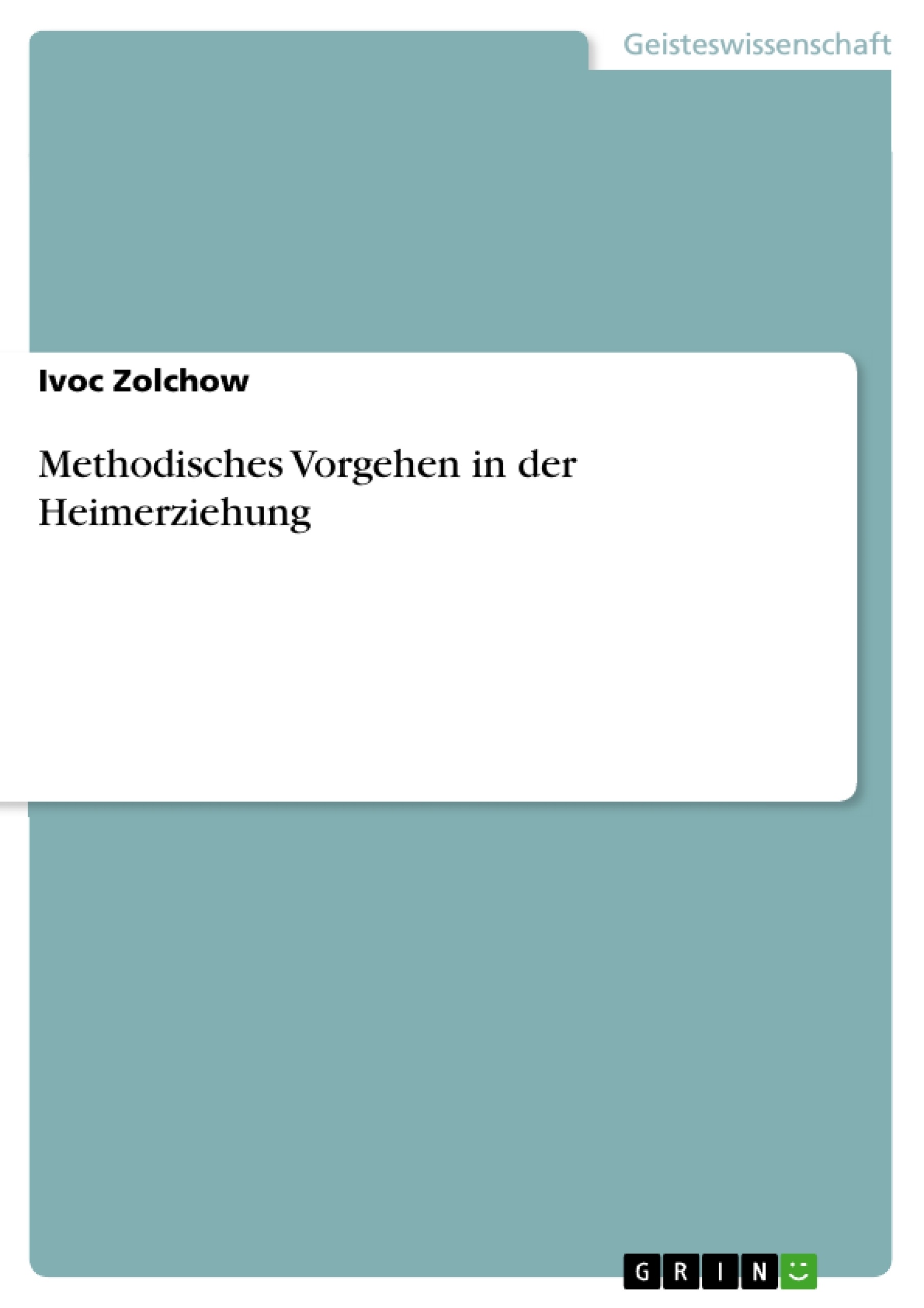Stell dir vor, du stehst vor der komplexen Aufgabe, jungen Menschen in Heimen Halt und Orientierung zu geben – eine Herausforderung, die weit über bloße Betreuung hinausgeht. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Leitfaden für ErzieherInnen, SozialpädagogInnen und alle, die in der Jugendhilfe tätig sind. Es beleuchtet die Notwendigkeit planmäßigen Handelns und zeigt, wie durchdachte Erziehungspläne, basierend auf fundierten Situationsanalysen, den Grundstein für eine erfolgreiche pädagogische Arbeit legen. Der Fokus liegt auf der individuellen Förderung jedes Kindes, unter Berücksichtigung seiner persönlichen Bedürfnisse und Ausgangslage. Dabei wird die immense Bedeutung von Teamarbeit hervorgehoben, denn nur durch klare Kommunikation, gegenseitige Unterstützung und das gemeinsame Verfolgen von Zielen kann ein positives und stabiles Umfeld geschaffen werden. Das Buch bietet praxisnahe Strategien zur Umsetzung von Erziehungszielen, von der Analyse des Kindes über die Interpretation der Ergebnisse bis hin zur konkreten pädagogischen Umsetzung. Es werden die verschiedenen Strategieebenen (1.-3. Grad) erläutert und anhand von Beispielen veranschaulicht, wie man methodische und zielorientierte Interventionen im Alltag anwendet. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Vermeidung negativer Festschreibungen gelegt, um eine positive Entwicklung der Kinder zu fördern. Die LeserInnen erhalten wertvolle Einblicke in die Erstellung von Situationsanalysen, die Interpretation von Verhaltensweisen und die Ableitung individueller Erziehungsziele und -aufgaben. Es wird gezeigt, wie man offene Erziehungsziele formuliert, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich selbst Ziele zu setzen und Kompetenzen zu erwerben. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die in der stationären Jugendhilfe tätig sind und einen professionellen und wirkungsvollen Ansatz suchen, um jungen Menschen eine positive Zukunftsperspektive zu ermöglichen. Es vermittelt die notwendigen Kompetenzen, um den vielfältigen Herausforderungen des Heimalltags erfolgreich zu begegnen und eine nachhaltige positive Veränderung im Leben der Kinder und Jugendlichen zu bewirken. Schlüsselwörter: Heimerziehung, Jugendhilfe, Erziehungsplanung, Teamarbeit, Situationsanalyse, Pädagogik, Heilpädagogik, Verhaltensauffälligkeiten, Kinder und Jugendliche, Erziehungsziele, Interventionen, soziale Kompetenzen, professionelles Handeln, Wohngruppe, Entwicklung fördern, Erzieherausbildung, Soziale Arbeit, Hilfen zur Erziehung, stationäre Jugendhilfe, Praxishandbuch, Fallbeispiele, methodisches Vorgehen.
1. Ausgangslage - Planmäßiges Handeln
Ausgangslage
Durch das breite Spektrum der auftretenden Schwierigkeiten , Störungen , Auffälligkeiten und Abweichungen der in den Heimen lebenden Kindern und Jugendlichen ergibt sich natürlich auch ein großes Gebiet an unterschiedlichsten Therapieformen.
Je nach Spezialisierung und Schwerpunkt einer Institution stehen den Einrichtungen spezielle
TherapeutInnen , PsychologInnen , HeilpädagogInnen zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit therapeutische bzw. pädagogische Angebote , wie Kinderspieltherapie , Sprachheilpädagogik und Verhaltenspädagogik in diesen Einrichtungen vorzunehmen.
Ist dies in einer Wohngruppe oder einem Heim nicht durchführbar , gibt es die Alternative in anderen Institutionen und freien Praxen eine ambulante Therapie stattfinden zu lassen. Da diese speziellen Therapieangebote innerhalb der Woche nur stundenweise stattfinden , ist deutlich erkennbar , dass die Erziehung innerhalb der Gruppe eine wichtige Rolle im Leben des jungen Menschen einnehmen muß. Die Gruppe ist sein Lebensmittelpunkt.
Planmäßiges Handeln
Die pädagogischen Grundhaltungen der ErzieherInnen bilden gemeinsam mit dem Rollenverständnis und der beruflichen Identität die Basis für eine effektive pädagogische Arbeit. Doch zu dieser Basis ist es wichtig konkrete Handlungsschritte hinzuzufügen , die natürlich vorher sorgfältig geplant werden sollten. Nicht nur das Erkennen von notwendigen Vorgehensweisen ist zu beachten , Wege und Möglichkeiten müssen gefunden werden , die anvisierten Ziele auch konkret umzusetzen.
Die erziehungsplanerische Arbeit wird mit Hilfe von Erkenntnissen aus der Pädagogik , Psychologie , der Heilpädagogik und anderen Sozialwissenschaften in methodische Schritte unterteilt. Da die Umsetzung ansonsten aber immer noch als sehr schwierig beschrieben wird , muß die Phase der Realisierung genau dargestellt werden.
Spontanes erzieherisches Verhalten ist zwar notwendig , doch nicht immer ist das Resultat des spontanen Verhalten günstig. Deshalb ist es wichtig die ErzieherInnen mit einem großen Maß an pädagogisch- methodischer Denkweise auszustatten.
Das professionelle Handeln wird nach Weinschenk,R.( 1981 S.171 ) in Zielgerichtetheit , Planmäßigkeit und Folgerichtigkeit und der spezifischen Handlungsstruktur eingeteilt.
Dabei ist immer von Bedeutung , wie man zu den Erziehungszielen gelangt und dass diese Ziele individuell auf die Bedürfnisse und die Ausgangslagen der Kinder und Jugendlichen eingehen müssen. Daher sind sie sinnvollerweise als offen und veränderbar anzusehen.
Die Erziehungsziele und ihre Anwendung auf die Betreffenden ist abhängig vom Charakter , den Bedürfnissen , den Verhaltensweisen und Reaktionen der Kinder.
2. Notwendigkeit von Teamarbeit
Wie das Beispiel des zehnjährigen Rudi ( S.119 ) verdeutlicht , ist es wichtig , dass eine funktionierende Kommunikation innerhalb des Teams stattfindet. Und dies ist nur durch gute , klare Absprachen möglich. Die Wichtigkeit von Teamarbeit anzuerkennen , ist die eine Seite , doch auch wirklich fähig zur gemeinschaftlichen Arbeit zu sein , die andere.
Die Fähigkeit zur richtigen Teamarbeit wird erst durch einen Lernprozess erworben , der die erschwerenden Faktoren offen darlegt und somit das Kennenlernen der einzuhaltenden Regeln ermöglicht.
Sicherlich gibt es in jedem Team Probleme , doch ist sich vor Augen zu führen , dass man von den Jugendlichen Kooperation verlangt und selbst als Mitglied des Teams seine eigene Vorstellungen durchbringen will. Unruhe , Zwistigkeiten können sich sehr schnell auf die primär gar nicht betroffenen Kinder auswirken und somit für Irritationen und möglicherweise Rückschritte sorgen. Teamarbeit entwickelt sich aber erst im Laufe der Zeit , die notwendigen Qualifikationen müssen erst erworben werden.
Des Weiteren ist es wichtig sich untereinander besser kennenzulernen , alle beteiligten ausreichend zu informieren , aber auch die genaue Abstimmung untereinander und das gemeinsame Verfolgen von Zielen , sind Punkte , die zu einer verbesserten Teamarbeit führen. Dabei sind natürlich Faktoren , wie die Zuverlässigkeit der MitarbeiterInnen , die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Verantwortungsübernahme einflußnehmende Aspekte.
Um eine effektive Teamarbeit leisten zu können , sind Teamgespräche und Teamsitzungen dringend notwendig. Sie sollten mindestens einmal pro Woche stattfinden und zwischen 2 bis 3 Stunden sollten sie mindestens dauern. Der Ablauf sollte ungestört vonstatten gehen. Ein weiterer Punkt ist , dass auf der einen Seite Offenheit und Transparenz gezeigt werden sollte , ohne dabei das Recht der Kinder auf Vertraulichkeit und Intimsphäre zu verletzen.
3. Situationsanalyse 1.-3. Grad Strategien
Um das Funktionieren eines Heimes unter dem Gesichtspunkt der Zielsetzung zu ermöglichen bzw. zu analysieren wurden drei Strategiebereiche ( Kok,J.F.W. 1980 )aufgestellt :
1.-Grad-Strategien
Vordergründig geht es hier um Organisationsstrukturen , Rahmenbedingungen und vorhandene Rahmenkonzeptionen. Als Beispiele sind die Größe und Zusammensetzung der Gruppe , die räumliche Ausgestaltung , aber auch die Dienstzeiten der MitarbeiterInnen zu nennen.
2.-Grad-Strategien
Die Anwendung von pädagogischen , heilpädagogischen und therapeutischen Interventionen , wie z.B. Besuch von Sprachtherapie , Bewegungstherapie und Spieltherapie ( außerhalb der Gruppe ) oder auch gemeinsames Kochen und hauswirtschaftliche Tätigkeiten ( innerhalb der Gruppe )zwecks Erlernen von Fähigkeiten , die der Verselbständigung dienen , sind Hauptbestandteile der 2.-Grad-Strategien.
3.-Grad-Strategien
Die genaue Abstimmung , der oben aufgeführten Interventionsweisen wird an den Eigenarten , den Voraussetzungen des Kindes und den Bedürfnislagen orientierend vor- genommen.
Um überhaupt methodische und zielorientierte Interventionen im angemessenem Maße einsetzen zu können sind Erziehungspläne notwendig. In ihnen müssen Erziehungziele deutlich ablesbar bzw. ableitbar sein , damit eine handlungsorientierte pädagogische Umsetzung erfolgen kann.
Zur besseren Anschaulichkeit sind die einzelnen Phasen der Erziehungsplanung und deren Durchführung in folgende Bereiche eingeteilt :
- Situationsanalyse des Kindes
- Interpretation der Analyse
- Ableitung von Erziehungszielen und -aufgaben
- konkrete pädagogische Umsetzung
- Bestätigung und/oder Veränderung des Erziehungsplanes nach einem gewissen Zeit- abstand
4. Situationsanalyse Kind
Die allumfassende Sammlung von Daten , Fakten , Lebensumständen , Vorinformationen und Eindrücken und die damit verbundene Darstellung seiner Gesamtpersönlichkeit , die sogenannte IstAnalyse , sind die wichtigsten Gesichtspunkte der Situationsanalyse.
Zum einen wird allein durch das stetige Sammeln von Informationen schon das verständliche bzw.
unverständliche Verhalten des Kindes sichtbar und zum anderen dient sie dem erzieherischen Verständnis der beobachteten Erscheinungs- und Verhaltensweisen. Jedoch sollte sie mit neutralen oder positiven Bestrebungen verfasst sein , um dem Kind gerecht zu werden und nicht einer negative Festschreibung dienen.
In der Situationsanalyse wird der Ist-Zustand des Kindes beschrieben in dem der bisherige Entwicklungsverlauf , die intellektuelle Leistungsfähigkeit , der körperliche Bereich , die Beziehung des Kindes zu seinen Eltern und die Stellung des Kindes innerhalb der Gruppe unter anderem beschrieben wird.
Um die Anamnese zu erstellen , sollte sich auf die vorliegenden Berichte bezogen werden ( Einweisungsunterlagen , Unterlagen der Jugendhilfeplanung ).
Da frühere Beobachtungen subjektiv gefärbt sein könnten , also negative Merkmale hervorgehoben und betont sein könnten , ist es wichtig sich dies bewußt zu machen , da eine Negativfestschreibung , eine sogenannte "self fullfilling-prophecy"(Rosenthal-Effekt) dies zur Folge haben könnte. Die Beobachtung des Kindes im Alltag , in besonderen Situationen , ob allein oder in Gruppenbeziehungen , sollte zum Hauptgegenstand der Ist-Analyse gemacht werden , um die weitere Erziehungsplanung positiv gestalten zu können.
Einer objektiveren Betrachtung dient die Diskussion der Situationsanalyse innerhalb des Teams. Anhand der Interpretation der gesammelten gemeinsamen Gesichtspunkte und abweichenden Stellungnahmen lassen sich die daraus zu folgernden Aufgabenbereiche ableiten.
5. Interpretation der Analyse
Bevor jedoch weitere Schritte eingeleitet werden , müssen die Aussagen der Analyse gründlich interpretiert werden.
Fragen wie "Mit welchen persönlichen Gefühlen beurteile ich Abweichungen und Auffälligkeiten im Verhalten des Kindes ?" sollen emphatisch wirken , um so die Begleitumstände zu klären , warum gerade jetzt , diese Verhaltensweisen auftreten oder auch um die in diesem Zusammenhang auffallenden Diskrepanzen tiefgründig zu beleuchten.
Besteht die Gefahr einer Negativüberflutung , wenn sich zum Beispiel das Kind stark abweichend negativ verhält , sollte ein Mitglied des Teams nur die positiven Beobachtungen aufzählen , um so eine objektivere Betrachtungsweise herbeizuführen.
Die Ergebnisse der Situationsanalyse sind nach der erfolgten Interpretation der Analyse schriftlich in einem Ergebnissprotokoll festzuhalten.
6. Ableitung von Erziehungszielen und -aufgaben
Auf der Grundlage der Situationsanalyse sollten die ErzieherInnen nur Orientierungspunkte anhand der gegebenen Wert- und Normvorstellungen entwickeln , um nicht zu weitreichende , zu globale Ziele zu setzen , die fern der praktischen Umsetzung sind oder sogar dem Erziehungsziel selbst gar nicht entsprechen. Deshalb sollten Bezugspunkte , die der Festsetzung von Erziehungszielen dienen , im Individuum begründet sein. Außerdem soll der Zuerziehende die Möglichkeit haben , sich selbst Ziele zu setzen.
Die Aufgabe der ErzieherInnen ist es diese individuellen Ansatzpunkte zu erkennen.
Ein weiteres Beispiel für eine heilpädagogisch orientierte Erziehungsauffassung ist , dass man nicht an der Beseitigung der negativen Verhaltensweisen ansetzt , sondern dass man die Erziehungsziele so bestimmt , dass das Fehlen einer richtigen Verhaltensweise zu beheben ist.
Um positiv belebende und nicht hemmende Elemente in die Beziehung zwischen Erzieher und Zuerziehendem einzubringen ist es wichtig , das Kind als Persönlichkeit wahrzunehmen und die Umgebung im täglichen Ablauf zu überprüfen und gegebenenfalls Veränderungen vorzunehmen , die sich positiv auswirken. Bei der Formulierung von Erziehungszielen ist es notwendig , sie von ihrem Charakter her offen zu gestalten , um so auch ein belastendes , vielleicht sich negativ auf die Einstellung des Kindes auswirkendes Element , zu beseitigen. Wichtig ist nicht ein ganz präzis festgelegtes Ziel zu erreichen , sondern einzelne Schritte zu machen , um so dem Ziel näher zu kommen. Werden weniger offene Erziehungsziele nicht erreicht , könnte sich beim Zuerziehenden eine Barriere aufbauen , die lernen unmöglich macht , da ein zu großer Druck vorhanden ist. ErzieherInnen könnten resignieren , da die Ziele zu hochgesteckt formuliert wurden.
Um dem Kind zu helfen Qualifikationen zu erwerben , die es ihm ermöglichen in schwierigen Situationen zurechtzukommen und ihm so beim Erlangen von Kompetenzen behilflich zu sein , ist , laut Weinschenk,R. ( 1980 S.90 ) , die Dynamik des Kindes zu berücksichtigen. Dies kann sich in Stufen wie zum Beispiel der Lösung von Fixierungen und Gehemmtheiten oder des Sicheinordnens in einen gegebenen Rahmen äußern.
Dabei spielt , die Möglichkeit der Kinder eine Rolle , aus einer erfahrenen Hilfe in einer konkreten Lebenssituation eine Übertragung auf andere Bereiche zu vollziehen. Deshalb ist es sinnvoll , einer Vernachlässigung ganzer Bereiche zu entgegnen und die Umsetzung von Erziehungszielen auch mit einfachen , weniger komplexen und komplizierten Strategien anzugehen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Ausgangspunkt für planmäßiges Handeln in der Heimerziehung?
Der Ausgangspunkt ist die Vielfalt der Schwierigkeiten und Störungen bei Kindern und Jugendlichen in Heimen, was unterschiedliche Therapieformen erfordert. Erzieherische Grundhaltungen, Rollenverständnis und berufliche Identität bilden die Basis, ergänzt durch sorgfältig geplante Handlungsschritte.
Warum ist planmäßiges Handeln in der Heimerziehung wichtig?
Planmäßiges Handeln ist wichtig, weil spontanes Verhalten nicht immer günstig ist. Es ist daher wichtig, Erzieher mit pädagogisch-methodischem Denken auszustatten. Professionelles Handeln umfasst Zielgerichtetheit, Planmäßigkeit und Folgerichtigkeit.
Welche Rolle spielt Teamarbeit in der Heimerziehung?
Teamarbeit ist essentiell. Funktionierende Kommunikation und klare Absprachen sind notwendig. Die Fähigkeit zur Teamarbeit wird durch Lernprozesse erworben, die erschwerende Faktoren berücksichtigen. Probleme im Team können sich negativ auf die Kinder auswirken.
Was sind die Voraussetzungen für effektive Teamarbeit?
Besseres Kennenlernen, ausreichende Information aller Beteiligten, genaue Abstimmung und gemeinsames Verfolgen von Zielen sind wichtig. Zuverlässigkeit, Kooperationsbereitschaft und Verantwortungsübernahme sind einflussnehmende Aspekte. Regelmäßige Teamgespräche und -sitzungen sind notwendig.
Welche Strategien gibt es zur Situationsanalyse?
Es gibt drei Strategiebereiche: 1.-Grad-Strategien (Organisationsstrukturen und Rahmenbedingungen), 2.-Grad-Strategien (pädagogische und therapeutische Interventionen) und 3.-Grad-Strategien (genaue Abstimmung der Interventionen auf die Bedürfnisse des Kindes). Erziehungspläne sind notwendig, um methodische und zielorientierte Interventionen einzusetzen.
Welche Phasen umfasst die Erziehungsplanung?
Die Phasen umfassen die Situationsanalyse des Kindes, die Interpretation der Analyse, die Ableitung von Erziehungszielen und -aufgaben, die konkrete pädagogische Umsetzung sowie die Bestätigung und/oder Veränderung des Erziehungsplanes.
Was ist das Ziel der Situationsanalyse des Kindes?
Das Ziel ist die allumfassende Sammlung von Daten, Fakten, Lebensumständen und Eindrücken zur Darstellung der Gesamtpersönlichkeit des Kindes. Sie dient dem erzieherischen Verständnis der beobachteten Verhaltensweisen.
Wie soll die Situationsanalyse verfasst sein?
Sie sollte mit neutralen oder positiven Bestrebungen verfasst sein, um dem Kind gerecht zu werden und nicht einer negativen Festschreibung zu dienen. Frühere Beobachtungen können subjektiv gefärbt sein, daher ist es wichtig, sich dessen bewusst zu sein.
Wie erfolgt die Interpretation der Situationsanalyse?
Die Aussagen der Analyse müssen gründlich interpretiert werden. Fragen sollen emphatisch wirken, um Begleitumstände zu klären und auffallende Diskrepanzen zu beleuchten. Bei Gefahr einer Negativüberflutung sollen positive Beobachtungen hervorgehoben werden.
Wie werden Erziehungsziele und -aufgaben abgeleitet?
Auf der Grundlage der Situationsanalyse sollen Erzieher Orientierungspunkte anhand von Wert- und Normvorstellungen entwickeln. Bezugspunkte, die der Festsetzung von Erziehungszielen dienen, sollen im Individuum begründet sein. Der Zuerziehende soll die Möglichkeit haben, sich selbst Ziele zu setzen.
Wie sollen Erziehungsziele formuliert sein?
Erziehungsziele sollen offen gestaltet sein, um belastende Elemente zu beseitigen. Wichtig ist nicht ein präzis festgelegtes Ziel zu erreichen, sondern einzelne Schritte zu machen, um dem Ziel näher zu kommen. Eine schriftliche Fixierung der erarbeiteten Feinziele und den dazugehörigen Aufgaben ist erforderlich.
- Quote paper
- Ivoc Zolchow (Author), 2001, Methodisches Vorgehen in der Heimerziehung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102319