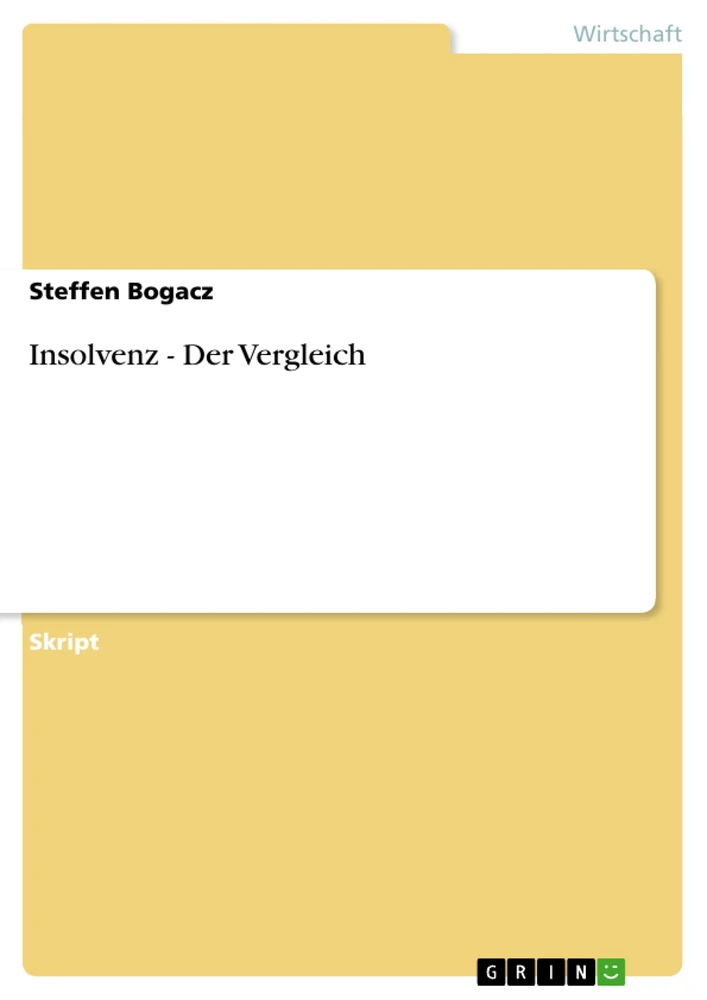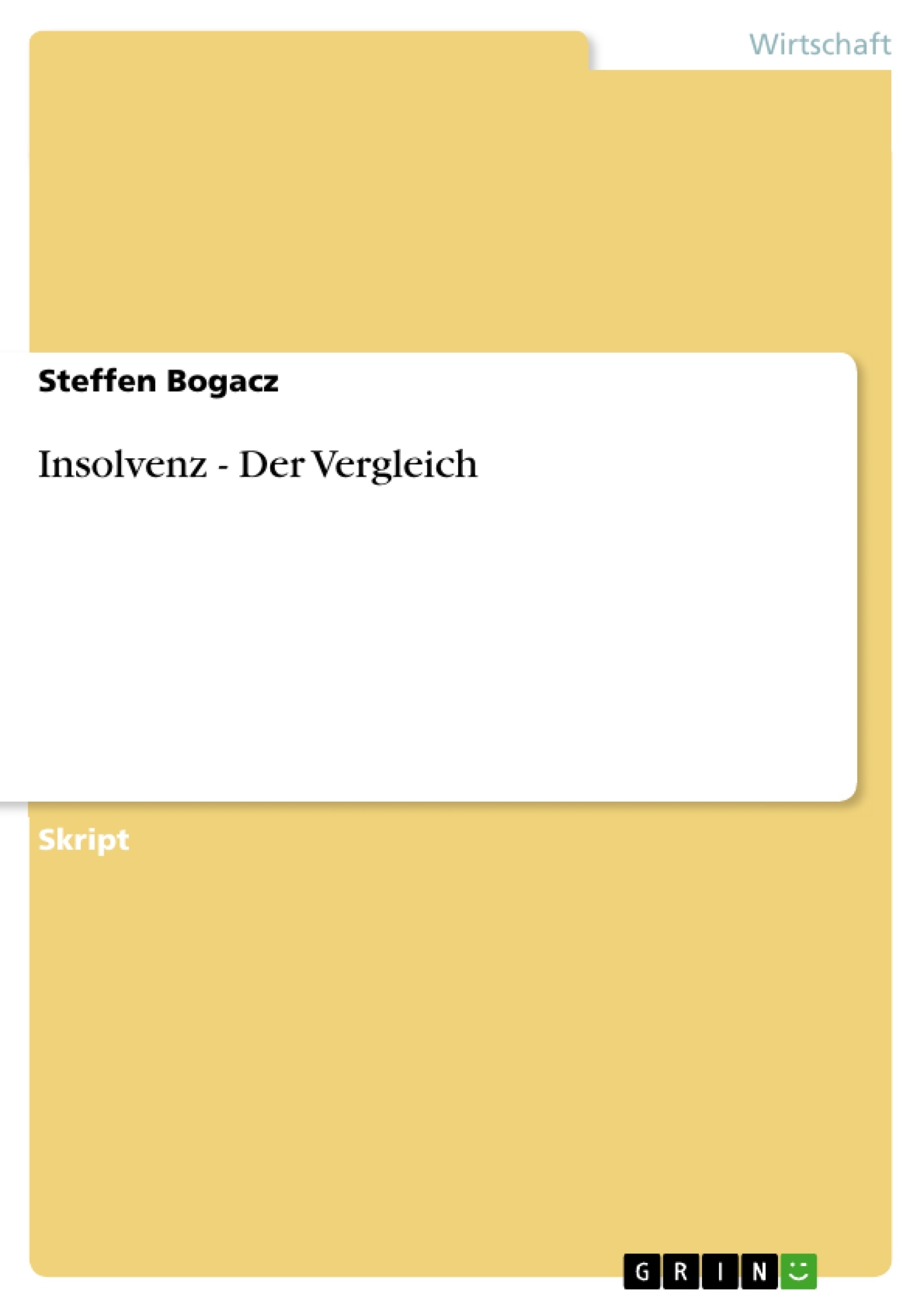Das Ziel dieses Skriptes ist es, eine Einsicht darüber zu vermitteln, was unter Insolvenz und insbesondere unter einem Vergleichsverfahren zu verstehen ist. Es werden sowohl außergerichtliche als auch gerichtliche Prozessvergleiche erörtert, mit besonderem Augenmerk auf den Ablauf und die Wirkung dieser Verfahren. Ziel ist es, Leserinnen und Lesern nicht nur theoretisches Wissen zu vermitteln, sondern auch praktische Einblicke in den Umgang mit Insolvenzverfahren zu geben.
Dieser Text bietet einen Einblick in die Grundlagen des Insolvenzvergleichs, einschließlich des außergerichtlichen Vergleichs und des Prozessvergleichs. Er erläutert den Prozess von der Eröffnung bis zur Durchführung eines Vergleichsverfahrens und beleuchtet dessen rechtliche Wirkungen.
1. Begriff
Das Ziel eines Vergleichsverfahrens ist es, durch einen Vergleich des Vergleichsschuldners mit allen Gläubigern den Konkurs dieses Schuldners abzuwenden. Dieses Verfahren wird in der Vergleichsordnung (VglO) geregelt. Die Abwendung des Konkurses, basiert auf gegenseitigem Nachgeben zwischen Schuldner und Gläubigern.
Die Einigung kann außergerichtlich (Kapitel 2) oder durch einen Prozessvergleich (siehe Kapitel 3) erfolgen. Das Verfahren des außergerichtlichen Vergleiches ist heute aber kaum noch von Bedeutung.
2. Der außergerichtliche Vergleich
Der Vorteil eines außergerichtlichen Vergleiches für den Schuldner liegt darin, dass ein außergerichtlicher Vergleich nicht bekannt gemacht werden muss. So entsteht für den Gläubiger bzw. die Gesellschaft kein Rufschaden, der über den Kreis des Schuldners und der Gläubiger hinaus geht.
Auch brauchen im Rahmen eines außergerichtlichen Vergleichs keine gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen vorgelegt zu werden. In einem außergerichtlichen Vergleich kann alles vereinbart werden:
- Quotenzahlung
- Stundung oder Liquidation von Schulden
- unterschiedliche Behandlung der Gläubiger
Der Vorteil für die Gläubiger liegt im allgemeinen darin, eine höhere Befriedigungsquote erlangen zu können, als es im Konkursfall anzunehmen ist.
Jedoch kann kein Gläubiger zu einem außergerichtlichen Vergleich, etwa durch Mehrheitsentscheidung gezwungen werden. Jeder einzelne Gläubiger hat das freie Recht, diesem Vergleich zu widersprechen und für sich volle Befriedigung zu verlangen. In den meisten Fällen, würde das Verhalten eines derartigen ,,Störers" zum Entfallen des außergerichtlichen Vergleiches führen.
Die Gefahr für die Gläubiger besteht darin, vom Schuldner nicht ausreichend genug über die wirtschaftliche Situation der Firma informiert zu werden. Das bedeutet, das der Schuldner möglicherweise die festgelegten Vereinbarungen nicht erfüllen kann. Die Durchführung dieses Vergleichs wird außerdem vom Gericht nicht überwacht, da sich das Gericht mit diesem Verfahren nicht befasst. Jedoch kann man die Durchführung von einer externen Stelle (z.B. einem Rechtsanwalt) überprüfen lassen.
3. Der Prozessvergleich
3.1. Eröffnung eines Vergleichsverfahren
Grundvoraussetzung für einen Vergleich ist die Insolvenz, also die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners. Wenn eine Überschuldung des Schuldners Konkursgrund ist, so rechtfertigt sie gleichzeitig auch ein Vergleichsverfahren. Dies gilt aber nur bei juristischen Personen und nichtrechtsfähigen Vereinen.
Ein Vergleichsverfahren kann nur auf Antrag des Schuldners gestellt werden. Im Gegensatz zum Konkurs können die Gläubiger hier das Verfahren nicht beantragen. Der Antrag auf ein Vergleichsverfahren ist nur zulässig, solange ein Konkursverfahren noch nicht begonnen hat. Stellt ein Gläubiger einen Konkursantrag, so kann der Schuldner diesen Antrag unterlaufen, indem er einen Vergleichsantrag stellt. Erst muss über den Vergleichsantrag entschieden werden. Das heißt, dass das Konkursverfahren erst beginnen kann, wenn ein beantragtes Vergleichsverfahren gescheitert ist.
Der Antrag des Schuldners muss einen bestimmten Vergleichsvorschlag enthalten. Die Mindestquote beträgt 35 %. Beansprucht der Schuldnern eine Zahlungsfrist von mehr als einem Jahr, erhöht sich die Quote auf 40 %. Der Vergleich muss allen Gläubigern gleiche Rechte gewähren. Eine Ausnahme ist nur zulässig, wenn die zurückgesetzten Gläubiger mit Kopfmehrheit und mit ¾ Forderungsmehrheit zustimmen. Der Antrag muss bestimmte Unterlagen enthalten, aus denen sich die Vermögenslage des Schuldners ergibt und anhand derer die Vermögenslage überprüft werden kann. Außerdem muss aus diesen Unterlagen die persönliche Vertrauenswürdigkeit des Schuldners zu ersehen ist.
Der Vergleichsschuldner muss also angeben bzw. einreichen:
- ob in den letzten fünf Jahren ein Insolvenzverfahren eingeleitet wurde oder ob er offenbart hat,
- ein Gläubiger- und Schuldverzeichnis,
- eine Erklärung über die in den letzten beiden Jahren getroffenen Verfügungen zugunsten naher Angehöriger.
3.2. Durchführung eines Vergleichsverfahrens
Die Entscheidung über den Antrag obliegt dem Richter, das weitere Verfahren führt in aller Regel der Rechtspfleger durch, es sei denn, der Richter behält sich die Durchführung ausdrücklich vor. Bis zur Entscheidung über den Antrag hat der Richter folgende Aufgaben:
- Bestellung des vorläufigen Verwalters
- Anhörung der zuständigen Berufsvertretung (Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Landwirtschaftskammer usw.),
- Sicherungsmaßnahmen treffen, die erforderlich scheinen, um die Gläubiger zu schützen (Verfügungsbeschränkungen),
- die Nachholungsfrist setzen, um fehlende Unterlagen herbeizuschaffen (die Frist beträgt höchstens vier Wochen).
Ein Ablehnung des Antrages erfolgt, wenn die Formalien nicht in Ordnung sind (z.B. die Bilanz fehlt) oder bereits eine Insolvenz in den letzten fünf Jahren vorgefallen ist oder eine
Sanierung durch den Vergleich nicht zu erwarten ist. Die Ablehnung erfolgt auch dann, wenn der Schuldner nicht vergleichswürdig ist, wenn er z.B. den Antrag schuldhaft verschleppt hat. Gegen die Ablehnung ist das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde gegeben. Hierfür beträgt die Frist eine Woche.
Wird der Antrag abgelehnt, so wird gleichzeitig über das Konkursverfahren entschieden. Entweder erfolgt die Eröffnung des Konkurses oder aber die Ablehnung mangels Masse.
Liegt kein Ablehnungsgrund vor, so beschließt der Richter die Eröffnung des Vergleichsverfahrens und bestellt einen Vergleichsverwalter. Der Eröffnungsbeschluss enthält:
- Tag und Stunde der Eröffnung,
- die Bestellung des Verwalters,
- die Bestimmung des Vergleichstermins (dieser muss innerhalb des nächsten Monats stattfinden),
- die Aufforderung an die Gläubiger, ihre Forderungen anzumelden.
Der Eröffnungsbeschluss wird grundsätzlich öffentlich bekannt gemacht. Außerdem muss die Eintragung im Handelsregister erfolgen. Die bekannten Gläubiger, der Verwalter und die Vergleichsschuldner werden durch Zustellung des Eröffnungsbeschlusses zum Termin geladen. Sämtliche Unterlagen liegen auf der Geschäftsstelle zur Einsichtnahme aus.
3.3. Wirkung eines Vergleichsverfahrens
Grundsätzlich gehören zu den Vergleichsgläubigern alle Gläubiger, die nichtbevorrechtigte Konkursgläubiger wären.
Nicht vom Vergleich betroffen sind:
- Aussonderungsberechtigte (der verlängerte Eigentumsvorbehalt gilt als Aussonderungsrecht),
- Absonderungsberechtigte (auch hier gilt die Sicherungsübereignung nur als Absonderungsrecht),
- Aufrechnungsberechtigte,
- Vorrechtsgläubiger
- Massegläubiger nach §59 Abs. 1 Nr. 3 KO (Lohn- und Gehaltsansprüche für die letzten sechs Monate).
Diejenigen Gläubiger, die später bis zu 30 Tagen vor Stellung des Eröffnungsantrages eine zwangsweise Sicherung oder Befriedigung erlangt haben, sind Vergleichsgläubiger. Ein Schuldner kann also durch einen Vergleichsantrag für das zu erwartende Konkursverfahren Zwangssicherheiten zerstören und damit die Masse anreichern. Gläubiger aus gegenseitigen Verträgen, die beide im Zeitpunkt der Eröffnung noch nicht voll erfüllt haben, sind keine Vergleichsgläubiger.
Weitere Wirkungen auf Gläubigerforderungen:
- Die Verjährung ist gehemmt.
- Betagte Forderungen gelten als fällig.
- Auflösend bedingte Forderungen gelten als unbedingt.
- Forderungen, die nicht auf Geld gerichtet sind, sind mit Schätzwert beteiligt (z.B. Warenlieferungsansprüche).
- Haftung von Gesamtschuldnern: Jeder Schuldner haftet für die gesamte Forderung. Fallen also mehrere Gesamtschuldner oder Bürger in Konkurs, so kann der Gläubiger in jedem Verfahren voll anmelden.
- Wiederkehrende Leistungen, die bestimmt sind (z.B. Rente auf zehn Jahre), werden addiert und abgezinst.
- Anhängige Prozesse werden unverändert fortgeführt (anders im Konkursverfahren, dort Unterbrechung)
- Neue Prozesse sind unbeschränkt möglich. Erkennt der Schuldner jedoch sofort an, so muss der Gläubiger die Kosten ertragen.
- Es entsteht eine Konkurssperre für alle Gläubiger.
- Vollstreckungsverbot für alle Gläubiger. Anhängige Zwangsvollstreckungen sind kraft Gesetzes eingestellt. Neue Zwangsvollstreckungen sind unzulässig.
- Das Gericht kann auf Antrag des Verwalters sogar die endgültige Einstellung oder Aufhebung der Vollstreckung anordnen, wenn die Verfügung über den Vollstreckungsgegenstand im Interesse der Gläubiger geboten ist.
Der Schuldner behält grundsätzlich die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über sein Vermögen. Es wird vom Verwalter lediglich die Geschäftsführung überwacht. Verbindlichkeiten, die nicht zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehören, soll der Schuldner nur mit Zustimmung des Verwalters eingehen. Andere Verbindlichkeiten muss er nicht begründen, wenn der Verwalter Einspruch erhebt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel eines Vergleichsverfahrens?
Das Ziel eines Vergleichsverfahrens ist es, durch einen Vergleich des Vergleichsschuldners mit allen Gläubigern den Konkurs dieses Schuldners abzuwenden. Dies basiert auf gegenseitigem Nachgeben zwischen Schuldner und Gläubigern.
Was ist der Unterschied zwischen einem außergerichtlichen und einem Prozessvergleich?
Ein außergerichtlicher Vergleich wird ohne Beteiligung des Gerichts geschlossen und muss nicht öffentlich bekannt gemacht werden. Ein Prozessvergleich wird im Rahmen eines Gerichtsverfahrens erzielt, wobei das Gericht das Verfahren überwacht.
Welche Vorteile bietet ein außergerichtlicher Vergleich für den Schuldner?
Der Vorteil für den Schuldner liegt darin, dass der außergerichtliche Vergleich nicht öffentlich bekannt gemacht werden muss, wodurch Rufschäden vermieden werden und keine gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen vorgelegt werden müssen.
Welche Vorteile bietet ein außergerichtlicher Vergleich für die Gläubiger?
Der Vorteil für die Gläubiger liegt darin, dass sie im Allgemeinen eine höhere Befriedigungsquote erlangen können, als es im Konkursfall anzunehmen ist.
Kann ein Gläubiger zu einem außergerichtlichen Vergleich gezwungen werden?
Nein, jeder Gläubiger hat das Recht, einem außergerichtlichen Vergleich zu widersprechen und volle Befriedigung zu verlangen.
Was sind die Voraussetzungen für die Eröffnung eines Vergleichsverfahrens?
Grundvoraussetzung ist die Insolvenz bzw. Zahlungsunfähigkeit des Schuldners. Bei juristischen Personen und nichtrechtsfähigen Vereinen rechtfertigt auch eine Überschuldung ein Vergleichsverfahren.
Wer kann einen Antrag auf ein Vergleichsverfahren stellen?
Nur der Schuldner kann einen Antrag auf ein Vergleichsverfahren stellen. Die Gläubiger können das Verfahren im Gegensatz zum Konkurs nicht beantragen.
Welche Unterlagen muss der Schuldner bei einem Antrag auf ein Vergleichsverfahren vorlegen?
Der Schuldner muss u.a. ein Gläubiger- und Schuldnerverzeichnis, eine Erklärung über Verfügungen zugunsten naher Angehöriger der letzten zwei Jahre und Informationen über eventuelle Insolvenzverfahren der letzten fünf Jahre vorlegen.
Was passiert, wenn der Antrag auf ein Vergleichsverfahren abgelehnt wird?
Wenn der Antrag abgelehnt wird, wird gleichzeitig über das Konkursverfahren entschieden. Entweder erfolgt die Eröffnung des Konkurses oder aber die Ablehnung mangels Masse.
Welche Wirkungen hat die Eröffnung eines Vergleichsverfahrens?
Die Eröffnung hat verschiedene Auswirkungen auf die Gläubigerforderungen, wie Hemmung der Verjährung, Fälligkeit betagter Forderungen und ein Vollstreckungsverbot für die Gläubiger.
Wer sind die Vergleichsgläubiger?
Grundsätzlich gehören zu den Vergleichsgläubigern alle Gläubiger, die nichtbevorrechtigte Konkursgläubiger wären. Ausgenommen sind unter anderem Aussonderungsberechtigte, Absonderungsberechtigte und Vorrechtsgläubiger.
Welche Rechte und Pflichten hat der Schuldner während des Vergleichsverfahrens?
Der Schuldner behält grundsätzlich die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über sein Vermögen, wird aber vom Verwalter überwacht. Das Gericht kann die Verfügungsbefugnis beschränken.
- Quote paper
- Steffen Bogacz (Author), 2001, Insolvenz - Der Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102253