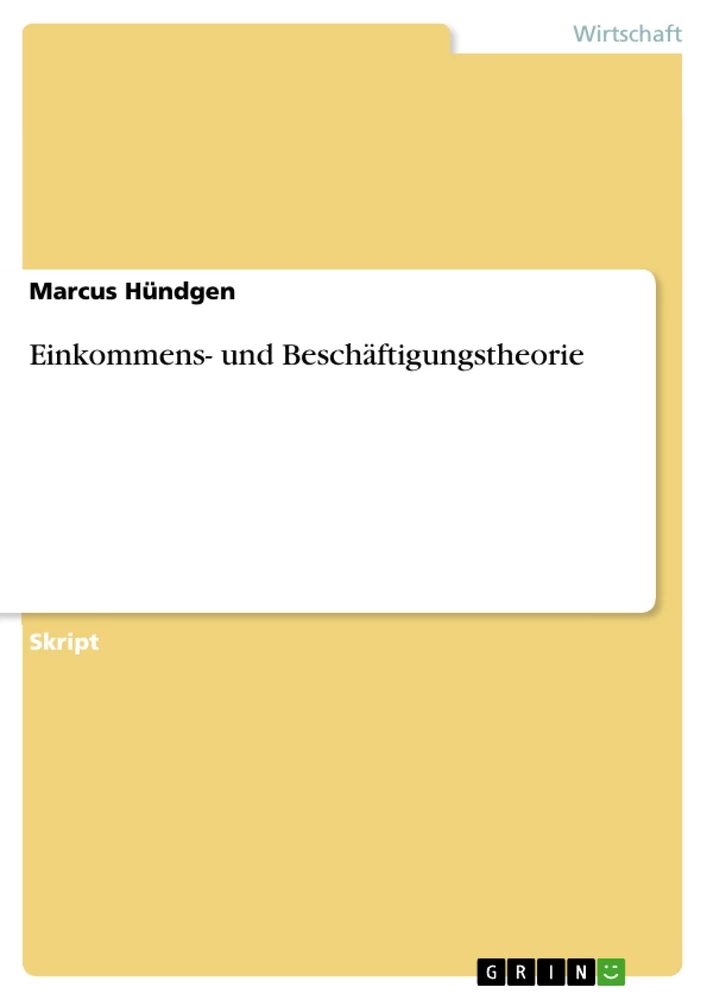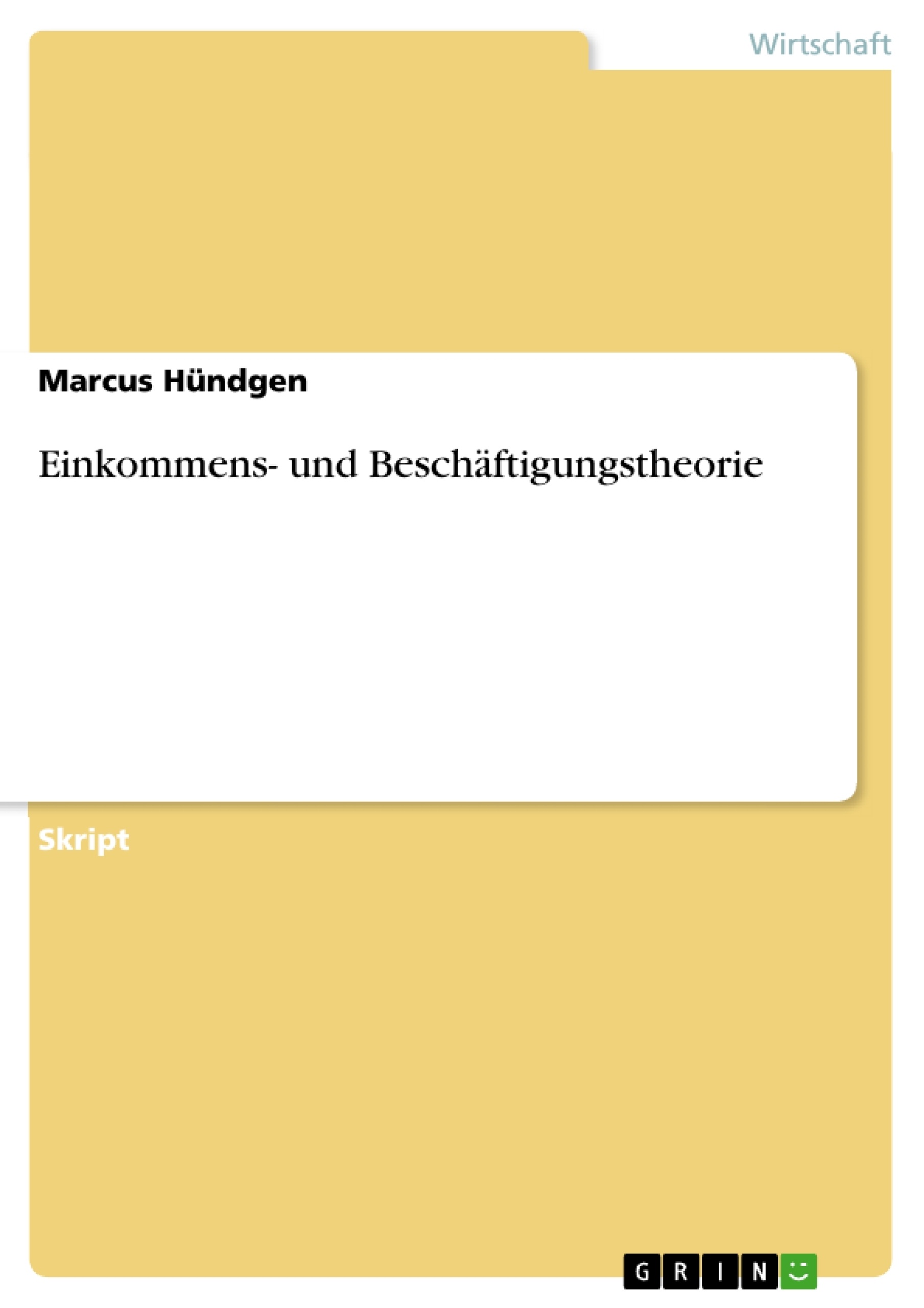Inhalt
7. Einkommens- und Beschäftigungstheorie
7.1. Untersuchungsgegenstände der Einkommens- und Beschäftigungstheorie
7.2. Unterschiede zur Kreislaufanalyse; Modelleinfluß und Grenzen des Ansatzes
7.3. Der Gütermarkt in einer geschlossenen Volkswirtschaft ohne staatliche ökonomische Aktivität
7.3.1. Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage
7.3.1.1. Die Konsumfunktion
7.3.1.1.1. Die Veränderlichen und ihre Beziehung zueinander
7. Einkommens- und Beschäftigungstheorie
Die in Kapitel 6. erläuterte Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) beschreibt eine Volkswirtschaft in einer bestimmten Periode, d.h. es wurde die größe der Ströme die zwischen den Sektoren flossen betrachtet.
In der Einkommens- und Beschäftigungstheorie geht es um die selben Gegebenheiten. Jedoch wird eine Erklärung für eine zukünftige Periode angestrebt. Es wird somit untersucht, von welchen Faktoren der Umfang der jeweiligen Ströme abhängig ist. Das vorhandene Gleichungssystem bleibt bestehen, lediglich die betrachteten Größen sind nun geschätzte bzw. geplante Größen.
Beispiel: C H = geplante Ausgaben der Konsumhaushalte im nächsten Jahr
Desweiteren kommt eine - dem Bruttosozialprodukt übergeordnete - Gleichung hinzu:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Diese Gleichung erinnert stark an die Gleichung des Bruttosozialprodukts zu Marktpreisen in der Verwendungsrichtung, lediglich die Importe wurden noch nicht subtrahiert. Die geplante Nachfrage berücksichtigt nicht die Importe, da diese ein „Angebot des Auslands“ darstellen.
7.1. Untersuchungsgegenstände der Einkommens- und Beschäftigungstheorie
- Wovon hängt die Höhe der geplanten Nachfrage, des Bruttosozialprodukts, des Volkseinkommens und der Beschäftigung ab?
- Wann herrscht zwischen dem geplanten Angebot und der geplanten Nachfrage ein Geichgewichtszustand? Was passiert bei Ungleichgewicht? Wie wird das ex ante Ungleichgewicht in ein ex post Gleichgewicht umgewandelt?
- Welche Auswirkungen haben Steueränderungen, Änderungen der Staatsausgaben, Staatsverschuldung, Export / Import auf das Sozialprodukt, Volkseinkommen und den Preis?
7.2. Unterschiede zur Kreislaufanalyse, Modelleinfluß und Grenzen des Ansatzes
Die Kreislaufanalyse beschäftigt sich mit der nachträglichen Ermittlung des
Sozialprodukts für abgeschlossene Perioden hinsichtlich Entstehung, Verteilung und Verwendung. Handelt es sich in diesem Zusammenhang um eine bestimmte Periode und eine bestimmte Volkswirtschaft so spricht man von volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (VGR).
Die Einkommens- und Beschäftigungstheorie beschäftigt sich mit den Plangrößen für bevorstehende noch nicht abgeschlossene Perioden.
Die geplanten Ausgaben werden als geplante Nachfrage verstanden. Diese geplanten Größen sind jedoch mit vielen Unsicherheitsfaktoren behaftet. Um diese Unsicherheitsfaktoren auszuschalten werden folgende Funktionen aufgestellt:
- Konsumfunktion
- Investitionsfunktion
- Staatsausgabenfunktion
- Exportfunktion
Funktion der geplanten Ausgaben
Es liegt auf der Hand, daß sich durch diese Vielzahl von Funktionen ein sehr diffiziles Untersuchungsgebiet ergibt. Da folgend lediglich die Grundzüge verdeutlicht werden sollen beschränken wir uns auf ein Modell einer geschlossenen Volkswirtschaft ohne staatliche Aktivität:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In der letzten Gleichung entspricht Y m gleichzeitig Y f
, da keine Steuern und
Subventionen anfallen. Im Rahmen dieses Modells wird zwischen 3 Märkten unterschieden:
1. Markt für das Sozialprodukt
- Unterscheidung zwischen geplanter Nachfrage und geplantem Angebot
- Die geplante Nachfrage hängt vom Kapitalstock1 ab.
- Somit ist bei gegebenem Kapitalstock die Nachfrage nach dem Sozialprodukt von der Höhe der Beschaffung abhängig.
- Bei Vollauslastung bzw. Vollbeschäftigung führt eine weitere Nachfrage zu keiner Steigerung des Sozialprodukts
2. Arbeitsmarkt
- Geplantes Angebot und geplante Nachfrage nach Arbeit treffen aufeinander.
- Der Preis für die Arbeit wird Geldlohnsatz (W) bezeichnet und die der nominale Preis (inkl. Inflation)
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Untersuchungsgegenstand der Einkommens- und Beschäftigungstheorie?
Die Einkommens- und Beschäftigungstheorie untersucht, wovon die Höhe der geplanten Nachfrage, des Bruttosozialprodukts, des Volkseinkommens und der Beschäftigung abhängt. Sie befasst sich auch damit, wann ein Gleichgewichtszustand zwischen geplantem Angebot und geplanter Nachfrage herrscht und welche Auswirkungen Steueränderungen, Staatsausgaben, Staatsverschuldung sowie Exporte/Importe auf das Sozialprodukt, Volkseinkommen und den Preis haben.
Worin bestehen die Unterschiede zwischen der Kreislaufanalyse und der Einkommens- und Beschäftigungstheorie?
Die Kreislaufanalyse beschäftigt sich mit der nachträglichen Ermittlung des Sozialprodukts für abgeschlossene Perioden, während die Einkommens- und Beschäftigungstheorie sich mit Plangrößen für bevorstehende, noch nicht abgeschlossene Perioden befasst. Die geplanten Ausgaben werden in der Einkommens- und Beschäftigungstheorie als geplante Nachfrage verstanden.
Welche Funktionen werden in der Einkommens- und Beschäftigungstheorie verwendet, um Unsicherheitsfaktoren auszuschalten?
Um Unsicherheitsfaktoren zu reduzieren, werden in der Einkommens- und Beschäftigungstheorie Funktionen wie die Konsumfunktion, Investitionsfunktion, Staatsausgabenfunktion und Exportfunktion aufgestellt.
Welche Vereinfachungen werden im Modell einer geschlossenen Volkswirtschaft ohne staatliche Aktivität vorgenommen?
Im Modell einer geschlossenen Volkswirtschaft ohne staatliche Aktivität werden keine Steuern und Subventionen berücksichtigt. Es wird zwischen drei Märkten unterschieden: dem Markt für das Sozialprodukt, dem Arbeitsmarkt und dem Geldmarkt (der hier nicht näher erläutert wird).
Was sind die Hauptaspekte des Marktes für das Sozialprodukt in diesem Modell?
Auf dem Markt für das Sozialprodukt wird zwischen geplanter Nachfrage und geplantem Angebot unterschieden. Die geplante Nachfrage hängt vom Kapitalstock ab, und bei Vollauslastung bzw. Vollbeschäftigung führt eine weitere Nachfrage nicht zu einer Steigerung des Sozialprodukts.
Was sind die Hauptaspekte des Arbeitsmarktes in diesem Modell?
Auf dem Arbeitsmarkt treffen geplantes Angebot und geplante Nachfrage nach Arbeit aufeinander. Der Preis für die Arbeit wird Geldlohnsatz (W) bezeichnet und die der nominale Preis (inkl. Inflation).
- Quote paper
- Marcus Hündgen (Author), 1997, Einkommens- und Beschäftigungstheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102241