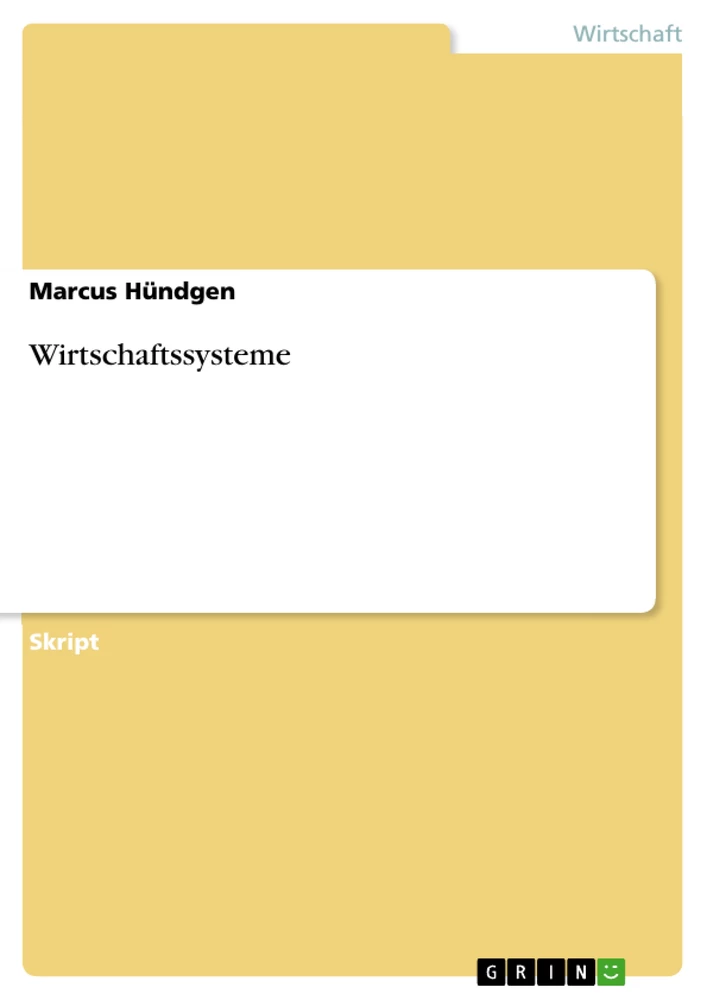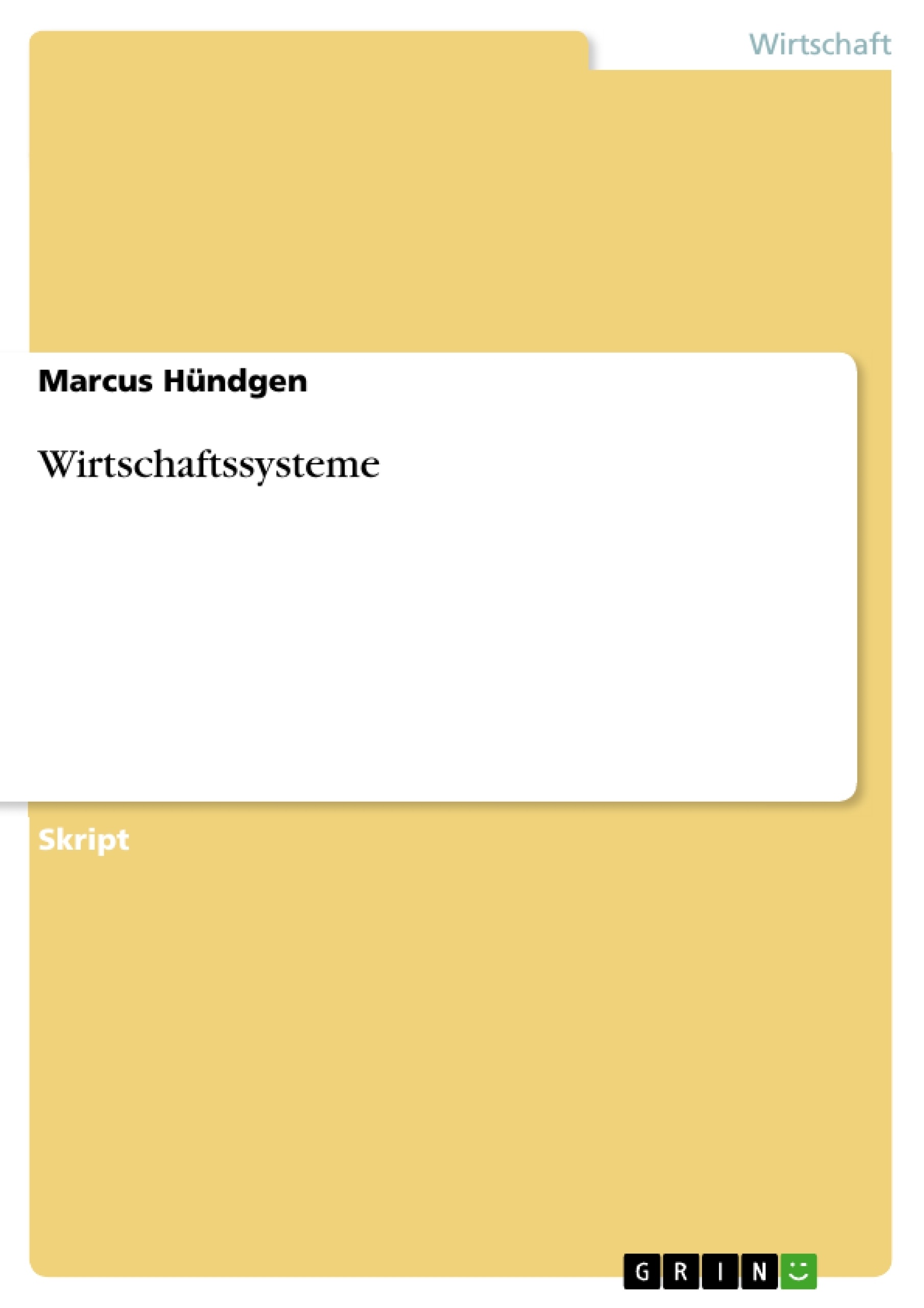Inhalt
2 . Wirtschaftssysteme
2.1. Der Wirtschaftsprozeß
2.2. Die Wirtschaftsordnung
2.2.1. Ordnung als Bedingung des Wirtschaftens
2.2.2. Ordnungsprobleme
2.2.3. Wirtschaftsordnungselemente
2.3. Grundlagen der marktwirtschaftlichen Steuerung
2.3.1. Grundidee
2.3.2. Planungs- und Koordinationssystem
2.3.2.1. Begriff und Funktionen des Marktes
2.3.2.2. Nachfragefunktion auf Gütermärkten Angebotsfunktion auf Gütermärkten
2.3.2.4. Gleichgewicht und Wirkung von Kurvenverschiebungen
2.3.2.5. Langfristige Lenkung durch Preise
2.3.3. Leistungsanreize und -kontrollen
2.3.4. Konstituierende und regulierende Prinzipien der Wettbewerbsordnung
2.4. Zentralverwaltungswirtschaft
2.4.1. Planbereiche und Organisation
2.4.2. Planung, Koordination und Plandurchführung
2.4.3. Leistungsanreize und -kontrollen
2.5. Wirtschaftsordnung in der Realität und als politisches Problem
2. Wirtschaftssysteme
2.1. Der Wirtschaftsprozess
Die Gesamtheit der Vorgänge, die auf ökonomische Entscheidungen der Wirtschaftssubjekte beruhen nennt man Wirtschaftsprozess Transaktionen zwischen Wirtschaftssubjekten.
Was gehört zum Wirtschaftsprozess?
- Produktion, Transport, Lagerung, Kauf und Verkauf von Waren (Umfang der Güter und des Verbrauchs)
- Angebot und Nachfrage von Dienstleistungen (z.B. Reisen)
- Bildung von Preisen, Löhnen, Aktienkursen, Devisenkursen und Zinsen
- Entscheidung über Investition
- Einstellung / Entlassung von Arbeitskräften
- Straßenbau / Eisenbahnverbindungen
- Steuerzahlungen, Pensionen, Wohn- und Kindergeld, etc.
Beispiel: Mineralölsteuererhöhung Folgen:
- geringere Sparquote
- Konsum sinkt
- langfristig: Tendenz zu Wagen mit geringerem Verbrauch
- mehr Diesel
- Beeinflussung der Handelsbilanz (durch Tanken in Luxemburg)
- was geschieht mit den Steuereinnahmen ???
- etc.
Aufgrund der Anzahl der Transaktionen ist der Wirtschaftsprozess für niemanden vollständig übersehbar, er kann daher auch nicht vollständig aufgezeigt, beherrscht und analysiert werden. Er muß dennoch rational ablaufen um zumindest annähernd das ökonomische Prinzip zu verwirklichen. Dies ist Aufgabe der Wirtschaftsordnung, da Entscheidungen nicht zufällig getroffen werden.
2.2. Die Wirtschaftsordnung
Die Wirtschaftsordnung setzt Rahmenbedingungen, an welche die einzelnen Wirtschaftssubjekte mehr oder weniger gebunden sind.
Diese Rahmenbedingungen bestehen aus:
- Institutionen1, die den Erfolg sicherstellen: staatliche Einrichtungen (Behörden),
soziale Gebilde (Familie, Vereine), künstliche Einrichtungen (Eigentum, Geld, Märkte)
- System von Normen2 welche auf bestimmte Zielbündel ausgerichtet sind:
- rechtliche Normen (Gesetze)
- sittliche Normen (Mode, Gebräuche,...)
Aufgrund dieser Rahmenbedingungen wird der Wirtschaftsprozess in bestimmtem Umfang vorhersehbar, d.h. Risiken und Ungewissheiten werden vermindert.
Grundannahmen der Institutionsökonomik:
1. Methologischer Individualismus:
Gruppen von Individuen (wie Unternehmen, Partei, Volk) sind keine eigenständigen Wesen mit eigenen Zielen, eigenem Willen und eigenständigen Verhalten.
Handlungen der Gruppe lassen sich durch Einstellungen, Ziele und Verhaltensweisen ihrer einzelnen Mitglieder erklären.
2. Individuelle Rationalität:
Zweckrationale Wirtschaftssubjekte verhalten sich perfektrational sowie eingeschränktrational3.
Rationalität basiert auf dem Konzept der Anreize (incentives und disincentives)!
3. Existenz von Transaktionskosten
Unsere Handlungen wie Kauf, Konsum, Investition, Abschluß von Verträgen, etc. Verursacht eine Fülle von Transaktionskosten, welche den größten Teil des Sozialproduktes ausmachen (grobe Schätzungen gehen bis zu 80 %).
Transaktionskosten sind
- Kosten der Marktnutzung
- Anbahnungskosten
- Kosten des Vertragsabschlusses
- Kontrollkosten
- Kosten der Organisationsnutzung von Unternehmen
- Aufgabenzuteilung
- Weisungsrechte
- Informations- und Kommunikationssysteme
- Kontrollkosten
- Politische Transaktionskosten
- Verteidigung
- Kosten des Rechtssystems
- Infrastruktur
Kriterien für die Rahmenbedingungen:
- effiziente Regelungen setzen sich durch (Arbeitsteilung Spezialisierung)
- sie müssen zumindest vom Großteil der Bevölkerung akzeptiert werden
- sie müssen anpassungsfähig sein, d.h. wenn sich die Umwelt ändert, müssen sich auch die Regeln ändern.
- die Wirtschaftsordnung unterliegt ständigen Änderungen.
Es muß eine grundsätzliche Entscheidung für eine der beiden grundlegenden Wirtschaftssysteme gefällt werden:
- marktwirtschaftliche, dezentrale Systeme
- zentralverwaltungswirtschaftliche Systeme
2.2.1 Ordnung als Bedingung des Wirtschaftens
1. Komplexität des Wirtschaftsprozesses und der Zusammenhang der Wirtschaftssubjekte (Interdependenzen) machen Ordnung erforderlich. Die Rahmenbedingungen bedeuten eine Orientierungshilfe für richtiges oder falsches Verhalten.
2. Komplexität ist durch die weitgehende Arbeitsteilung und Spezialisierung entstanden; dadurch sind die Rahmenbedingungen notwendig.
3. Lenkung der Produktionsfaktoren; hierfür muß man über die Güterknappheit informiert sein. (Wer, was, wann, womit produziert)
4. Im Wirtschaftsprozess entstehen Einkommen, d.h. es muß entschieden werden, wer wieviel bekommt; Grundlage der Bedürfnisbefriedigung, d.h. Güterversorgung und Verteilung der Einkommen und Abgaben.
5. Leistungskontrollen und Leistungsanreize (Arbeitsteilung läßt Bedeutung, Einfluß und Motivation zurückgehen)
6. Spezialisierung / Arbeitsteilung ruft Abhängigkeit hervor. Durch unterschiedliche Verteilung und gegenseitige Abhängigkeit entstehen Machtpositionen und Hierarchien, die sowohl inhaltlich als auch zeitlich begrenzt werden müssen .
2.2.2. Ordnungsprobleme
1. Ziele / Wünsche der anderen Wirtschaftssubjekte müssen erkennbar gemacht werden, d.h. entprechende Informationen müssen bereitgestellt werden.
2. Ziele / Wünsche richten sich mittelbar auf bestimmte Güter, die mehr oder weniger knapp sind, d.h. Knappheit der Güter und deren Veränderung müssen angezeigt werden.
3. Wünsche und Knappheit werden zu Plänen, d.h. Koordination der Pläne der unterschiedlichen Wirtschaftssubjekte ist erforderlich um Verschwendung zu vermeiden.
4. Wirtschaftsordnung muß ein System von Leistungsanreizen und Kontrollen bereitstellen um Motivationsproblemen entgegenzuwirken.
5. Möglichkeiten der Konfliktregeleung wenn Interessen / Wünsche kollidieren.
Zielkonflikte zwischen
a) individuellen und kollektiven Zielen
b) individuellen und individuellen Zielen
c) kollektiven und kollektiven Zielen
Grundsätzliche Lösungsmöglichkeiten bieten die beiden Wirtschaftssysteme zur Ordnung des Ablaufs der Wirtschaftsprozesse mit ihren jeweils unterschiedlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten, d.h. die Antwort auf die Problemstellung ist systemabhängig.
2.2.3. Wirtschaftsordnungselemente
- Planungssystem: Das Planungssystem definiert den Planungsspielraum der
Wirtschaftssubjekte, stellt ein Informationssystem für die Planung bereit (ob zentrale oder dezentrale Planung).
- Eigentumsformen: Eigentumsformen liefern Leistungsanreize.
- Marktformen: Marktformen sorgen für den Wettbewerb.
- Unternehmensformen: Unternehmensformen stellen unterschiedliche rechtliche
Rahmenbedingungen für Wirtschaftsunternehmen zur Verfügung und entscheiden über den Umfang der Haftung für die ökonomischen Handlungen ( z.B. Publizitätspflichten, Mitbestimmung).
- Geldverfassung: Die Geldverfassung ist entscheidend für die Geldstabilität
oder Inflation.
- Finanzverfassung: Die Finanzverfassung ist wesentlich für die soziale
Ausgestaltung einer Volkswirtschaft.
2.3. Grundlagen der marktwirtschaftlichen Steuerung
Die Grundlagen der marktwirtschaftlichen Steuerung ergeben sich aus folgender Aufstellung:
1. Dezentrale Planung
2. Privateigentum
3. Wettbewerb auf allen Märkten
4. Geldwertstabilität
5. Staat beschränkt sich auf die Produktion öffentlicher Güter
2.3.1. Grundidee
Der Einzelne ist aus eigener Kraft selbst für sich und sein Schicksal verantwortlich. Die Voraussetzung hierfür schafft der Staat, d.h. Marktwirtschaft beinhaltet die Grundsatzentscheidung für Eigenverantwortung. Begrenzungen ergeben sich daraus, daß der Mensch in die Gemeinschaft eingebunden ist, d.h. mitverantwortlich ist.
Hieraus entsteht die soziale Marktwirtschaft.
- fördert Eigeninitiativen
- belohnt Leistung
- hohe Arbeitsproduktivität und dadurch auch entsprechend hohe Einkommen und entsprechend gute Güterversorgung
- erzeugt Druck, mit der Güterknappheit sorgsam umzugehen, d.h. erzeugt wirtschaftliche Effizienz als Verwirklichung des ökonomischen Prinzips.
Marktwirtschaft
- Sozialer Aspekt: Verteilung der Einkommen und Berufschancen
um Ungerechtigkeiten zu vermeiden und den
[...]
1 Instituitionen beeinflussen das Verhalten der Wirtschaftssubjekte
2 Normen begrenzen bzw. Beeinflussen unseren Verhaltensspielraum und damit unser Verhalten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Wirtschaftsprozess laut diesem Dokument?
Der Wirtschaftsprozess umfasst alle Vorgänge, die auf ökonomischen Entscheidungen der Wirtschaftssubjekte beruhen, also Transaktionen zwischen Wirtschaftssubjekten. Dazu gehören Produktion, Transport, Lagerung, Kauf und Verkauf von Waren, Angebot und Nachfrage von Dienstleistungen, Bildung von Preisen, Löhnen, Aktienkursen, Devisenkursen und Zinsen, Investitionsentscheidungen, Einstellung/Entlassung von Arbeitskräften, Infrastrukturmaßnahmen (Straßenbau, Eisenbahnverbindungen) sowie Steuerzahlungen, Pensionen, Wohn- und Kindergeld etc.
Was versteht man unter Wirtschaftsordnung?
Die Wirtschaftsordnung setzt Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln, an die die einzelnen Wirtschaftssubjekte mehr oder weniger gebunden sind. Diese Rahmenbedingungen bestehen aus Institutionen (staatliche Einrichtungen, soziale Gebilde, künstliche Einrichtungen wie Eigentum, Geld, Märkte) und einem System von Normen (rechtliche Normen, sittliche Normen).
Welche Grundannahmen hat die Institutionsökonomik?
Die Institutionsökonomik basiert auf folgenden Grundannahmen: 1. Methodologischer Individualismus (Handlungen von Gruppen lassen sich durch Einstellungen, Ziele und Verhaltensweisen der einzelnen Mitglieder erklären). 2. Individuelle Rationalität (Zweckrationale Wirtschaftssubjekte verhalten sich perfektrational sowie eingeschränktrational). 3. Existenz von Transaktionskosten (Kosten der Marktnutzung, Anbahnungskosten, Kosten des Vertragsabschlusses, Kontrollkosten, Kosten der Organisationsnutzung von Unternehmen, politische Transaktionskosten etc.).
Welche Kriterien sind für die Rahmenbedingungen einer Wirtschaftsordnung wichtig?
Wichtige Kriterien sind, dass effiziente Regelungen sich durchsetzen, die Regeln von der Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert werden, sie anpassungsfähig sind (d.h. sich bei Änderungen der Umwelt ändern müssen) und dass die Wirtschaftsordnung ständigen Änderungen unterliegt.
Welche grundlegenden Wirtschaftssysteme werden unterschieden?
Es wird grundsätzlich zwischen marktwirtschaftlichen, dezentralen Systemen und zentralverwaltungswirtschaftlichen Systemen unterschieden.
Welche Ordnungsprobleme gibt es im Wirtschaftsprozess?
Ordnungsprobleme sind u.a.: Erkennbarkeit der Ziele/Wünsche anderer Wirtschaftssubjekte, Anzeige der Knappheit von Gütern, Koordination der Pläne unterschiedlicher Wirtschaftssubjekte, Bereitstellung von Leistungsanreizen und Kontrollen zur Motivationssteigerung, Möglichkeiten der Konfliktregelung bei kollidierenden Interessen/Wünschen.
Welche Wirtschaftsordnungselemente werden genannt?
Genannte Wirtschaftsordnungselemente sind: Planungssystem, Eigentumsformen, Marktformen, Unternehmensformen, Geldverfassung und Finanzverfassung.
Was sind die Grundlagen der marktwirtschaftlichen Steuerung?
Die Grundlagen sind: dezentrale Planung, Privateigentum, Wettbewerb auf allen Märkten, Geldwertstabilität und eine Beschränkung des Staates auf die Produktion öffentlicher Güter.
Was ist die Grundidee der sozialen Marktwirtschaft?
Die Grundidee ist, dass der Einzelne aus eigener Kraft selbst für sich und sein Schicksal verantwortlich ist. Der Staat schafft hierfür die Voraussetzungen. Die soziale Marktwirtschaft fördert Eigeninitiativen, belohnt Leistung, erzeugt hohe Arbeitsproduktivität und dadurch hohe Einkommen und gute Güterversorgung. Sie erzeugt auch Druck, sorgsam mit Güterknappheit umzugehen (wirtschaftliche Effizienz).
- Quote paper
- Marcus Hündgen (Author), 1997, Wirtschaftssysteme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102239