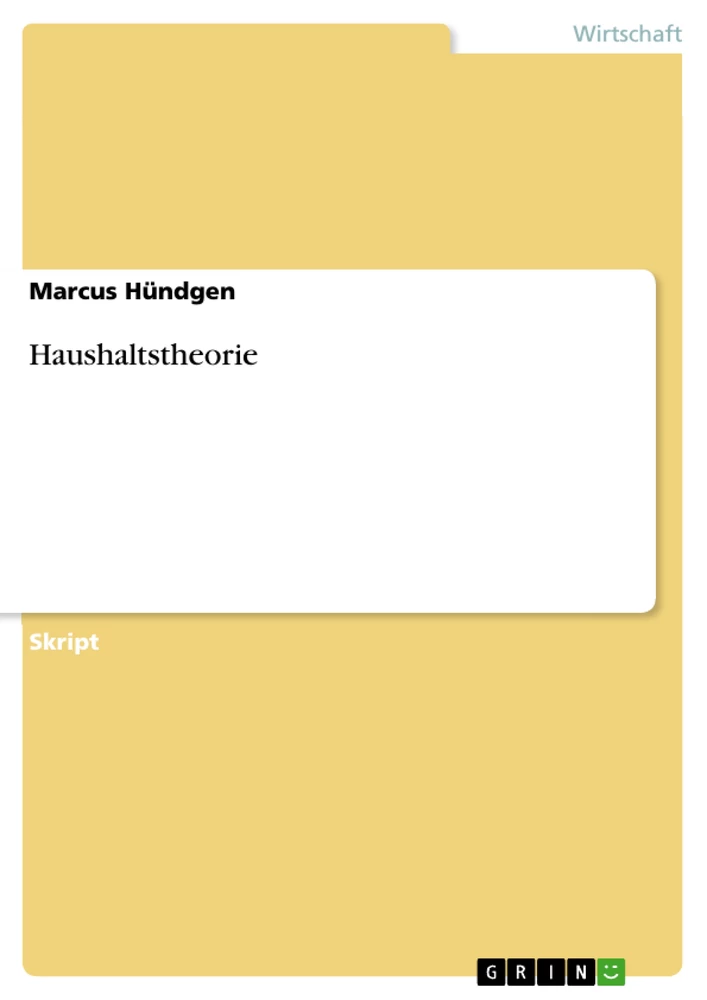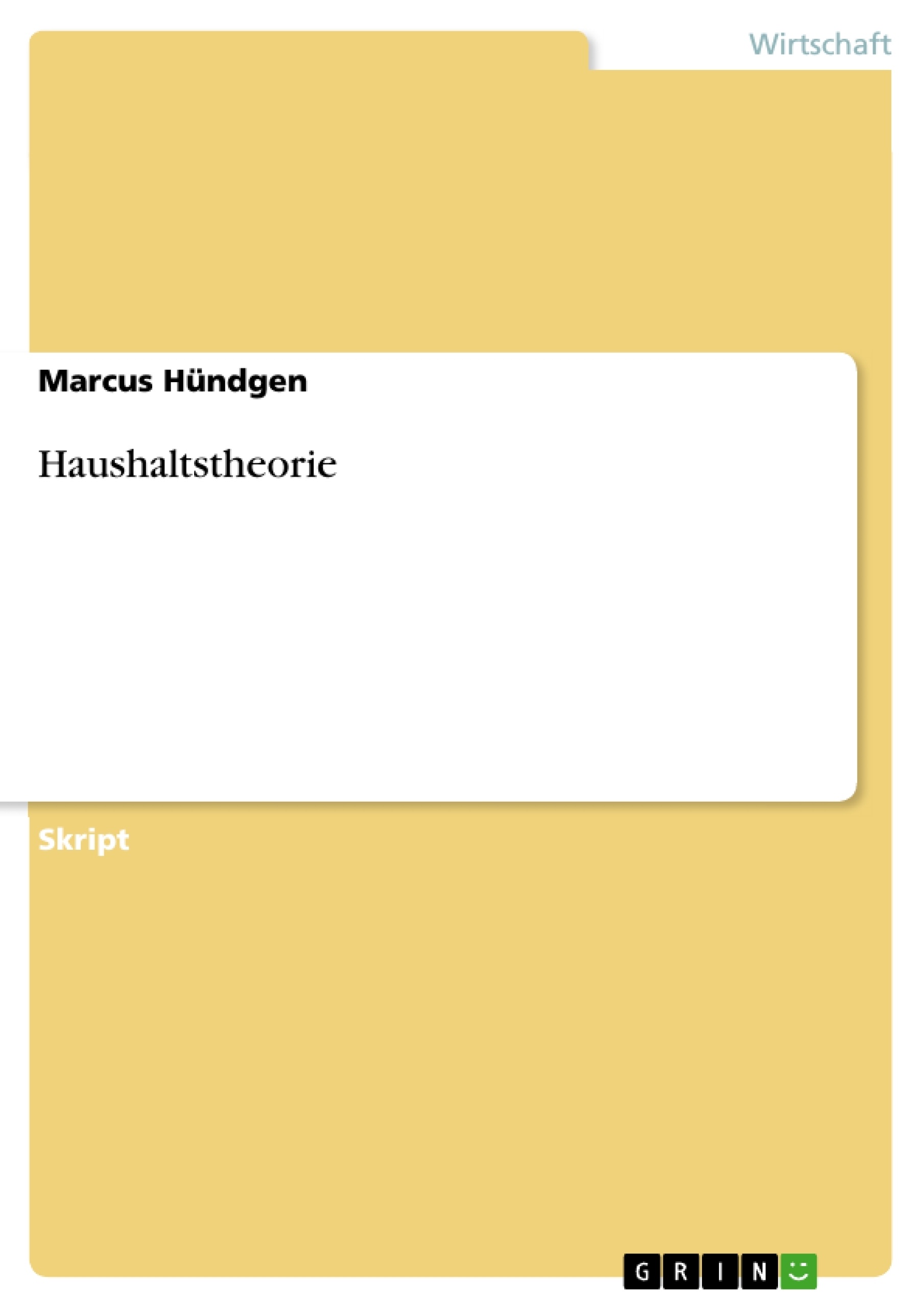Was treibt unsere Konsumentscheidungen wirklich an? Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Haushaltstheorie und enthüllen Sie die Mechanismen, die unser wirtschaftliches Verhalten bestimmen. Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine Reise durch die Grundlagen der Mikroökonomie, beginnend mit der Analyse von Einkommensverwendungsplänen und der kritischen Auseinandersetzung mit ihren Grenzen. Entdecken Sie die Schlüsselrolle der Grenznutzentheorie und lernen Sie, wie das erste und zweite Gossen’sche Gesetz unsere Entscheidungen beeinflussen, von der Sättigungsgrenze freier Güter bis zur optimalen Allokation knapper Ressourcen. Erforschen Sie, wie wir den Grenznutzen des Geldes in verschiedenen Verwendungsrichtungen ausgleichen, um den größtmöglichen Gesamtnutzen zu erzielen. Weiter geht es mit der Theorie der Wahlakte, die aufzeigt, wie wir unter gegebenen Annahmen, wie der partiellen Substituierbarkeit von Gütern und der vollständigen Verwendung unseres Einkommens, unsere Präferenzen gewichten. Verstehen Sie, wie sich Variationen im Einkommen und in den Preisen einzelner Güter auf unser Haushaltsgleichgewicht auswirken und wie daraus individuelle und gesamte Nachfragekurven entstehen. Abschließend werden Sie in die Elastizität der Nachfrage eingeführt, einem entscheidenden Konzept, um die Reagibilität der Nachfrage auf Veränderungen im Einkommen, Preis und Kreuzpreise zu verstehen. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Leitfaden für Studierende der Wirtschaftswissenschaften, aber auch für alle, die ein tieferes Verständnis für die Kräfte suchen, die unsere Konsumentscheidungen lenken und die Grundlage für ein fundiertes Finanzmanagement bilden. Erweitern Sie Ihr ökonomisches Wissen und gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die Welt der Mikroökonomie, von den grundlegenden Prinzipien bis hin zu den komplexen Zusammenhängen der Nachfrageelastizität, um Ihre eigenen finanziellen Entscheidungen bewusster und informierter zu treffen. Die fundierte Analyse ökonomischer Modelle wird durch praxisnahe Beispiele ergänzt, die es Ihnen ermöglichen, die Theorie in realen Situationen anzuwenden und somit ein umfassendes Verständnis der Haushaltstheorie zu entwickeln. Lassen Sie sich von diesem Buch inspirieren und entdecken Sie die verborgenen Mechanismen hinter Ihrem Konsumverhalten.
3. Haushaltstheorie
3.1. Einkommensverwendungsplan
3.2. Grenznutzentheorie
3.3. Theorie der Wahlakte
3.3.1. Ableitung des Haushaltsgleichgewichts
3.3.2. Variation des Einkommens
3.3.3. Variation des Preises eines Gutes
3.4. Individuelle- und Gesamtnachfragekurve
3.5. Elastizität der Nachfrage
3.5.1. Einkommenselastizität
3.5.2. Preiselastizität
3.5.3. Kreuzpreiselastizität
3. Haushaltstheorie
Was steckt hinter der negativen Steigung der Nachfragefunktion bzw. hinter dem Grad der Steigung?
3.1. Einkommensverwendungsplan
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Einwände:
- Nur wenige erstellen einen schriftlich fixierten Haushaltsplan.
- Es muß mit erwarteten Größen gerechnet werden.
Dieser Haushaltsplan ist bei Summenübereinstimmung rein formal im Gleichgewicht
(= Voraussetzung), jedoch muß auch das inhaltliche Gleichgewicht - die Realisierung des ökonomischen Prinzips - realisiert werden, d.h. Berücksichtigung der Opportunitäts- kosten.
Ausgangspunkte:
- Bedürfnisse (u)
- Einkommen (y) aus y = Q * P, wobei Q = Menge und P = Preise.
- Güter die sich aus der Bedürfnisstruktur ableiten lassen (pi)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Nutzen1 (N) soll hierbei mit Hilfe der Opportunitätskosten maximiert werden.
3.2. Grenznutzentheorie
Es gilt das Opportunitätskostenprinzip zu verwirklichen, d.h. unwichtigere Bedürfnisse dürfen nicht zu Lasten wichtigerer Bedürfnisse gehen.
Kategorienunterscheidung:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Grenznutzenbetrachtung ist für ökonomische Entscheidungen wichtiger. Sie vergleicht zusätzliche Kosten mit zusätzlichen Nutzen.
Die Messung des Grenznutzen erfolgt mit Hilfe der Opportunitätskosten, d.h. ständige Überlegung ob ein bestimmter Konsum notwendig ist bzw. es keine bessere Verwendung gibt2. Da Nutzen eine subjektive Größe ist, muß jeder Einzelne die Opportunitätskosten abschätzen.
1. Gossen’sche Gesetz3
Mit fortschreitendem Konsum immer weiterer Einheiten des gleichen Gutes nimmt der Nutzen jeder weiteren Einheit ab, bis die Sättigung erreicht ist
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Grenznutzenfunktion ist prinzipiell abhängig von der Zeiteinheit der Periode. Hier liegt die Grenze bei xi = 5 (=Sättigungspunkt, Grenznutzen = 0), unter der Voraussetzung, daß das Gut nichts kosten bzw. wir vernünftig handeln.
Konsequenzen bei der Nutzenmaximierung:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.Bei freien Gütern erfolgt die Aufnahme bis zum Erreichen der Sättigungsgrenze.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2. Bei öffentlichen Gütern (z.B.: Bildung, Autobahnen) wird ebenfalls die Sättigungsgrenze erreicht (Diskussion der Überlastung der Hochschulen, etc.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3. Bei knappen Gütern erreicht man die Sättigungsgrenze für gewöhnlich nicht; der Konsum bleibt im positiven Bereich der Grenznutzenfunktion da zusätzliche Einheiten etwas kosten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Merke: Mit jeder konsumierten Einheit verringert sich der Gebrauchswert !!!
2. Gossen’sches Gesetz4
4. Bei Güter mit verschiedene Verwendungsrichtungen wird der Grenznutzen ein Maximum, wenn das Gut so aufgeteilt wird, daß der Grenznutzen in allen Verwendungsrichtungen gleich groß ist.
Es steht zum Beispiel eine bestimmte Menge an Strom zur Verfügung, welche in verschiedene Verwendungsrichtungen aufgeteilt wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5. Verallgemeinerung des 2. Gossen’schen Gesetzes
Bei mehreren Gütern gilt als „Basis“ das Geld, da es universell einsetzbar ist. Es stiftet zwar nur indirekten Nutzen jedoch kann man jedem Gut einen Preis zu- ordnen, d.h. der Grenznutzen des Geldes muß ausgeglichen werden sofern das
2. Gossen’sche Gesetz verwirklicht werden soll. Somit muß der Grenznutzen des Geldes in jeder Verwendungsrichtung gleich großen Nutzen bringen.
Beispiel: p1 = 1,00 DM (1l Diesel); p2 = 3,00 DM (Zigaretten)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grenznutzen verhalten sich zueinander wie die Preise der Güter. Somit muß hier jede Einheit des Gutes 1 den dreifachen Wert der (letzten) Einheit des Gutes 2 haben.
Gleichgewichtsbedingung, d.h. jede zuletzt aufgewendete DM bringt den gleichen Grenznutzen.
ist die optimale Aufteilung und entspricht somit
dem größtmöglichen Gesamtnutzen
Einwand: Nutzen ist nicht auf einer metrischen Skala meßbar, d.h. nicht kardinal meßbar sondern eine oridinale Größe.
3.3. Theorie der Wahlakte Annahmen:
1. Es werden lediglich zwei Güter betrachtet. Diese beiden Güter haben eine bestimmte Nutzenfunktion, d.h. sie stiften gemeinschaftlichen Nutzen. Je höher die verbrauchte Menge eines Gutes desto höher der Gesamtnutzen.
- = f (m1, m2)
2. Die beiden Güter sind teilweise substituierbar, d.h. es besteht kein festes Mengenverhältnis und es wird auf kein Gut ganz verzichtet.
3. Das Einkommen ist gegeben und wird voll verbraucht, d.h. Sparen und Konsum anderer Güter wird ausgeschalten.
Einkommen (y) = Konsumsumme y = 1200
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten5
[...]
1 Nutzen: Befriedigung die ein Gut beim Konsum liefert. Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2 Rationales Verhalten
3 = Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen oder auch Sättingungsgesetz
4 Genußausgleichsgesetz bzw. Gesetz vom Ausgleich der Grenznutzen
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Haushaltstheorie und was behandelt sie?
Die Haushaltstheorie befasst sich mit der Frage, was hinter der negativen Steigung der Nachfragefunktion bzw. hinter dem Grad der Steigung steckt. Sie analysiert, wie Haushalte ihr Einkommen verwenden, um ihren Nutzen zu maximieren.
Was ist ein Einkommensverwendungsplan und welche Einwände gibt es dagegen?
Ein Einkommensverwendungsplan ist eine Übersicht darüber, wie ein Haushalt sein Einkommen für verschiedene Güter und Dienstleistungen aufteilt. Einwände sind, dass nur wenige Menschen einen solchen Plan schriftlich erstellen und dass er auf erwarteten Größen basiert.
Was ist die Grenznutzentheorie und wie hängt sie mit dem Opportunitätskostenprinzip zusammen?
Die Grenznutzentheorie besagt, dass wirtschaftliche Entscheidungen durch den Vergleich zusätzlicher Kosten mit zusätzlichem Nutzen getroffen werden. Sie ist eng mit dem Opportunitätskostenprinzip verbunden, da unwichtigere Bedürfnisse nicht zu Lasten wichtigerer Bedürfnisse gehen sollen. Der Grenznutzen wird mit Hilfe der Opportunitätskosten gemessen.
Was sind die Gossen’schen Gesetze und welche Bedeutung haben sie für die Nutzenmaximierung?
Es gibt zwei Gossen’sche Gesetze:
- Das erste Gesetz (Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen) besagt, dass mit fortschreitendem Konsum immer weiterer Einheiten des gleichen Gutes der Nutzen jeder weiteren Einheit abnimmt, bis die Sättigung erreicht ist.
- Das zweite Gesetz (Genußausgleichsgesetz) besagt, dass bei Gütern mit verschiedenen Verwendungsrichtungen der Grenznutzen ein Maximum wird, wenn das Gut so aufgeteilt wird, dass der Grenznutzen in allen Verwendungsrichtungen gleich groß ist. Verallgemeinert besagt es, dass der Grenznutzen des Geldes in jeder Verwendungsrichtung gleich großen Nutzen bringen muss.
Was sind die Annahmen der Theorie der Wahlakte?
Die Theorie der Wahlakte basiert auf folgenden Annahmen:
- Es werden lediglich zwei Güter betrachtet.
- Die beiden Güter sind teilweise substituierbar.
- Das Einkommen ist gegeben und wird voll verbraucht.
Was ist eine Indifferenzkurve?
Eine Indifferenzkurve beinhaltet alle Kombinationen von Gütern, die dem Haushalt den gleichen Nutzen bringen.
Was bedeuten die Begriffe "kardinal" und "ordinal" im Zusammenhang mit Nutzen?
"Kardinal" bedeutet, dass Nutzen auf einer metrischen Skala messbar ist, während "ordinal" bedeutet, dass Nutzen nur in eine Rangordnung gebracht werden kann, ohne absolute Werte zuzuweisen.
Was ist die Gleichgewichtsbedingung in Bezug auf den Grenznutzen?
Die Gleichgewichtsbedingung besagt, dass jede zuletzt aufgewendete Einheit (z.B. DM) den gleichen Grenznutzen bringen muss, um eine optimale Aufteilung zu gewährleisten und den größtmöglichen Gesamtnutzen zu erzielen.
- Quote paper
- Marcus Hündgen (Author), 1997, Haushaltstheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102238